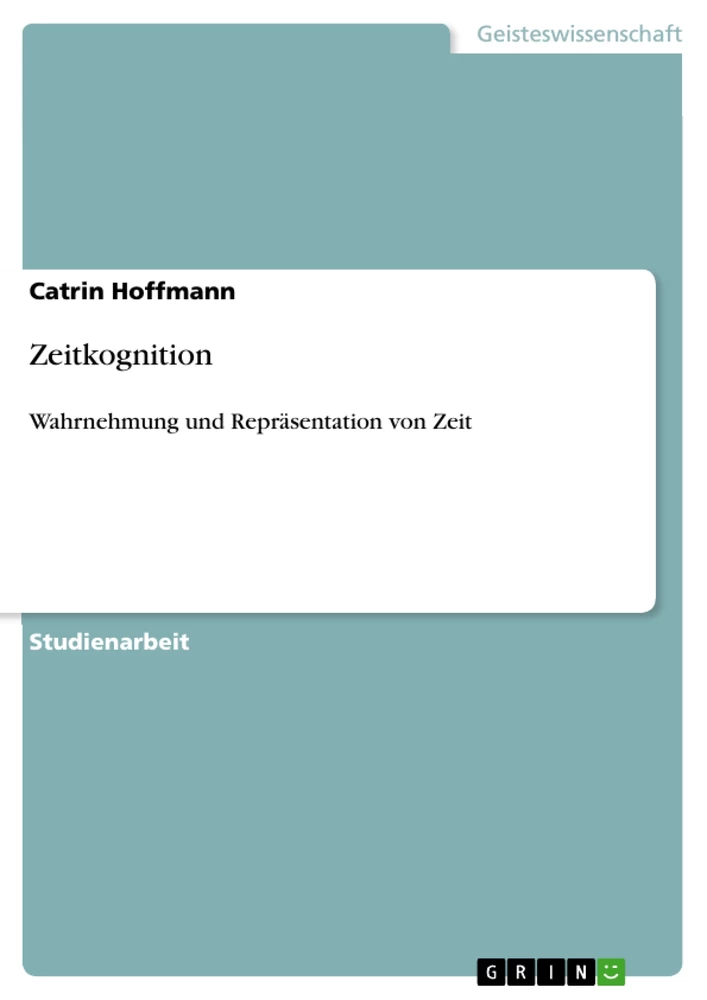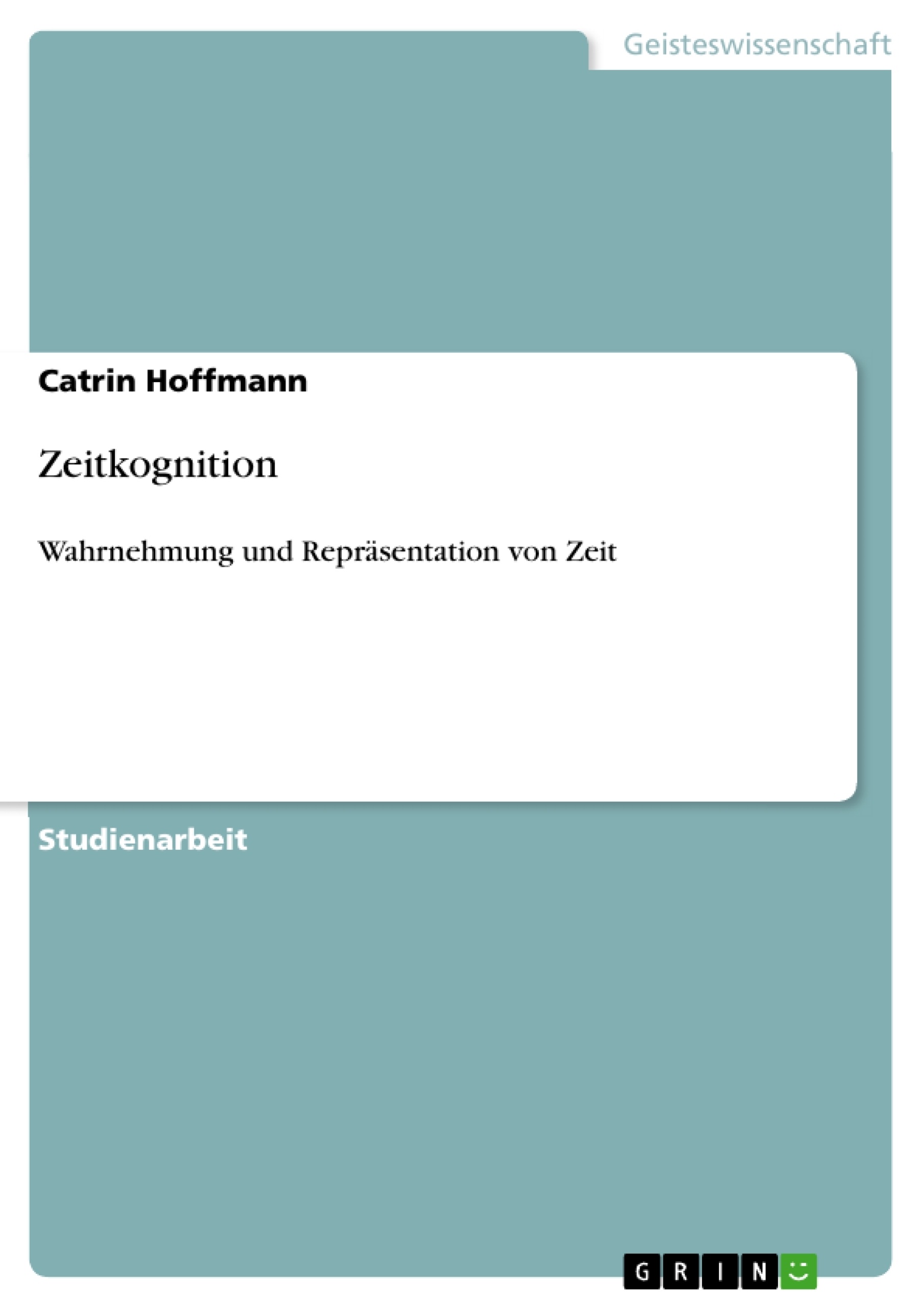Wie sehen Menschen Zeit und wie ordnen sie sie in ihren Alltag ein? Welche kulturellen Unterschiede gibt es in der Zeitwahrnehmung? Das sind Fragen, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt. Sie wurde im Rahmen eines fächerübergreifenden Seminars der Psychologie und Ethnologie mit dem Titel „Raum und Zeit“ erstellt.
Es soll eine Übersicht über die Zeitkognition und damit zusammenhängende Phänomene gegeben werden. Diese werden anhand von Beispielen aus verschiedenen Kulturen verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wahrnehmung von Zeit
- Physikalische Zeit versus psychische Zeit
- Die Psychische Uhr
- Wahrnehmung und Gegenwart
- Wann geschieht etwas gleichzeitig, wann als eine Folge von Ereignissen?
- Einflüsse auf das Zeitempfinden
- Zeiträume „voller Nichts“
- Zeit erklären
- Welche Art von Vergleichen gibt es?
- Räumliche Vergleiche
- Das „moving time”- und das „moving ego”- Model
- Vergleiche mit Bewegungen
- Bezeichnungen für Dauer und Wiederholung
- Einordnen von Zeitpunkten
- Weitere Möglichkeiten der Zeitdarstellung
- Wie sieht Zeit aus?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, das menschliche Empfinden und die Wahrnehmung von Zeit im kulturellen Kontext zu untersuchen. Es soll ergründet werden, wie wir Zeit subjektiv erleben, wie sich dieses Erlebnis von der physikalischen Zeit unterscheidet und welche Faktoren unser Zeitempfinden beeinflussen.
- Physikalische Zeit versus psychische Zeit
- Die „mentale Konstruktion“ von Zeit
- Die Rolle äußerer Anhaltspunkte für die Zeiterfassung
- Die Wahrnehmung von Gleichzeitigkeit und zeitlicher Abfolge
- Einflüsse auf die Zeitwahrnehmung und das Zeitempfinden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Schwierigkeit, Zeit zu verstehen, obwohl wir sie mit Uhren messen können. Sie stellt Fragen zur subjektiven Wahrnehmung von Zeit und deutet auf die Rolle von Alltagserfahrungen und äußeren Anhaltspunkten bei der Zeitmessung hin.
Wahrnehmung von Zeit
Dieses Kapitel untersucht die Unterschiede zwischen physikalischer und psychischer Zeit. Es beschreibt die „mentale Konstruktion“ von Zeit nach Pöppel und erläutert, wie die psychische Uhr funktioniert. Zudem werden die Wahrnehmung von Gegenwart und die zeitliche Diskrepanz zwischen Ereignis und Wahrnehmung behandelt. Abschließend wird erläutert, wie das Gehirn zwei Reize als gleichzeitig oder als zeitlich getrennt wahrnimmt.
Zeit erklären
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Modelle und Ansätze zur Erklärung von Zeit. Es beschreibt verschiedene Arten von Vergleichen, die zum Verständnis von Zeit genutzt werden können, darunter räumliche Vergleiche, das „moving time“- und das „moving ego“- Model, Vergleiche mit Bewegungen und Bezeichnungen für Dauer und Wiederholung. Außerdem werden Methoden zum Einordnen von Zeitpunkten und weitere Möglichkeiten der Zeitdarstellung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Zeitwahrnehmung und -erfassung, insbesondere mit der Unterscheidung von physikalischer und psychischer Zeit, der „mentalen Konstruktion“ von Zeit, der Rolle von äußeren Anhaltspunkten, der Wahrnehmung von Gleichzeitigkeit und zeitlicher Abfolge sowie verschiedenen Modellen und Ansätzen zur Erklärung von Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen physikalischer und psychischer Zeit?
Physikalische Zeit ist messbar (Sekunden, Uhren), während psychische Zeit das subjektive Erleben beschreibt, das je nach Situation (Langeweile vs. Spannung) stark variieren kann.
Wie funktioniert die "psychische Uhr" nach Pöppel?
Das Gehirn konstruiert Zeitintervalle. Ereignisse innerhalb von ca. 3 Sekunden werden oft als zusammenhängende "Gegenwart" wahrgenommen, bevor sie in die Vergangenheit übergehen.
Welche kulturellen Unterschiede gibt es in der Zeitdarstellung?
Kulturen nutzen unterschiedliche Metaphern, oft räumlicher Natur (z.B. Zeit als Fluss oder Weg). Auch die Einordnung von Vergangenheit und Zukunft kann räumlich variieren (z.B. Zukunft vor oder hinter dem Körper).
Was versteht man unter dem "moving time"- und "moving ego"-Modell?
Beim "moving time"-Modell bewegt sich die Zeit auf den Betrachter zu. Beim "moving ego"-Modell bewegt sich das Individuum durch die Zeit wie durch einen Raum.
Was beeinflusst unser Zeitempfinden in "Zeiträumen voller Nichts"?
In reizarmen Phasen (Warten) scheint die Zeit langsamer zu vergehen, während sie in Phasen mit vielen neuen Eindrücken im Rückblick oft als länger wahrgenommen wird.
- Quote paper
- Catrin Hoffmann (Author), 2007, Zeitkognition , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148289