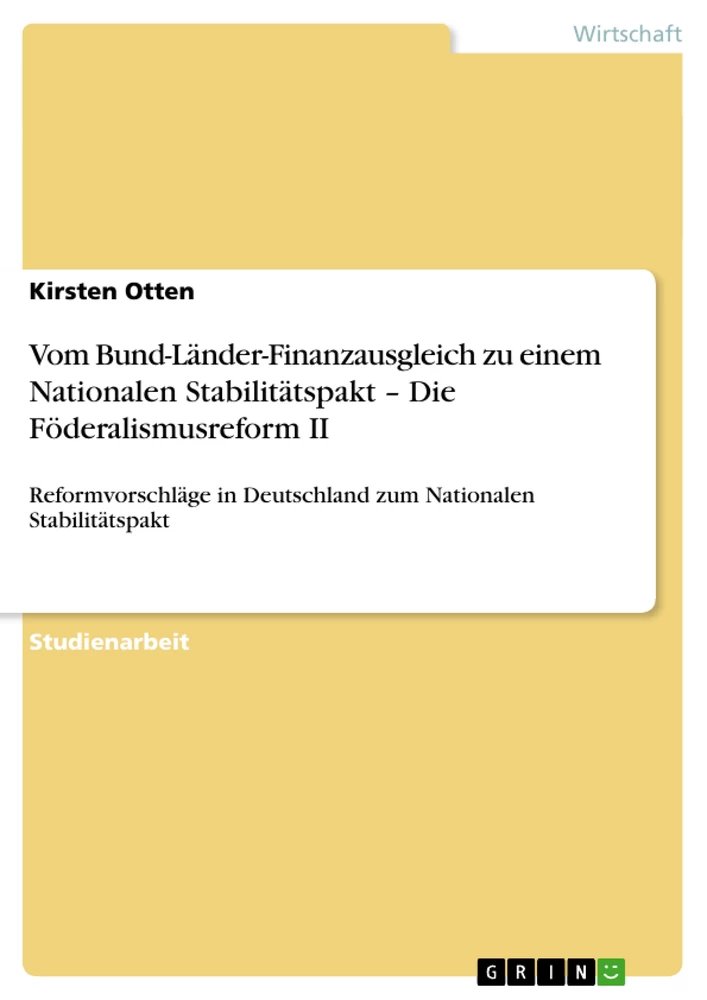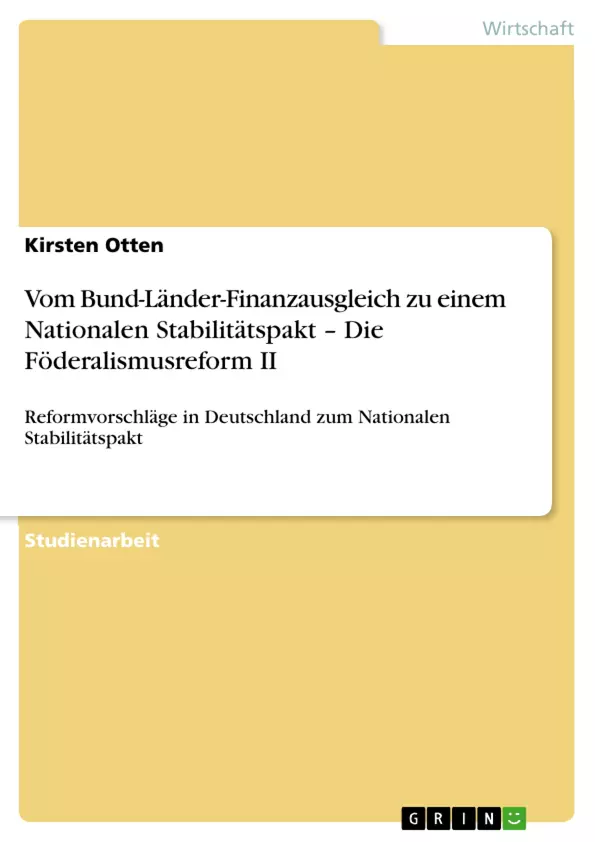Die derzeitig aktuelle Diskussion zur Föderalismusreform II ist das Resultat aus einer im Sommer 2002 durch die Länder eingebrachten Idee, eine Zusammenkunft aller Landesparlamente und der dort vertretenen politischen Parteien einzuberufen. In der so genannten „Lübecker Erklärung“ vom 31.03.2003 wird durch die Parlamente der Länder zum Ausdruck gebracht, am Geschehen einer für notwendig befundenen Föderalismusreform aktiv teilnehmen zu wollen. Die Durchführung sollte nicht allein dem Bund und den Minister-präsidenten der Länder obliegen.
Neben der am 15.10.2003 eingesetzten Kommission von Bundestag und Bundesrat wurden zusätzlich bürgerschaftliche Stiftungen der im Deutschen Bundestag befindlichen Fraktionen in den Sachverhalt mit einbezogen.
Dieser Expertenausschuss besaß den Auftrag, Vorschläge mit dem Ziel zu erarbeiten, die politischen Verantwortlichkeiten neu zu ordnen sowie die Zweckmäßigkeit und Effizienz der Aufgabenerfüllung zu steigern. Es sollten insbesondere die Mitwirkungsrechte der Gliedstaaten an der Gesetzgebung des Bundes sowie die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern kontrolliert und aufbereitet werden. Man befand, dass das signifikante Thema des Finanzausgleiches in einer zweiten Phase gesonderte Betrachtung finden sollte.
Nach erfolglosen Bemühungen der Bundesstaatskommission wurde im Koalitionsvertrag der SPD und CDU Fraktionen nach der Bundestagswahl im Jahr 2005 am 18. November die Föderalismusreform II vereinbart. Diese sollte weitestgehend auf den bisherigen nicht zufrieden stellenden Ergebnissen der Bundesstaatskommission aufbauen und ein effektiveres Unterfangen darstellen. Durch eine Änderung des Grundgesetzes (GG) und die Verabschiedung des Föderalismusreform-Begleitgesetzes wurde in 2006 die rechtliche Basis für die Föderalismusreform II geschaffen.
Bundestag und Bundesrat schlossen daraufhin am 15.12.2006 ein Abkommen zur Gründung einer gemeinsamen Kommission zu Modernisierung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, der besagten Föderalismuskommission II. In der konstituierenden Sitzung der Kommission am 08.03.2007 wurde die Direktive erteilt, einen umfangreichen Themenkatalog in öffentlichen Anhörungen zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalte und Ziele zur Föderalismusreform II
- Der Nationale Stabilitätspakt im Status quo
- Definition Was ist ein Nationaler Stabilitätspakt?
- Gesetzliche Normen
- Artikel 109 Grundgesetz
- Artikel 115 Grundgesetz
- Reformvorschläge zum Nationalen Stabilitätspakt hinsichtlich einer effizienten Schuldenbegrenzung
- Reformvorschläge aus der Politik
- Beitrag des Sachverständigenrates
- Beiträge der Bundesministerien
- Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen
- Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit respektive beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
- Beiträge der Fraktionen
- Reformvorschläge aus Wissenschaft und Forschung
- Plädoyer von Heinz Grossekettler in Relation zu einer nachhaltigen Verstetigungspolitik
- Beitrag von Ingolf Deubel in Anlehnung an sein Exposé „Der Stabilisierungsfond“
- Stellungnahme von Kai A. Konrad, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Freie Universität Berlin
- Reformvorschlag des Bankenverbandes unter Bezugnahme auf die Schuldenbremse
- Reformvorschläge aus der Politik
- Evaluierung der wesentlichen Reformideen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Reformvorschläge zum Nationalen Stabilitätspakt im Kontext der Föderalismusreform II. Sie untersucht die Ziele und Inhalte der Reform sowie die verschiedenen Reformvorschläge aus Politik, Wissenschaft und Praxis.
- Die Bedeutung des Nationalen Stabilitätspakts für die finanzielle Stabilität Deutschlands
- Die Herausforderungen der Schuldenbegrenzung im föderalen System
- Die verschiedenen Perspektiven und Reformvorschläge zur Stärkung des Stabilitätspakts
- Die Rolle der Wissenschaft und der Politik in der Gestaltung des Stabilitätspakts
- Die Auswirkungen der Reformvorschläge auf die deutsche Finanzpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Föderalismusreform II und den Nationalen Stabilitätspakt ein. Kapitel 2 beleuchtet die Inhalte und Ziele der Reform. Kapitel 3 definiert den Nationalen Stabilitätspakt und analysiert dessen gesetzlichen Rahmen. Kapitel 4 präsentiert eine umfassende Analyse der Reformvorschläge aus Politik, Wissenschaft und Praxis. Kapitel 5 evaluiert die wesentlichen Reformideen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Föderalismusreform II, Nationaler Stabilitätspakt, Schuldenbegrenzung, Finanzpolitik, Reformvorschläge, Wissenschaft, Politik, Bundeshaushalt, Stabilität, Wirtschaftspolitik, EU-Stabilitätspakt, Schuldenbremse.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Föderalismusreform II?
Ziel war die Modernisierung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, insbesondere die Einführung einer effektiven Schuldenbegrenzung (Schuldenbremse).
Was versteht man unter einem Nationalen Stabilitätspakt?
Es ist eine Vereinbarung zur Sicherstellung der Haushaltsdisziplin von Bund und Ländern, um die Kriterien des EU-Stabilitätspakts einzuhalten.
Welche Rolle spielen die Artikel 109 und 115 des Grundgesetzes?
Diese Artikel regeln die Haushaltswirtschaft und die Kreditaufnahme von Bund und Ländern und bilden die rechtliche Basis für die Schuldenbremse.
Welche Reformvorschläge kamen aus der Wissenschaft?
Experten wie Heinz Grossekettler oder Kai A. Konrad schlugen Mechanismen zur nachhaltigen Verstetigung der Finanzpolitik und zur Vermeidung übermäßiger Verschuldung vor.
Was war die „Lübecker Erklärung“?
In dieser Erklärung von 2003 forderten die Landesparlamente, aktiv an der Gestaltung der Föderalismusreform beteiligt zu werden.
- Quote paper
- Kirsten Otten (Author), 2008, Vom Bund-Länder-Finanzausgleich zu einem Nationalen Stabilitätspakt – Die Föderalismusreform II, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148318