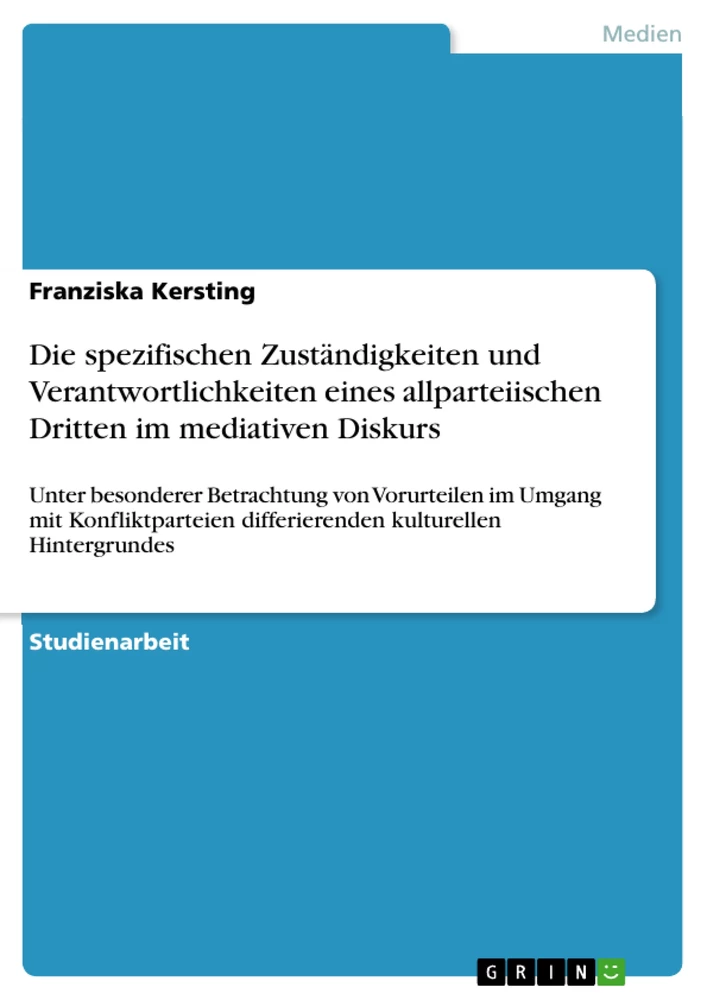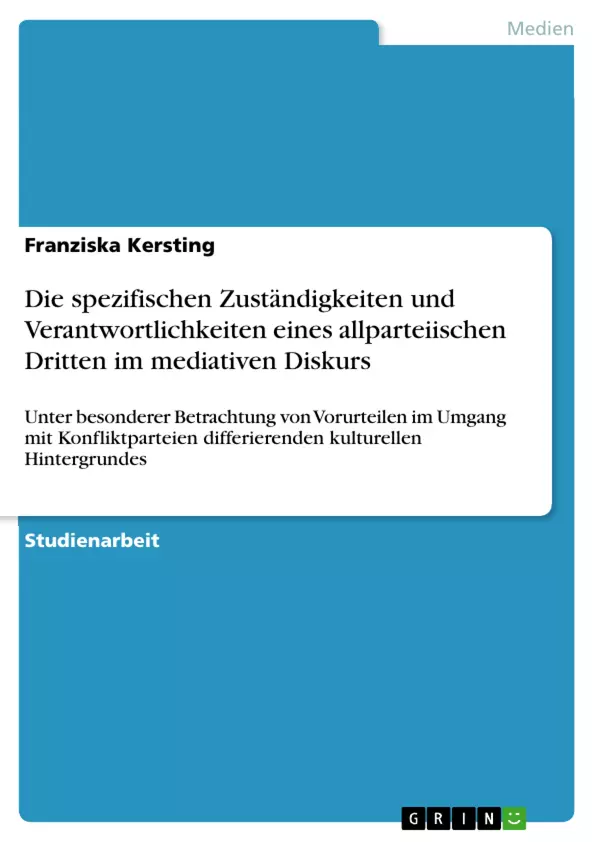Einführende Bemerkungen - Qualitäten eines Mediators im Konfliktlösungsprozess mit Fokus auf die Bedeutung von Vorurteilen
Mediation ist „ein Verfahren zur eigenverantwortlichen Lösung eines Konfliktes durch die Konfliktparteien (..), die von einem neutralen Dritten ohne Entscheidungsbefugnis unterstützt werden“ (Marcard 2004, 9). Schon in der Arbeitsdefinition wird deutlich, dass Mediation sich durch einen Vermittler auszeichnet. Dieser ist demnach maßgeblich für die Konfliktlösung von Nöten.
Für zwei Konfliktparteien ist die Mediation als außergerichtliche Form der Problemlösung meist die Wünschenswertere. Rechtliche Verfahren bergen „schwer kalkulierbare Risiken und nicht zuletzt auch explodierende Kosten“ (Falk/Heintel/Krainz 2005, 9). Die nachfolgende Abbildung bekräftigt diese Aussage: Je nach Streitwert können die Verfahrenskosten eine immense Höhe erreichen.
Die Mediation ist nach Falk/Heintel/Krainz (2005, 9) im „Idealfall (...) freiwillig, konstruktiv und (..) gewaltfrei“. Es geht um selbstbestimmte Problemlösungsfindung. Dies hat eine gesteigerte Identifikation mit den gefundenen Lösungen zur Folge, was sowohl mit einer größeren Akzeptanz der Ergebnisse, als auch mit einer besseren Umsetzung einhergeht (vgl. Falk/Heintel/Krainz 2005). Weitere Ziele der Mediation sind die „Berücksichtigung von Interessenlagen, die in einem Zivilprozess unbeachtet bleiben würden, (die) Reduzierung der Verfahrenskosten und der Konfliktfolgekosten, (die) Möglichkeit eines unbürokratischen und flexiblen Verfahrens, (die) Schonung personeller und betrieblicher Ressourcen, (sowie) keine Öffentlichkeit durch Berichte in den Massenmedien“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Mediation 2009).
Nachdem nun der Begriff Mediation eingegrenzt wurde, soll näher auf den Mediator und seine Rolle als Vermittler eingegangen werden. „Der Mediator ist kein Schlichter, der einen Vergleichsvorschlag macht, und dann alles daran setzt, die Parteien davon zu überzeugen“ (Haft/von Schlieffen 2002, 4). Viel mehr lässt sich sagen, dass ein „mediator attempts to help people negotiate more effectively and efficiently than they could on their own. The mediator helps the disputants to find solutions to their conflict that make more sense to them than continuing with their dispute. The mediator helps them search for common ground and find creative yet realistic ways to resolve their issues” (Stitt 2004, 1).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführende Bemerkungen - Qualitäten eines Mediators im Konfliktlösungsprozess mit Fokus auf die Bedeutung von Vorurteilen
- 2 Wer darf mediieren - Die Aus- und Weiterbildung zum Mediator
- 2.1 Der mediative Spiegel - Kernkompetenzen und das ethische Selbstverständnis
- 2.2 Interkulturelle Mediation - mediative Konfliktlösung zwischen Streitparteien differierenden kulturellen Hintergrundes
- 3 Eine Begriffseingrenzung - Vorurteile als allgegenwärtiges soziales Phänomen
- 3.1 Ursachen von Vorurteilen - Interkulturelle Konflikte bedürfen einem interkulturellen Verständnis
- 3.1.1 Der gesellschaftliche Ursprung - Soziale Ungleichheit als Nährboden für Vorurteile
- 3.1.2 Der kognitive Ursprung - Entstehung von Vorurteilen durch Denken in sozialen Schubladen
- 3.1.3 Andere theoretische Ansätze der Wissenschaft
- 3.2 Worin liegt der Nutzen - Funktionen und Werte von Kategorisierung und damit einhergehender Generalisierung
- 3.3 Stereotype Annahmen - Änderungsresistente, krankhafte Symptome oder korrigierbare, nützliche Produkte?
- 3.1 Ursachen von Vorurteilen - Interkulturelle Konflikte bedürfen einem interkulturellen Verständnis
- 4 Das Vorurteil heute - „Moderner Rassismus“
- 5 Abschließende Gedanken - Ist es Menschen überhaupt möglich vorurteilsfrei zu sein?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die spezifischen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten eines allparteilichen Dritten, insbesondere eines Mediators, im mediativen Diskurs. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Vorurteilen im Umgang mit Konfliktparteien unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes.
- Die Qualitäten und Rolle eines Mediators im Konfliktlösungsprozess
- Die Aus- und Weiterbildung zum Mediator
- Vorurteile als soziales Phänomen: Ursachen und Auswirkungen
- Interkulturelle Mediation und die Bewältigung von Vorurteilen
- Grenzen der Mediation und Möglichkeiten der Konfliktlösung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführende Bemerkungen - Qualitäten eines Mediators im Konfliktlösungsprozess mit Fokus auf die Bedeutung von Vorurteilen: Dieses Kapitel führt in das Thema Mediation ein und definiert den Begriff. Es hebt die Vorteile der Mediation gegenüber gerichtlichen Verfahren hervor, insbesondere die Kostenersparnis und die höhere Akzeptanz der Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der Rolle des Mediators als neutraler, allparteilicher Dritter, der die Konfliktparteien bei der eigenverantwortlichen Lösungsfindung unterstützt. Es werden die vier Grundvoraussetzungen der Mediation – Freiwilligkeit, Verschwiegenheit, Ergebnisoffenheit und Allparteilichkeit – erläutert und die Bedeutung der Allparteilichkeit hervorgehoben. Abschließend werden zwei unterschiedliche Ansätze der Mediation, die Verhandlungsstrategie und die therapeutische Integration, vorgestellt.
2 Wer darf mediieren - Die Aus- und Weiterbildung zum Mediator: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Qualifikation und Ausbildung von Mediatoren. Es werden verschiedene Berufsgruppen genannt, die für die Tätigkeit als Mediator geeignet sind, und die Notwendigkeit einer entsprechenden Aus- und Weiterbildung betont. Das Kapitel verdeutlicht, dass neben fachlichen Kenntnissen auch persönliche Eigenschaften und ethisches Selbstverständnis des Mediators unerlässlich sind für eine erfolgreiche Mediation.
3 Eine Begriffseingrenzung - Vorurteile als allgegenwärtiges soziales Phänomen: Das Kapitel definiert den Begriff „Vorurteil“ und analysiert dessen Ursachen. Es werden gesellschaftliche, kognitive und weitere wissenschaftliche Ansätze zur Entstehung von Vorurteilen diskutiert, wobei der Fokus auf interkulturellen Konflikten liegt. Die Bedeutung von Kategorisierung und Generalisierung im Zusammenhang mit Vorurteilen wird erläutert, und es wird die Frage nach der Funktion und dem Wert von Stereotypen beleuchtet.
4 Das Vorurteil heute - „Moderner Rassismus“: Dieses Kapitel (welches hier aufgrund des fehlenden Textes nicht weiter beschrieben werden kann) befasst sich wahrscheinlich mit aktuellen Ausprägungen von Vorurteilen und Rassismus.
Schlüsselwörter
Mediation, Mediator, Konfliktlösung, Vorurteile, Interkulturelle Kommunikation, Allparteilichkeit, Konfliktmanagement, Aus- und Weiterbildung, soziale Ungleichheit, Stereotype.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Mediation und Vorurteile
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über eine Seminararbeit zum Thema Mediation und Vorurteile. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Rolle von Mediatoren im Umgang mit Konfliktparteien unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds und der Bedeutung von Vorurteilen in diesem Kontext.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel:
- Einführende Bemerkungen – Qualitäten eines Mediators im Konfliktlösungsprozess mit Fokus auf die Bedeutung von Vorurteilen
- Wer darf mediieren – Die Aus- und Weiterbildung zum Mediator
- Eine Begriffseingrenzung – Vorurteile als allgegenwärtiges soziales Phänomen
- Das Vorurteil heute – „Moderner Rassismus“
- Abschließende Gedanken – Ist es Menschen überhaupt möglich vorurteilsfrei zu sein?
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die spezifischen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten eines Mediators im mediativen Diskurs, insbesondere im Umgang mit Vorurteilen bei Konfliktparteien unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds. Die Schwerpunkte liegen auf den Qualitäten und der Rolle eines Mediators, der Aus- und Weiterbildung zum Mediator, Vorurteilen als soziales Phänomen, interkultureller Mediation und der Bewältigung von Vorurteilen sowie den Grenzen der Mediation und Möglichkeiten der Konfliktlösung.
Welche Aspekte der Mediation werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Aspekte der Mediation, darunter die Qualitäten und Rolle eines Mediators, die Aus- und Weiterbildung zum Mediator, die vier Grundvoraussetzungen der Mediation (Freiwilligkeit, Verschwiegenheit, Ergebnisoffenheit und Allparteilichkeit), verschiedene Ansätze der Mediation (Verhandlungsstrategie und therapeutische Integration) und die Grenzen der Mediation.
Wie werden Vorurteile in diesem Dokument behandelt?
Vorurteile werden als allgegenwärtiges soziales Phänomen analysiert. Es werden gesellschaftliche, kognitive und weitere wissenschaftliche Ansätze zur Entstehung von Vorurteilen diskutiert, mit Fokus auf interkulturelle Konflikte. Die Bedeutung von Kategorisierung und Generalisierung im Zusammenhang mit Vorurteilen wird erläutert, und es wird die Frage nach der Funktion und dem Wert von Stereotypen beleuchtet. Das Kapitel „Das Vorurteil heute – Moderner Rassismus“ befasst sich mit aktuellen Ausprägungen von Vorurteilen und Rassismus (jedoch ist der Textinhalt dieses Kapitels im vorliegenden Dokument nicht vollständig vorhanden).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mediation, Mediator, Konfliktlösung, Vorurteile, Interkulturelle Kommunikation, Allparteilichkeit, Konfliktmanagement, Aus- und Weiterbildung, soziale Ungleichheit, Stereotype.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Ja, das Dokument bietet für die Kapitel 1, 2 und 3 detaillierte Zusammenfassungen. Kapitel 4 ist nur kurz angesprochen, da der Text fehlt. Die Zusammenfassungen geben einen Überblick über die behandelten Themen und Ergebnisse jedes Kapitels.
- Citar trabajo
- Franziska Kersting (Autor), 2009, Die spezifischen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten eines allparteiischen Dritten im mediativen Diskurs , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148335