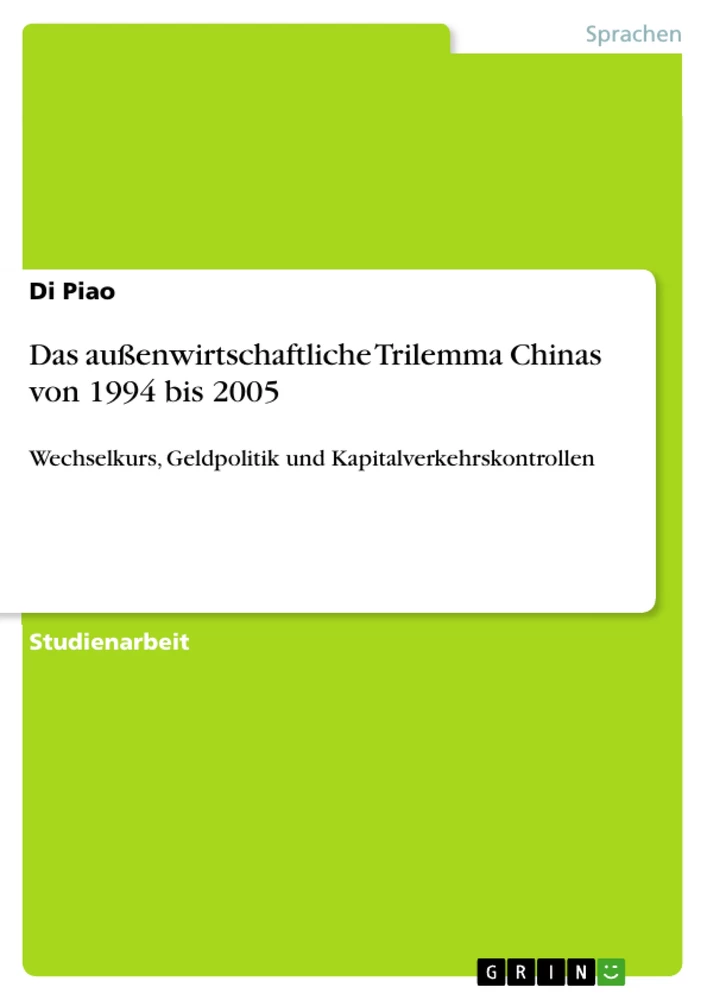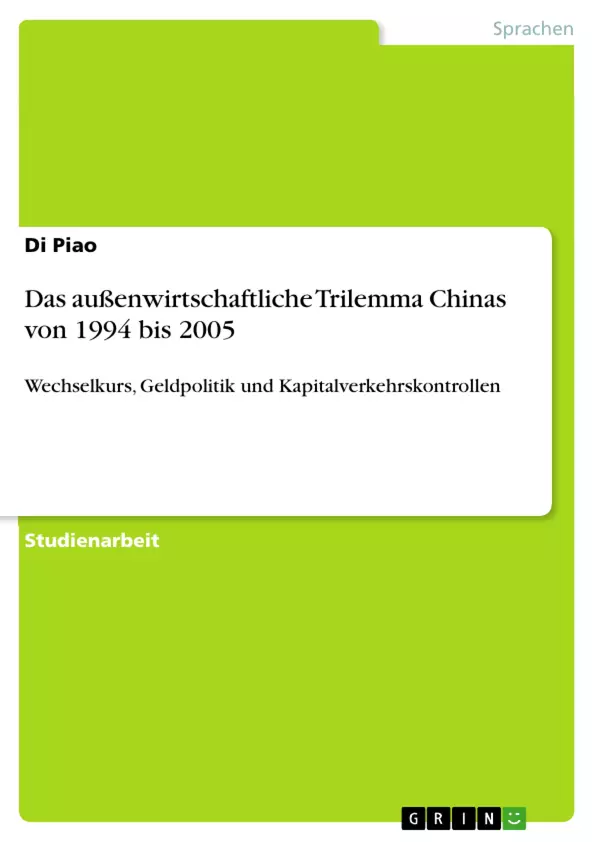Nach Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems im Jahre 1973 begannen in der darauffolgenden Dekade die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt damit, ihre Kapitalverkehrskontrollen abzubauen und ihren Wechselkurs teils ganz, teils bis zu einem gewissen Grad zu flexibilisieren. Parallel dazu erlebten die ostasiatischen Staaten einen rasanten Wirtschaftsaufschwung und steuerten rapide auf einen Platz in den Reihen der Industriestaaten zu. Auch an China ist diese Entwicklung nicht spurlos vorüber gezogen. Das Land etablierte sich zunehmend als Exportriese, nicht zuletzt durch sukzessive Handelsliberalisierungen im Bereich der monetären Außenwirtschaft. Die Zielsetzung lag dabei vorrangig auf hohen Wachstumsraten des Sozialprodukts, sowie einem stabilen graduellen Reformpfad. Bezüglich der Liberalisierung des Kapitalverkehrs schien jedoch die Transformation zu stagnieren. Der Wechselkurs wurde während der Jahrtausendwende nahezu fix an den US-Dollar gebunden und die Kapitalmobilität ist bis zum heutigen Tage noch stark reglementiert. Trotz dieser unter Experten als Rudimente aus einer vergangenen Zeit empfundenen Systeme, gelang es der, an der Bevölkerung gemessen, größten Volkswirtschaft der Welt, konstant hohe Wachstumsraten zu generieren und gleichzeitig auf einem stabilen Reformpfad zu wandern. Mit dem weitestgehend unbeschadeten Überstehen der Asienkrise im Jahr 1997 bestand China eine gewisse Feuerprobe, obwohl einige Bereiche der Ökonomie eine ähnliche Symptomatik entwickelt hatten, wie die der Nachbarstaaten, die in dieser Zeit in eine schwere Rezession fielen.
In dieser Seminararbeit werde ich primär das außenwirtschaftliche Phänomen erklären, inwiefern gerade die allgemein als rückständig geltenden Maßnahmen zu Notwendigkeiten eines stabilen chinesischen Wachstumspfades werden konnten. Das zeitliche Intervall dieser Arbeit beschränkt sich auf die Periode der chinesischen Dollarkopplung zwischen 1994 und 2005, um einen sowohl zeitlich, als auch thematisch klar definierten Rahmen zu stecken, in dem ich eine tiefergehende Analyse vornehmen kann. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie des magischen Dreiecks
- Fixer Wechselkurs und kontrolliertes Floaten
- Bindung an einen Vermögenstitel
- Bindung an einen Währungskorb
- Kontrolliertes Floaten
- Autonome Geldpolitik
- Freier internationaler Kapitalverkehr und Kapitalverkehrskontrollen
- Das Trilemma des magischen Dreiecks
- Fixer Wechselkurs und kontrolliertes Floaten
- China und das magische Dreieck
- Chinas Wechselkurssystem - 1994 bis 2005
- Die Geldpolitik Chinas
- Kapitalverkehrskontrollen Chinas
- Auswertung des magischen Dreiecks
- Beweggründe der anpassungsfähigen Festschreibung in China
- Problematik von Alternativen zur anpassungsfähigen Festschreibung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem außenwirtschaftlichen Phänomen, wie China durch die Anwendung von Maßnahmen, die allgemein als rückständig gelten, ein stabiles Wachstum erzielen konnte. Die Arbeit konzentriert sich auf den Zeitraum der chinesischen Dollarkopplung zwischen 1994 und 2005, um eine tiefgehende Analyse vorzunehmen.
- Das Trilemma des magischen Dreiecks und seine Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik
- Die Rolle des Wechselkurssystems in der chinesischen Wirtschaftsentwicklung
- Die Bedeutung der Geldpolitik und Kapitalverkehrskontrollen für die Stabilität des chinesischen Wirtschaftssystems
- Die Analyse der chinesischen Wirtschaftspolitik im Kontext des magischen Dreiecks
- Die Bewertung der Effektivität der chinesischen Wirtschaftspolitik im Hinblick auf Wachstum und Stabilität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Hintergrund der Arbeit dar, indem sie den Aufstieg Chinas als Exportriese und die Herausforderungen der Liberalisierung des Kapitalverkehrs beleuchtet. Die Arbeit konzentriert sich auf den Zeitraum der chinesischen Dollarkopplung zwischen 1994 und 2005, um die Beziehung zwischen dem magischen Dreieck und dem chinesischen Wachstumspfad zu untersuchen.
- Theorie des magischen Dreiecks: Dieses Kapitel erläutert das Modell des magischen Dreiecks, das die Interaktion von freiem Kapitalverkehr, autonomer Geldpolitik und Wechselkursstabilität beschreibt. Es wird betont, dass eine Volkswirtschaft nur zwei dieser drei Ziele gleichzeitig erreichen kann.
- China und das magische Dreieck: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Merkmale des chinesischen Außenwirtschaftssystems im Zeitraum 1994 bis 2005, einschließlich des Wechselkurssystems, der Geldpolitik und der Kapitalverkehrskontrollen.
- Auswertung des magischen Dreiecks: Dieses Kapitel analysiert die Anwendung des magischen Dreiecks in der chinesischen Wirtschaftspolitik. Es untersucht, wie China die verschiedenen Elemente des Trilemmas manövriert hat, um ein stabiles Wachstum zu erreichen.
- Beweggründe der anpassungsfähigen Festschreibung in China: Dieses Kapitel untersucht die Gründe für die Entscheidung Chinas, den Wechselkurs an den US-Dollar zu binden. Es analysiert die Vorteile und Herausforderungen dieser Politik.
- Problematik von Alternativen zur anpassungsfähigen Festschreibung: Dieses Kapitel diskutiert die möglichen Folgen alternativer Wechselkursstrategien für China und bewertet die Herausforderungen, die mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs verbunden sind.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit dem außenwirtschaftlichen Trilemma Chinas im Zeitraum von 1994 bis 2005. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: magisches Dreieck, Wechselkurspolitik, Geldpolitik, Kapitalverkehrskontrollen, Dollarkopplung, Wirtschaftswachstum, Stabilität, Asienkrise, Mundell-Fleming-Modell, anpassungsfähige Festschreibung, China.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das außenwirtschaftliche Trilemma?
Das Trilemma (oder magische Dreieck) besagt, dass ein Land nicht gleichzeitig feste Wechselkurse, freie Kapitalbewegung und eine autonome Geldpolitik haben kann. Man muss sich für zwei Ziele entscheiden.
Warum band China den Yuan zwischen 1994 und 2005 an den US-Dollar?
Die Dollarkopplung sollte für Stabilität im Außenhandel sorgen, Exporte fördern und das Vertrauen ausländischer Investoren stärken.
Wie konnte China trotz Kapitalverkehrskontrollen stark wachsen?
Die Kontrollen schützten China vor spekulativen Kapitalflüssen und ermöglichten eine stabile inländische Wirtschaftsentwicklung, was sich besonders während der Asienkrise 1997 als Vorteil erwies.
Was versteht man unter „kontrolliertem Floaten“?
Es ist ein Wechselkurssystem, bei dem der Kurs zwar grundsätzlich durch den Markt bestimmt wird, die Zentralbank aber interveniert, um zu starke Schwankungen zu verhindern.
Welche Rolle spielte die Asienkrise 1997 für Chinas Wirtschaftspolitik?
Die Krise bestätigte Chinas Kurs der langsamen Liberalisierung und der Beibehaltung von Kontrollen, da Nachbarstaaten mit offeneren Kapitalmärkten schwere Rezessionen erlitten.
- Quote paper
- Di Piao (Author), 2009, Das außenwirtschaftliche Trilemma Chinas von 1994 bis 2005, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148347