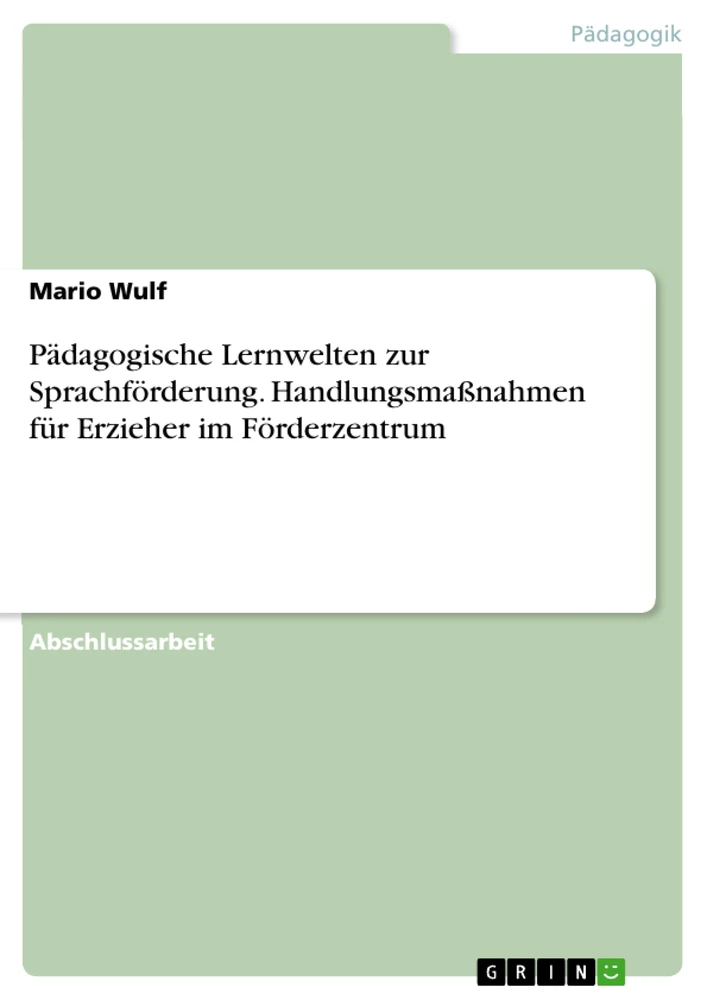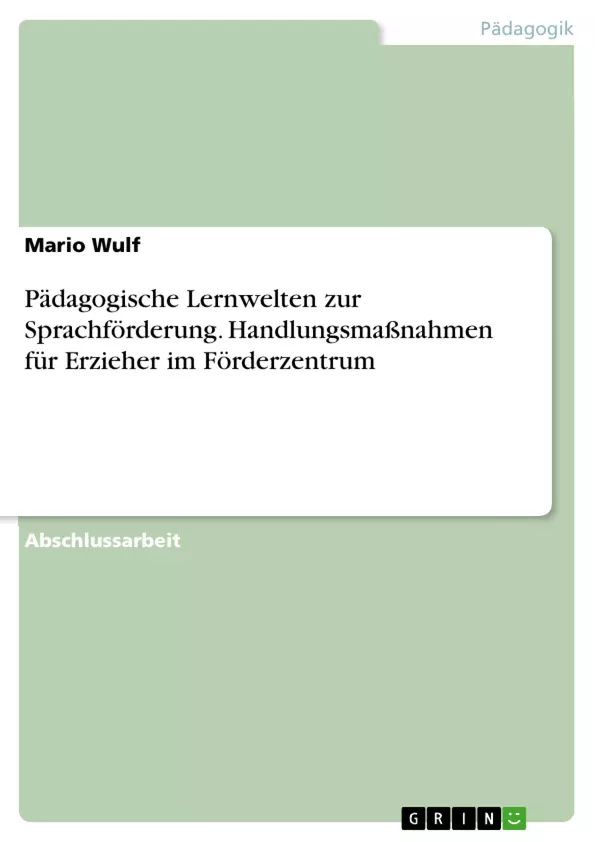Diese Facharbeit untersucht, wie Erzieher:innen in Förderzentren durch pädagogisch gestaltete Lernwelten zur Sprachförderung von Kindern beitragen können. Ziel ist es, pädagogisch geeignete Antworten zu erarbeiten und konkrete Handlungsmaßnahmen für die eigene Berufspraxis als Erzieher:innen zu entwickeln. Die Arbeit gliedert sich in mehrere Themenbereiche: Zunächst werden die symptomatischen Merkmale von Sprachstörungen sowie die theoretischen Grundlagen ihrer Entstehung erläutert. Anschließend werden Sprachstörungen am Beispiel des Förderzentrums dargestellt. Eine Gegenüberstellung der theoretischen Grundlagen und subjektiven Theorien zur Sprachstörungsentstehung bildet die Basis für die Betrachtung grundlegender Methoden der Sprachförderung. Darauf aufbauend werden spezifische pädagogische Angebote zur Sprachförderung vorgestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Sprachförderung im Peter-Jordan-Förderzentrum. Schließlich werden aus den Erkenntnissen konkrete Handlungsmaßnahmen für die berufliche Praxis abgeleitet. Diese Facharbeit soll Erzieher:innen im Förderzentrum praxisnahe Ansätze und Maßnahmen zur effektiven Sprachförderung von Kindern bieten.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 0.1 Ziel der Facharbeit
- 0.1.1 Aufbau und Methode der Arbeit
- 1 Begriffliche Bestimmungen
- 1.1 Kindliche Sprachstörung
- 1.2 Sprachförderung
- 2 Symptomatische Merkmale von Sprachstörungen
- 3 Theoretische Grundlagen zur Entstehung von Sprachstörungen
- 3.1 Gedächtnisfunktion und Informationsverarbeitung
- 3.2 Familiäre Bedingungen
- 3.2.1 Beruflich überlastete Eltern: Fernsehen statt Eltern-Kind-Gespräche
- 3.2.2 Instabile Familienstrukturen
- 4 Sprachstörungen am Beispiel des Peter-Jordan-Förderzentrums
- 4.1 Soziales Umfeld
- 4.2 Erscheinungsformen der Sprachstörungen
- 4.3 Subjektive Theorien zur Sprachstörungsentstehung der Schüler/innen
- 5 Gegenüberstellung der theoretischen Grundlagen und subjektiven Theorien zur Sprachstörungsentstehung
- 6 Grundlegende Methoden zur Sprachförderung in einem Förderzentrum
- 6.1 Erzieher/innen als Sprachvorbild
- 6.2 Erzieher/innen wecken Sprechfreude
- 7 Pädagogische Angebote zur Sprachförderung
- 7.1 Spiele zur Erweiterung des Wortschatzes
- 7.1.1 Reimspiele
- 7.1.2 Rollenspiele
- 7.2 Spiele zur Unterstützung der Grammatik
- 7.2.1 Memory-Spiele
- 7.2.2 Pantomime-Spiele
- 8 Sprachförderung im Peter-Jordan-Förderzentrum
- 8.1 Darstellung praktizierter Sprachförderung durch die pädagogischen Fachkräfte
- 8.2 Kooperation mit Lehrern/innen
- 8.3 Fachliche Bewertung
- 9 Abgeleitete Handlungsmaßnahmen / Schlussfolgerungen
- 9.1 Ich nutze Gesprächsanlässe als Sprachvorbild
- 9.2 Ich organisiere Sprechkreise
- 9.3 Ich initiiere pädagogische Angebote zum kreativen Schreiben
- 9.4 Ich kooperiere mit Lehrern/innen
- 10 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Sprachförderung von Kindern im Freizeitbereich eines Förderzentrums. Das Hauptziel ist es, pädagogisch geeignete Ansätze zur Sprachförderung zu erarbeiten und diese in die eigene Berufspraxis als Erzieher in einem Förderzentrum zu integrieren. Die Arbeit analysiert die Entstehung von Sprachstörungen, beleuchtet verschiedene Methoden der Sprachförderung und bewertet deren Effektivität.
- Begriffliche Abgrenzung von Sprachstörung und Sprachförderung
- Theorie und Praxis zur Entstehung von Sprachstörungen
- Praktische Ansätze zur Sprachförderung im Freizeitbereich
- Evaluation von Sprachförderungsprogrammen in einem Förderzentrum
- Ableitung konkreter Handlungsmaßnahmen für die eigene Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition der Begriffe "kindliche Sprachstörung" und "Sprachförderung". Im Anschluss werden typische Symptome von Sprachstörungen erläutert und verschiedene theoretische Grundlagen zur Entstehung von Sprachstörungen vorgestellt, die sich auf Gedächtnisfunktionen, familiäre Bedingungen und soziale Faktoren beziehen. Die Arbeit analysiert anschließend das soziale Umfeld des Peter-Jordan-Förderzentrums und stellt die dort beobachteten Sprachstörungen sowie die subjektiven Theorien der Erzieher/innen zur Sprachstörungsentstehung vor.
Daraufhin werden grundlegende Methoden zur Sprachförderung im Förderzentrum, wie z.B. die Rolle der Erzieher/innen als Sprachvorbild und die Förderung der Sprechfreude, vorgestellt. Es werden verschiedene pädagogische Angebote zur Sprachförderung beschrieben, darunter Spiele zur Erweiterung des Wortschatzes und zur Unterstützung der Grammatik.
Die Arbeit beleuchtet anschließend die praktische Umsetzung der Sprachförderung im Peter-Jordan-Förderzentrum, einschließlich der Darstellung der konkreten Methoden der Erzieher/innen, der Kooperation mit Lehrern/innen und einer fachlichen Bewertung. Ausgehend von diesen Praxiserfahrungen werden konkrete Handlungsmaßnahmen für die eigene Berufspraxis als Erzieher/in abgeleitet, die sich auf die Nutzung von Gesprächsanlässen als Sprachvorbild, die Organisation von Sprechkreisen, die Initiierung von Angeboten zum kreativen Schreiben und die Kooperation mit Lehrern/innen beziehen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Facharbeit sind: Sprachförderung, kindliche Sprachstörung, Förderzentrum, pädagogische Ansätze, Sprachvorbild, Sprechfreude, Wortschatzerweiterung, Grammatik, Kooperation mit Lehrern/innen, Handlungsmaßnahmen.
- Citation du texte
- Mario Wulf (Auteur), 2012, Pädagogische Lernwelten zur Sprachförderung. Handlungsmaßnahmen für Erzieher im Förderzentrum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1483623