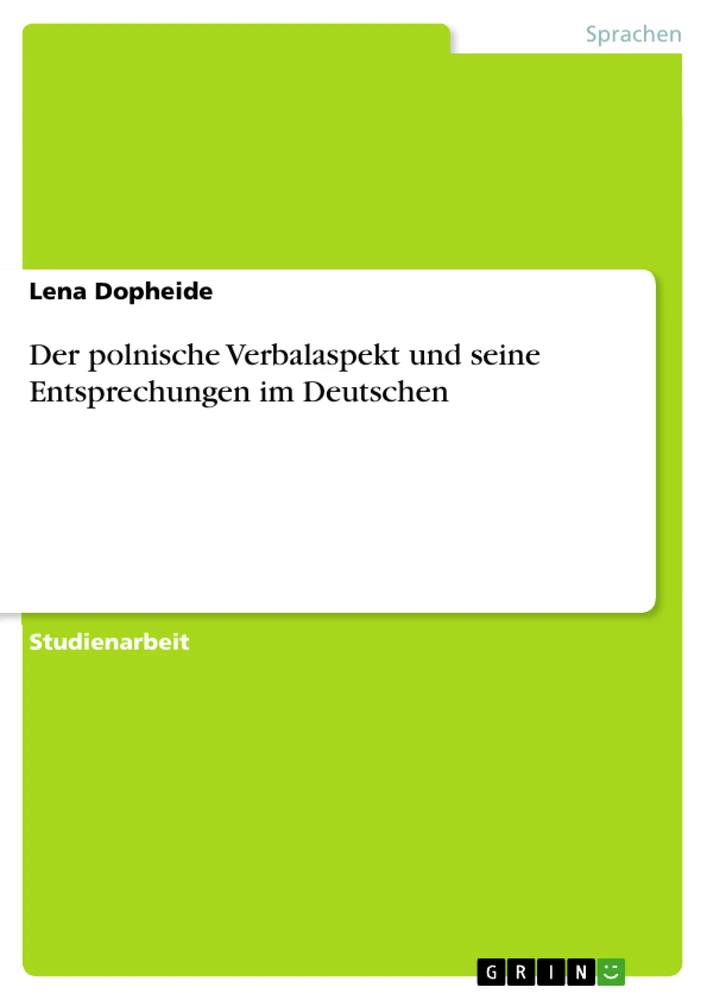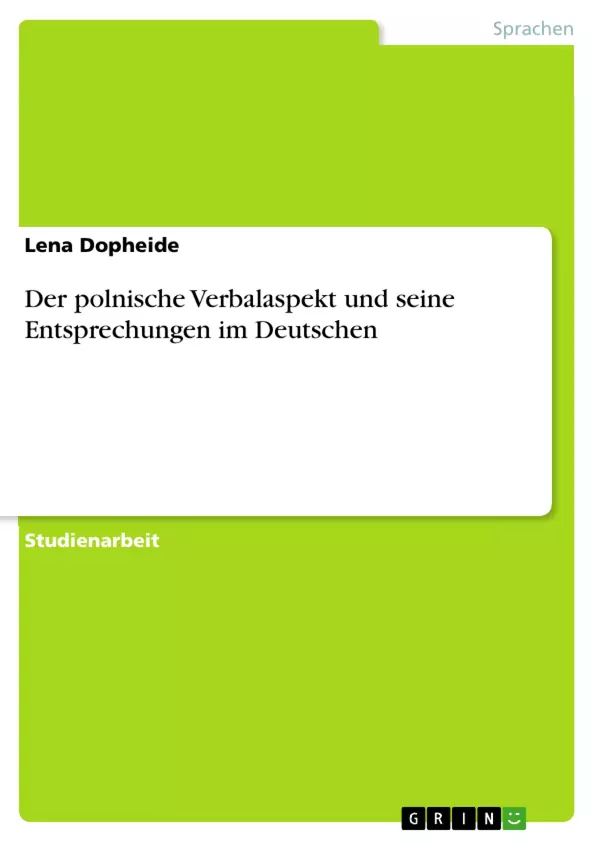Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem sprachlichen (grammatischen) Phänomen, das in einigen Sprachen formal ausgebildet ist, in anderen wiederum nicht. Der Verbalaspekt ist eine in allen slawischen Sprachen beobachtbare grammatische Erscheinung. Diese Sprachen werden auch als Aspektsprachen bezeichnet. Das Deutsche, das diese grammatische Erscheinung nicht hat, ist demnach eine Nichtaspektsprache.
In dieser Arbeit wird die Frage behandelt, ob das, was mithilfe dieses Phänomens, des Verbalaspekts, im Polnischen ausgedrückt wird, im Deutschen eine Entsprechung hat.
Insgesamt ist das Ziel der Arbeit, den polnischen Verbalaspekt als grammatische Kategorie in seiner Komplexität möglichst genau zu beschreiben und Ansätze des polnisch- deutschen Sprachvergleichs im Bereich der Aspektualität sowie die Schwierigkeiten der Ein- und Abgrenzung der Termini darzustellen.
Inhalt
Einleitung...3
I. Der polnische Verbalaspekt...4
1. Aspekt und Aspektualität...4
2. Aspektualität im Polnischen...5
2.1 Lexikalische Ebene...6
2.2 Morphologische Ebene...8
2.2.1 (Morphologische) Kombinatorik: Aspekt, Tempus...9
2.3 Syntaktische Ebene...11
II. Ausdrucksformen für den Verbalaspekt im Deutschen...12
1. Aspekt und Aktionsart...12
2. Aspektualität...14
3. Deutsche Tempora und Aspektualität: Die Perfekthypothese...15
Zusammenfassung...18
Literaturverzeichnis...22
Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem sprachlichen (grammatischen) Phänomen, das in einigen Sprachen formal ausgebildet ist, in anderen wiederum nicht. Der Verbalaspekt ist eine in allen slawischen Sprachen beobachtbare grammatische Erscheinung. Diese Sprachen werden auch als Aspektsprachen bezeichnet. Das deutsche, das diese grammatische Erscheinung nicht hat, ist demnach eine Nichtaspektsprache. In dieser Arbeit wird die Frage behandelt, ob das, was mithilfe dieses Phänomens, des Verbalaspekts, im Polnischen ausgedrückt wird, im Deutschen eine Entsprechung hat. Es soll also ein bilateraler Vergleich stattfinden zwischen einer Aspekt- und einer Nichtaspektsprache. Dazu muss zunächst festgestellt werden, welche Bedeutungen der Aspekt im Polnischen überhaupt transportiert, wie man ihn beschreiben kann. Mit diesem Thema beschäftigt sich das folgende erste Kapitel der Arbeit. Es beinhaltet terminologische Klärungen sowie eine formale und funktionale Beschreibung des polnischen Aspekts, die hauptsächlich auf der Grammatik des Polnischen von Bartnicka et. al. beruht.
Im zweiten Kapitel soll es darum gehen, wie die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Funktionen (Bedeutungen) im Deutschen ausgedrückt werden können. Terminologische Schwierigkeiten, die durch unterschiedliche Verwendung und unklare Unterscheidungen der relevanten Termini (Aspekt, Aktionsart, Aspektualität) in der Forschung entstehen, spielen eine Rolle und verdeutlichen auch die Uneinigkeit der Linguisten in Bezug auf das Vorhandensein von aspektähnlichen Phänomenen im Deutschen. Eine Hypothese wird in diesem Kapitel herausgegriffen, sie befasst sich mit dem Tempussystem, insbesondere dem deutschen Perfekt, und seiner aspektualen Komponente. Dabei stützt sich die Arbeit auf ältere und neuere germanistische Theorien und Untersuchungen.
Insgesamt ist das Ziel der Arbeit, den polnischen Verbalaspekt als grammatische Kategorie in seiner Komplexität möglichst genau zu beschreiben und Ansätze des polnisch- deutschen Sprachvergleichs im Bereich der Aspektualität sowie die Schwierigkeiten der Ein- und Abgrenzung der Termini darzustellen.
I. Der polnische Verbalaspekt
1. Aspekt und Aspektualität
Der Aspekt kann als eine morphologische Kategorie des Verbs angesehen werden. Die Grammatik des Polnischen von Bartnicka et. al. definiert Kategorien als morphologisch, wenn es sich um „oppositive grammatische Funktionskategorien von Wortfomen, die aufgrund einer allgemeinen Regel für beliebige Wörter einer Wortart vorausgesagt werden können“ handelt. [1] Es kann für ein beliebiges Verb vorausgesagt werden, dass es einem Aspekt angehört. In der weiteren Systematisierung der morphologischen Kategorien wird der Aspekt als derivationale Kategorie identifiziert, da die im lexikalischen Stamm des Verbs implizierte Subkategorie der grammatischen Kategorie durch ein grammatisches Morphem geändert werden kann. Bei derivationalen Kategorien ist der Träger der grammatischen Bedeutung der Stamm und/oder das Affix, grammatische Oppositionen werden durch Hinzufügen eines Affix markiert. So definiert, bezieht sich der Aspekt auf bestimmte formale Paradigmen auf morphologischer Ebene. [2]
Den Begriff Aspektualität verwenden Bartnicka et. al. dagegen, um die Funktionen des Aspekts zu beschreiben, die sich über alle Beschreibungsebenen erstrecken, d.h. von Umgebungsfaktoren wie z. B. Tempusmorphemen und vom Kontext abhängig sind. Die morphologische Ebene reicht nicht aus, hier können die formale Beschreibung des Aspekts stattfinden und kontextunabhängige Funktionsangaben (Defaults) gemacht werden.
In die Aspektforschung als eine sprachliche Kategorie eingeführt wurde der Begriff von dem russischen Slawisten A.V. Bondarko. Sie soll die Bestimmung der Wechselwirkung zwischen den Mitteln zum Ausdruck des Handlungsverlaufs, zu denen auch der grammatische Aspekt und die Aktionsarten zählen, ermöglichen. [3] Dabei bezeichnet Bondarko die Aspektualität (aspektual'nost') als eine funktional-semantische Kategorie, in deren Kernbereich zumindest in slawischen Sprachen der Verbalaspekt steht, in der Peripherie befinden sich andere Mittel des Satzes, um aspektuale Bedeutungen auszudrücken (v.a. lexikalische). Der Begriff wurde in die Aspektforschung in unterschiedlichen Definitionen aufgenommen und verarbeitet. [4]
Auch in der Grammatik des Polnischen ist Aspektualität eine funktional-semantische Kategorie. Solche werden dort definiert als
„Mengen von sprachlichen Form-Funktions-Einheiten aus den Inventaren verschiedener Ebenen und Paradigmen […], deren Bedeutungen ein und derselben semantischen oder pragmatischen Kategorie angehören.“ [5]
Die Struktur wird auch hier beschrieben als ein Zentrum, in dem sich zumeist eine morphologische Kategorie befindet, mit einer oder mehreren Peripherien. Im Falle der Aspektualität ist also im Polnischen das Zentrum die morphologische Kategorie des Aspekts, in der Peripherie befinden sich z. B. die sogenannten Phasenverben (wie zaczynać und kończyć) und auch Adverbien, die den Handlungsverlauf zeitlich charakterisieren, wie z. B. zawsze, nagle.
Die funktional-semantische Kategorie Aspektualität umfasst nach Bartnicka et. al. die Subkategorien Aktionalität (semantisch) und temporale Definitheit (pragmatisch)[6]. Diese Kategorien sind funktional und damit ebenenübergreifend.
2. Aspektualität im Polnischen
Die folgende formale und funktionale Beschreibung des polnischen Aspekts geht von den oben genannten Grundannahmen aus. Die Kategorien Aktionalität und temporale Definitheit sind, wie erwähnt, als ebenenübergreifend zu verstehen und haben auf den einzelnen Ebenen unterschiedliche Ausprägungen und Zusammenhänge.
2.1. Lexikalische Ebene
Ein Verballexem, ein Verb in einer bestimmten Bedeutung mit seinem/seinen Aspektpartnern[7], hat eine lexikalische Bedeutung. Als lexikalische aktionale Funktion werden diejenigen Komponenten der lexikalischen Bedeutung bezeichnet, die Funktionen der aktionalen Gestalt sind. Die aktionale Gestalt bezeichnet die Phasenstruktur der aktionalen Situation. Als aktionale Situationen werden hier nach Bartnicka et. al. „Sachverhalte, denen die Bedeutungen von Verb-Vokabeln entsprechen“ bezeichnet. [8] Die Kategorie der aktionalen Gestalt enthält drei Subkategorien:
Ereignis: Die aktionale Situation hat nur eine Phase zwischen Vor- und Nach- stadium.
Verlauf: Die aktionale Situation ist eine Abfolge mehrerer Phasen zwischen Vor- und Nachstadium.
Stative Situation: Die aktionale Situation hat keine Phasen.
Eine Subkategorie der Lexikalischen Aktionalen Funktion ist die Telizität, auch Grenzbezug. Hat ein Verb eine telische lexikalische Bedeutung, so hat die von diesem Verb bezeichnete Situation eine „innere Grenze“[9], eine Verlängerung der Situation um weitere Phasen ist nicht möglich, da dann eine andere, nicht mehr von diesem Verb bezeichnete Situation beschrieben würde. Das ist z. B. der Fall bei usiąść,'sich hinsetzen' (telisch). Es gibt hier eine in der Sache liegende Grenze. Eine Fortführung der Situation würde mit einem anderen Verb- siedzie ć, 'sitzen'- bezeichnet. [10] Impliziert die lexikalische Bedeutung eine solche innere Grenze nicht, handelt es sich um ein atelisches Lexem. Es kann auch sein, dass sich die Telizität bzw. Atelizität erst auf anderer Ebene, z. B. der syntaktischen, ergibt. Solche Lexeme sind aktional diffus.
Eine weitere aktionale Unterkategorie ist die des Zustandswechsels. Ereignisse und Verläufe können einen beobachtbaren Zustandswechsel beinhalten. Das ist dann der Fall, wenn das Nachstadium der Situation sich vom Vorstadium unterscheidet, so z. B. bei zamknąć(Ereignis) und powiększyć(Verlauf). Stative Situationen zeichnen sich eben durch Phasenlosigkeit aus und können deshalb keinen Zustandswechsel beinhalten, z. B. znaczyć.
Die aktionale Dauer hat die Ausprägungen punktuell/durativ, wobei als punktuell Ereignisse angesehen werden, die als ganzes in ein Wahrnehmungsintervall (ca. 3 Sek.) fallen. Ereignisse können also auch durativ sein, Verläufe sind es immer. [11] Die aktionale Dauer kann durch die lexikalische Bedeutung gegeben sein, sich aber auch erst im Kontext präzisieren, vgl. p ękać 'platzen' und przeczytać słowo/książkę.
Die aktionale Häufigkeit hat die Ausprägungen einmalig/mehrmalig, dabei geht es um die Häufigkeit von zählbaren Situationen. Hier gibt es eine enge Korrelation mit der temporalen Definitheit:
Die temporale Definitheit, auch Episodizität, bezieht sich auf die Außenumgebung der Situation. Episodisch ist eine aktionale Situation dann, wenn sie im Diskursuniversum zeitlich lokalisierbar ist. Sie kann also relational mit anderen Situationen in Verbindung gebracht werden. In Relation zur Sprechsituation handelt es sich um deiktische Lokalisierung, zu anderen aktionalen Situationen um taxische Lokalisierung. Ist eine Situation nicht lokalisierbar, wird sie als nicht-episodisch bezeichnet. Episodische Situationen sind per Default einmalig[12]. Auf der lexikalischen Ebene ergeben sich folgende mögliche Defaults:
Die Tabelle ist nicht Teil der Leseprobe.
Die lexikalisch implizierten Funktionen (Defaults) können auf den anderen Ebenen verändert oder beibehalten werden, nicht in den lexikalischen Bedeutungen enthaltene Funktionen präzisiert werden.
2.2 Morphologische Ebene
Der Verbalaspekt hat die Ausprägungen perfektiver Aspekt und imperfektiver Aspekt. Prinzipiell ist jedes Verb einem der Aspekte zuzuordnen.
Durch grammatische Derivation werden Aspektpartner gebildet. Verben ohne grammatisches Aspektaffix, aspektuell unmarkierte Verben, die aufgrund ihres lexikalischen Stamms einem der Aspekte zu geordnet werden, bilden aspektuell markierten Derivate durch Hinzufügen eines solchen Affix. Derivierte Aspektpartner sind lexikalisch also gleichbedeutend mit dem ursprünglichen Verb, jedoch funktional verändert, weil zugehörig zum jeweils anderen Aspekt.
Formal gibt es auf morphologischer Ebene die Derivation durch Suffigierung und durch Präfigierung. Bei der Suffigierung wird zum lexikalischen Stamm des Verbs ein grammatisches Suffix hinzugefügt bzw. ersetzt ein anderes. [13] Das betrifft hauptsächlich unmarkierte perfektive Verben, die so imperfektiviert werden. Die Präfigierung findet meist zur Perfektivierung von Verben mit imperfektivem lexikalischem Stamm statt. Dabei wird ein grammatisches Präfix angefügt. Das Hinzufügen des Präfix darf also nicht die lexikalische, sondern nur die aspektuelle Bedeutung des Verbs verändern. Mit welchen präfigierten Verben manche Verben Aspektpartner bilden und welche als bedeutungsmodifizierte neue Verb-Vokabeln gelten, ist umstritten.
Nicht immer werden Aspektpartner morphologisch gebildet. Es gibt zweiaspektige Verben, die je nach Kontext beide Aspektfunktionen erfüllen können, z. B. kazać'anweisen', amputować'amputieren'. Daneben gibt es Perfektiva und Imperfektiva tantum, die keine Aspektpartner haben. Manche Verben können erst auf syntaktischer Ebene, in einem für beide Verben gleichen Kontext, als Aspektpartner identifiziert werden, z. B.
„Bawi ł tu jedną godzinę.”
„Przebawił tu jedną godzinę.” [14]
Daneben gibt es noch die suppletiven Aspektpartner, die unterschiedliche lexikalische Stämme haben, die Bildung der Aspektpartner geschieht hier also auf lexikalischer Ebene.
Die morphogischen Funktionen sind per Default für den perfektiven Aspekt 'episodisches Ereignis', für den imperfektiven Aspekt, von der lexikalischen Ebene vererbt, 'Lexikalische Aktionale Funktion'. Bei der Imperfektivierung eines perfektiven Verbs bleibt also nur die lexikalische Bedeutung übrig. z. B. verliert zamknąć,pf., die Funktion Episodizität und behält nur die lexikalische Bedeutung Ereignis, wenn das ipf. Derivat zamykaćgebildet wird. Andererseits wird das ipf. Verb separowaćmit der Lexikalischen Aktionalen Funktion Ereignis durch die Perfektivierungodseparowaćin Bezug auf die temporale Definitheit präzisiert und wird zum episodischen Ereignis.
2.2.1. (Morphologische) Kombinatorik: Aspekt, Tempus
Die Kategorien Aspekt, Tempus (und Genus verbi) stehen bereits auf morphogischer Ebene in enger Beziehung. Weitere Zusammenhänge ergeben sich auf syntaktischer und textueller Ebene. Die Kombination des Aspekts mit dem morphologischen Präsens-Paradigma der Tempuskategorie ergibt zunächst folgende Defaults:
ipf. Aspekt + Präsens-Paradigma: Präsens-Bedeutung
pf. Aspekt + Präsens-Paradigma: Futur-Bedeutung
Die Aspektopposition besteht im Polnischen also nicht im Präsens (aktiv)[15].
Im Zusammenhang mit dem Tempus ergibt sich die zeitliche Lokalisierung der aktionalen Situationen: Wie bereits weiter oben erwähnt, kann eine Situation deiktisch oder taxisch lokalisiert werden. Zusätzlich gibt es die Lokalisierung zum „psychischen Jetzt“[16], eine subjektive Lokalisierung. Es handelt sich um die Betrachtzeit, in der ein Leser oder Hörer die erzählte Situation aufnimmt und verarbeitet. Sie spielt eine Rolle bei den narrativen Tempusfunktionen. Immer geht es um die Vor-, Nach- oder Gleichzeitigkeit der zu lokalisierenden aktionalen Situation relativ zur lokalisierenden Situation. Für das imperfektive Präsens gilt dementsprechend, dass die vom Verb bezeichnete aktionale Situation zeitlich gleichzeitig zur Sprechzeit lokalisiert ist. Für das perfektive oder imperfektive (analytische) Futur gilt, dass die Situation nachzeitig (zur Sprechzeit) lokalisiert ist, im Präteritum ist sie vorzeitig lokalisiert. Wenn die Relation zur Sprechzeit dominant ist, wird von deiktischer Tempusfunktion. gesprochen. Davon unterscheiden sich relative und narrative Tempusfunktionen.
Wenn eine aktionale Situation relativ zu einer anderen aktionalen Situation lokalisiert wird, die mit einem Sprechaktverb bezeichnet wird (z. B. powiedzie ć, myśleć),wird von der relativen Tempusfunktion gesprochen.
Die narrative Tempusfunktion bezieht sich wie oben erwähnt auf die Lokalisierung zur Betrachtzeit, d.h. die Situation wird subjektiv gleichzeitig lokalisiert. Das narrative Präsens, verwendet z. B. bei Direktreportagen, hat vorwiegend den imperfektiven Aspekt, das narrative Präteritum beide Aspekte. Es wird z:B. in Romanen verwendet.
Im narrativen Präteritum kommt eine Funktion des Aspekts zum Einsatz, den Bartnicka et. al. als „aktionale Chronologie“ bezeichnen. [17] Innerhalb der narrativen Lokalisierung bildet sie eine Struktur, mit der die zeitliche Abfolge in narrativen Passagen beschrieben wird. Sie tritt nur beit episodischen Situationen auf, also mit den aktionalen Gestalten Ereignis und Verlauf. Dabei gibt es folgende Kombinationen als Defaults:
pf. Verb + pf. Verb: Postawiła wiadra na ziemi i odgarn ęła kosmyk z czoła.
Die Situationen werden als Sequenz verstanden, als nacheinander (nach Abschluss des einen Vorgangs) stattfindend.
ipf. Verb + ipf. Verb: Prała białą bieliznę w Czarnej. Z zimna drętwiały jej ręce.
Die Situationen werden als gleichzeitig wahrgenommen (Parallelismus).
pf. Verb + ipf. Verb oder ipf. Verb + pf. Verb: Z zimna drętwiały jej ręce. Podniosła je wysoko do słońca.
Ein Ereignis tritt vor einem Hintergrund ein (Inzidenz).
2.3. Syntaktische Ebene
Per Default wird die morphologische Funktion des perfektiven Aspekts „episodisches Ereignis“ auf die syntaktische Ebene vererbt und entspricht dort der konkret-faktischen Satzfunktion. Alle anderen Situationen werden mit dem imperfektiven Aspekt und allen anderen kanonischen Satzfunktionen ausgedrückt. Für die aspektuale Bedeutung des Satzes, die sich aus der Kombination von Funktionen des Aspekts, der temporalen Definitheit, der aktionalen Häufigkeit und der chronologischen Relationen ergibt, verwenden Bartnicka et. al. den Begriff der kanonischen und nichtkanonischen Satzfunktionen. [18] Kanonisch sind sie dann, wenn der Kontext die Defaults nicht aufhebt. Dabei werden folgende kanonische Satzfunktionen angesetzt:
Die Tabelle ist nicht in der Leseprobe enthalten.
Tab. nach Bartnicka et. al. (2004), S. 400.
Wenn die Satzfunktionen oder Komponenten daraus dem gegensätzlichen Aspekt zugeordnet werden, handelt es sich um nichtkanonische Satzfunktionen. So kann z. B. die Default-Einstellung „einmalig“ für den perfektiven Aspekt im Satzkontext geändert werden, dann handelt es sich um eine summarische Satzfunktion (summarisches episodisches Ereignis):
Kilkakrotnie się obrócił.'Er drehte sich mehrmals um.' [19]
Die konkret-faktische Funktion kann auch mit dem imperfektiven Aspekt auftreten, wenn das historische Präsens angewandt werden kann. Bartnicka et. al. geben dazu das folgende Beispiel:
Postawiła wiadra na ziemi i odgarnęła kosmyk z czoła.
Stawia wiadra na ziemi i odgarnia kosmyk z coła.[20]
Da im Präsens keine Aspektopposition vorhanden ist, wird der imperfektive Aspektpartner verwendet, hat in diesem Fall aber ebenfalls die konkret-faktische Funktion (episodisches Ereignis).
II. Ausdrucksformen für den Verbalaspekt im Deutschen
1. Aspekt und Aktionsart
Im Allgemeinen wird in der Forschung zwischen Aspektsprachen und Nichtaspektsprachen unterschieden. Das wichtigste Merkmal für die Identifizierung von Aspektsprachen ist dabei die Grammatikalisierung der Aspektopposition. [21] Über das Vorhandensein von aspektähnlichen Oppositionen bzw. aspektualer Bedeutungen in Nichtaspektsprachen wie z. B. dem Deutschen wird viel diskutiert. Leiss z. B. weist darauf hin, dass die Möglichkeit der Perspektivierung, die der Aspekt bietet, auch im Deutschen gegeben ist, wenn auch nicht die grammatische Kategorie auszumachen ist. [22] Auch Czochralski stellt in seiner konfrontativen Arbeit zum Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen fest, dass der Aspekt als Verbalkategorie im Deutschen nicht existiert, jedoch von aspektähnlichen Erscheinungen ausgegangen werden kann. [23]
In diesem Zusammenhang spielt der Begriff der Aktionsarten eine wichtige Rolle, da er in der Aspektforschung in unterschiedlichen Definitionen und Relationen auftaucht. Die Abgrenzung der Begriffe Aspekt und Aktionsart scheint terminologisch unklar und inhaltlich schwierig. Eine erste klare Unterscheidung der beiden Begriffe machte der Slawist Agrell:
„Unter Aktionsart verstehe ich […] nicht die beiden Hauptkategorien des slawischen Zeitwortes, die unvollendete und die vollendete Handlungsform (das Imperfektivum und das Perfektivum)- diese nenne ich Aspekte. Mit dem Ausdrucke Aktionsart bezeichne ich bisher fast gar nicht beachtete - geschweige denn klassifizierte - Bedeutungsfunktionen der Verbalkomposita (sowie einiger Simplicia und Suffixbildungen), die genauer ausdrücken wie die Handlung vollbracht wird, die Art und Weise ihrer Ausführung markieren.“ [24]
Das sprachwissenschaftliche Lexikon von Bußmann stellt für beide Begriffe einen Bezug auf die interne zeitliche Struktur von Verb- und Satzbedeutungen fest. Der Aspekt wird demnach als in der Morphologie einzelner Sprachen grammatikalisierte Kategorie geführt, Aktionsart dagegen als eine „in der Verbbedeutung objektiv verankerte“, lexikalisch-semantische Kategorie. [25]
Auf den unterschiedlichen Gebrauch des Terminus „Aktionsart“ in der westlichen Sprachforschung und der Slawistik weisen Bartnicka et. al. in der Grammatik des Polnischen hin: Im Westen bezeichne er oft die Lexikalische Aktionale Funktion oder die Lexemtypen (in der Terminologie dieses Buches entspricht das der o.g. Definition als in der Verbbedeutung verankerter Kategorie), in der Slawistik dagegen häufig lexikalische Derivate (Modifikationen). [26] Czarnecki erwähnt ebenfalls, dass die Aktionsarten in der neueren polnischen Grammatik in „modifizierende und mutative Funktionen der Verbalpräfixe aufgelöst“ werden. [27]
Zur Frage der Vergleichbarkeit von Sprachen mit und ohne Aspektkategorie hält schon Gross in einer Arbeit zum Verbalaspekt die Tatsache fest, dass
„systemhafte formale Kategorien in der einen Sprache und nicht-systemhafte 'Ausdrucksmöglichkeiten' in der anderen eine durchaus vergleichbare Funktion erfüllen können.“ [28]
Bei der Mehrheit der Aspektforscher macht Gross diese Grundeinstellung aus. Dennoch weist die uneinheitliche terminologische Abgrenzung und Definition von Aspekt und auch Aktionsart auf Schwierigkeiten im Vergleich hin.
2. Aspektualität
In der neueren Aspektforschung gilt der Aspekt zum Teil als eine universale Kategorie, die in vielen Sprachen vorkommt und in einigen morphologisch markiert ist. [29] Für diese weitergefasste, die Funktionen mehr als die Formen betrachtende Definition des Aspekts hat sich auch der Begriff der Aspektualität etabliert. Er kann als übergeordneter Terminus für Aspekt und Aktionsart gesehen werden und ihre Funktionen in Zusammenhang bringen. Dadurch ist auch ein Vergleich zwischen Sprachen mit grammatikalisierten Aspektoppsitionen wie den slawischen Sprachen und Nichtaspektsprachen wie dem Deutschen besser möglich.
Der polnische Germanist Czarnecki bemüht sich in einer Arbeit zur Aspektualität im Polnischen und Deutschen um eine genaue Definition dieses Begriffs, um sodann Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Ausdruck der Aspektualität in beiden Sprachen zu beschreiben. Er definiert Aspektualität als eine (funktionell-semantische) Begriffskategorie des Satzes, die alle aspektualen Mittel des Satzes ausdrückt. Die Ausdrucksmittel der Aspektualität informieren in der Wechselwirkung über die gesamte zeitliche Charakteristik des Satzes. Als eine Zeitkategorie vermittelt Aspektualität in Verbindung mit den anderen zeitlichen Kategorien des Satzes eine Komplementärbedeutung des Satzes, die zeitliche Bedeutung. Czarnecki nennt diese, um Verwechslungen mit dem bestehenden Begriff Temporalität auszuschließen, Chronetik. [30] Er entwirft also auch eine neue, sehr umfangreiche Terminologie.
Als Hauptarten der aspektualen Bedeutung unterscheidet er die Situationalität, die Informationen zum Verhältnis der Vorzeitigkeit/Nachzeitigkeit zur Situationszeit gibt, die Aktionalität, die die Art und Weise des chronetischen Verlaufs charakterisiert und die Aspektivität, die die grammatischen Ausdrucksmittel beinhaltet und mit einer kontextunabhängigen situationellen und einer aktionalen kontextabhängigen Komponente ein Schnittpunkt der anderen beiden Subkategorien ist. [31] Die genannten Kategorien werden mit ihren Ausprägungen im Verlauf der Arbeit weiter präzisiert, außerdem entwirft Czarnecki eine allgemeine Aufstellung der Ausdrucksmittel der Aspektualität. Hier unterscheidet er zwischen verbalen und außerverbalen Ausdrucksmittel, zu denen er neben anderen Wortarten wie Adverbialien und Artikel auch Satzgliedstrukturen und Mittel der Satzgliedverflechtung (Textebene) zählt.
3. Deutsche Tempora und Aspektualität: Die Perfekthypothese
Zu den grammatikalisierten verbalen Ausdrucksmitteln der Aspektualität zählt Czarnecki neben dem Aspekt als regulärstes Mittel auch sogenannte Aspektotempora, eine Kategorie, die er u. a. im Deutschen ausmacht, im Polnischen jedoch nicht. Mit Aspektotempora werden hier Tempora bezeichnet, die gleichzeitig Temporalität und in bestimmten Kontexten Aspektualität ausdrücken. Die aspektive Bedeutung dieser Tempora wird bei Czarnecki als Perfektkomplexität bezeichnet, in Unterscheidung zur Perfektivität im Polnischen, die durch den Aspekt ausgedrückt wird. Eine solche Bedeutung können laut Czarnecki Verbindungen in der Form „haben/sein+Partizip II (Partizip Perfekt)“ beinhalten. [32]
Zur Frage einer möglichen aspektualen Bedeutung des deutschen Perfekt gibt es verschiedene Hypothesen. Auch in der deutschen Grammatik von Glinz heißt es zum Perfekt, dass man es
„keineswegs als eine einfache 'Vergangenheit' sehen darf, […] das Wesentliche ist das Moment 'durchgeführt, vollzogen, abgeschlossen'“. [33]
Neben dieser Aspekthypothese, die das Perfekt rein aspektual deutet, zählt z.B. Vater in einem Aufsatz die Ambiguitätshypothese auf, die besagt, dass das Perfekt entweder temporal mit Vergangenheitsbedeutung oder aspektuell mit eben dieser Vollzogenheits- und Abgeschlossenheitsbedeutung verwendet wird. Vater selbst vertritt die Komplexitätshypothese. [34] Demnach hat das Perfekt eine einheitliche grammatische Grundbedeutung: Es hat eine temporale Komponente (Vergangenheitsbedeutung) sowie eine aspektuelle, die als Relation zwischen Referenzzeit und Situationszeit angegeben ist. Diese These entwickelten Ehrich/Vater auf der Grundlage der Parameter von Klein/Reichenbach. [35] Es handelt sich um die Äußerungszeit (S), die Situations- oder Ereigniszeit (E) und die Referenzzeit (R), über die eine Aussage gemacht wird. Tempus ist dabei eine Relation zwischen Äußerungszeit und Ereigniszeit, bezieht sich also, wie auch bei Czarnecki beschrieben, auf die äußeren zeitlichen Beziehungen der Situation. [36] Diese Relation ist nach der Komplexitätshypothese variabel, die aspektuelle Komponente, die sich auf die zeitlichen Beziehungen innerhalb der Situation bezieht, hingegen invariabel und besagt: Referenzzeit nach Ereigniszeit.
Weiterhin stellen Ehrich/Vater fest, dass das Perfekt ,abhängig von den Aktionsarten der Verben, hinsichtlich seiner temporalen Komponente unterschiedlich gedeutet wird. Es kann so als Präsensperfekt, unbestimmte Vergangenheit oder unmittelbare Vergangenheit, aber auch als zukunftsbezogen gesehen werden. [37] Auch Czarnecki differenziert innerhalb der Opposition Perfektkomplexität:Imperfektkomplexität, die er für das Deutsche bildet, in die Aktionalitätsarten[38].
Guławska sieht diese Ergebnisse als methodologischen Hinweis, die aspektuelle Analyse nicht von der aktionalen zu trennen. Sie ist auch der Ansicht, dass die Annahme aspektueller Relikte im deutschen Tempussystem Vergleichsmöglichkeiten zwischen dem Polnischen und dem Deutschen schafft. [39] In ihrer Untersuchung zur Aspektualität im Polnischen und Deutschen bezieht sie Aktionsarten mit ein, sie unterscheidet im Deutschen z. B. terminative und aterminative (grenzbezogene-nichtgrenzbezogene) Verben. Dabei weist sie mit Andersson darauf hin, dass, im Unterschied zu den slawischen Sprachen, das Erreichen oder Nichterreichen der Grenze in den deutschen Verben nicht semantisch enthalten ist, nur das Vorhandensein der Grenze. Das Erreichen oder Nichterreichen wird durch den Kontext ausgedrückt. In diesem Zusammenhang geht sie von der Hypothese aus, dass, da die Grenze der Handlung (auch für lexematisch nicht grenzbezogene Verben) im Deutschen u. a. mit dem Perfekt ausgedrückt werden kann, dieses als Äquivalent für den polnischen perfektiven Aspekt gelten kann. [40] Da auch das Plusquamperfekt und das Futur II im Deutschen den Aspekt der Vollzogenheit beinhalten, bezieht sie diese in ihre Untersuchung ein. Guławska kann jedoch die Hypothese nicht vollständig aufrechterhalten, da sich in ihrer Untersuchung zeigt, dass es in beiden Übersetzungsrichtungen vorkommt, dass die Bedeutung nicht richtig wiedergegeben werden kann. Die Schwierigkeiten bestehen dabei in der Wiedergabe der Aktionalität, die in der Übersetzungssprache mit lexikalischen Mitteln ausgedrückt werden muss. [41] Damit untermauert Guławska ihre These, dass die aspektuale Analyse nicht von der aktionalen zu trennen ist.
Auch Czarnecki betont, dass in seiner Untersuchung die
„konfrontative Gegenüberstellung der polnischen und deutschen aspektiven Bedeutungen […] nut in der Verbindung mit ihren aktionalen Kontexten möglich“ war. [42]
In der Gegenüberstellung ordnet er deshalb die aspektiven Bedeutungen nach den aktionalen Kontexten und stellt fest, dass sich, abhängig von der Aktionalitätsart, die aspektiven Bedeutungen (Imperfektivität/Perfektivität; Imperfektkomplexität/Perfektkomplexität) entsprechen können, sie in der anderen Sprache aber auch mit der entgegensetzten Bedeutung ausgedrückt werden können. Er stellt auch Gemeinsamkeiten im Ausdruck der aktionalen Bedeutungen fest. Als Beispiel sei ein Absatz zitiert, in dem Czarnecki die Ausdrucksweisen der Perdurativität zusammenstellt, einer Aktionalitätsart, die er als zeitliche Begrenzung der Situation vom Anfang bis zum Ende eines Intervalls definiert:
„Perdurativität: Poln. - ipf./perf. Aspekt entsprechend für die Imperfektivität/Perfektivität und für die Perfektivität // Dt. - ipfk./pfk. Tempora entsprechend für die Imperfektkomplexität/Perfektkomplexität: poln. ipf. - dt. pfk.: Dziś padało przez cały czas – Heute hat es die ganze Zeit durchgeregnet […] /poln. pf. - dt. pfk.:Piotr przemarzył całą ostatnią godzinę – Peter hat die ganze letzte Stundedurchträumt/poln. ipf. - dt. ipfk.:Wczoraj Paweł leżał cały dzień w łóżku – Gestern hat Paul den ganzen Tag hindurch im Bett gelegen // Gestern lag Paul den ganzen Tag hindurch im Bett /poln. pf. - dt. ipfk.:Wczoraj Paweł przeleżał cały dzień w łóżku – Gestern hat Paul den ganzen Tag hindurch im Bettgelegen// Gestern lag Paul den ganzen Tag hindurch im Bett.” [43]
Das Beispiel zeigt auch, dass das deutsche Perfekt sowohl als Ausdrucksmittel der Perfektkomplexität als auch der Imperfektkomplexität gesehen wird. Das hängt nach Czarnecki davon ab, ob es als Aspektotempus und damit relative Tempusform [44] oder absolut verwendet wird. Absolut verwendet, gilt es als reines Tempus und Ausdrucksmittel der Imperfektkomplexität. [45]
Zusammenfassung
Ausgehend von einer Beschreibung des polnischen Verbalaspekts mit seinen Funktionen wurden in dieser Arbeit Theorien und Untersuchungen zur Frage der Ausdrucksmöglichkeiten dieser Funktionen in der deutschen Sprache herangezogen. Das Thema erweist sich als komplex, sowohl was die Funktionen des morphologischen Aspekts in der polnischen Sprache angeht, als auch in Bezug auf Diskussionen zu einer möglichen Aspektualität im Deutschen und deren Gestaltung.
Aus der Tatsache, dass das Polnische eine grammatische Kategorie aufweist, die im Deutschen nicht existiert, ergibt sich für die vergleichende Sprachwissenschaft das Vorgehen, nach Entsprechungen auf anderen Ebenen zu suchen. Deutlich tritt auch in den in dieser Arbeit behandelten Untersuchungen von Guławska und Czarnecki der von vielen Germanisten, u. a. der bereits weiter oben zitierten Elisabeth Leiss, vertretene Standpunkt hervor, dass auch eine „aspektlose“ Sprache wie das Deutsche die Bedeutungen ausdrücken kann, die der Aspekt als morphologische Kategorie wiedergibt, „Aspektualität“ als eine funktional-semantische Kategorie also durchaus besitzt. Guławska kommt zu dem Schluss, dass, allgemein ausgedrückt, in den Bereich dieser Kategorie im Deutschen „Flexionsformen, morphologische und syntaktische Phänomene“ gehören[46]. Wie Czarnecki bezeichnet sie die relativen Tempora, das Perfekt, Plusquamperfekt und Futur II, als grammatische Mittel zum Ausdruck von Aspektualität. Dieser sieht in den, in seiner Terminologie, Aspektotempora das einzige grammatische Ausdrucksmittel von Aspektualität im Deutschen[47].
Neben dieser grammatischen Aspektualität verweist Guławska auf die lexikalische Aspektualität- die Aktionsarten. Der enge Zusammenhang von Aspekt und Aktionsarten wird in beiden genannten Untersuchungen deutlich gemacht, auch in der Grammatik des Polnischen von Bartnicka et. al. wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen. Die Trennung der Begriffe Aspekt und Aktionsart ist problematisch und wird unterschiedlich gehandhabt. Die terminologische Ungenauigkeit in diesem Forschungsbereich wird in vielen Schriften thematisiert und bemängelt. [48] Die Schaffung der Kategorie Aspektualität, die beide Begriffe unter sich vereint, scheint eine Lösung anzubieten. Sie hebt die Gemeinsamkeiten hervor: den Bezug auf die innere (zeitliche) Struktur von Verb- und Satzbedeutungen.
Der Zusammenhang zwischen Aspekt- und Tempussystem ist offensichtlich und z. B. von Bartnicka et. al. für das Polnische ausführlich dargestellt, in der vorliegenden Arbeit wurde im ersten Kapitel darüber berichtet. Angesichts des engen Zusammenhangs liegt es nahe, in der anderen Sprache nach Entsprechungen für aspektuale Bedeutungen im Tempussystem zu suchen. Auf Theorien und Untersuchungen zur Aspektualität im deutschen Tempussystem wurde im zweiten Kapitel eingegangen. Die Kompensation beruht auf Gegenseitigkeit: Das Metzler Lexikon Sprache z. B. weist daruf hin, dass der Aspekt in slawischen Sprachen (in Verbindung mit kontextueller Einbettung der Äußerung und lexikalischen Signalen) die fehlende Tempusdifferenzierung ausgleicht. [49] Das zeigen auch die im ersten Kapitel dieser Arbeit wiedergegebenen Tempusrelationen und Satzfunktionen, die u. a. den Ausdruck von Vorzeitigkeit oder Gleichzeitigkeit von Situationen durch unterschiedliche Kombination der Aspekte im Satz beschreiben.
Wichtig erscheint noch der Hinweis des Germanisten Gross, dass auch in Aspektsprachen die aspektualen Bedeutungen nicht nur in Verbformen, d.h. grammatisch, ausgedrückt werden. [50] Czarnecki stellt auch in seiner Untersuchung im Bereich der lexikalischen Ausdrucksweise von Aspektualität Gemeinsamkeiten des Polnischen und Deutschen fest, diese betreffen vor allem Adverbialien und Präpositionen, Adjektive und Substantive. [51] Nach Czarneckis Entwurf von Aspektualität gehören all diese Wortarten (unter bestimmten Umständen) zu den außerverbalen Ausdrucksmitteln, ebenso gibt es Mittel auf Satz- und Textebene. In beiden Sprachen ist die Ausdrucksweise von Aspektualität also komplex und zeigt sich auch in polnischen Sätzen nicht unbedingt nur im morphologisch markierten Verbalaspekt, z. B. wird dieser im Satz häufig begleitet von Zeitadverbien wie często, zawsze(imperfektiv) oder nagle(perfektiv). Auch diese sind dann Träger aspektualer Bedeutung.
Vorgestellt wurde in dieser Arbeit also hauptsächlich ein mögliches Mittel zum Ausdruck des polnischen Verbalaspekts im Deutschen, der Ausdruck durch Tempusformen. Andere Ausdrucksmittel bleiben in der zu diesem Forschungsthema existierenden Literatur nicht unerwähnt, sie werden im Gegenteil als notwendig erachtet, um die Komplexität der aspektualen Bedeutungen in beiden Sprachen zu erfassen.
Literaturverzeichnis
Agrell, S. (1908): Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen Zeitworte: Ein Beitrag zum Studium der indogermanischen Präverbia und ihrer Bedeutungsfunktion. Lund.
Bartnicka, B. et.al. (2004): Grammatik des Polnischen. München.
Bondarko, A.V. (1976): Stand und Perspektiven der Aspektologie in der UdSSR.
In: Girke, W./Jachnow, H. (Hrsg.): Theoretische Linguistik in Osteuropa. S.123-140. Tübingen.
Bußmann, H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart.
Bybee, J. L./Dahl, Ö. (1989): The creation of tense and aspect systems in the languages of the world. In: Studies in Language 13/1, S. 51-103.
Czarnecki, T. (1998): Aspektualität im Polnischen und Deutschen. Bedeutungen und Formen in einer konfrontativen Übersicht. Gdańsk.
Czochralski, J. (1972): Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Warszawa.
Ehrich, V./Vater, H. (1989): Das Perfekt im Dänischen und im Deutschen. In: Abraham,W./Janssen,T. (Hrsg.): Tempus-Aspekt-Modus. S.103-132. Tübingen.
Glinz, H. (1970): Deutsche Grammatik I. Satz-Verb-Modus-Tempus. Bad Homburg.
Glück, H. (Hrsg.) (2005): Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart.
Gross, H. (1974): Der Ausdruck des 'Verbalaspekts' in der deutschen Gegenwartssprache. Hamburg.
Guławska, M. (2000): Aspektualität im Polnischen und Deutschen. Eine praktische Untersuchung am Beispiel der Übersetzungen beider Richtungen. München.
Hentschel, E. (Hrsg.) (2010): Deutsche Grammatik. Berlin/New York.
Kotin, M. L. (2000): Die Aspekttheorie in der Linguistik und die „Aspekt-Empirie“ in germanischen Sprachen. In: Kątny, A.(Hrsg.): Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen. S. 21-34. Poznań.
Leiss, E. (1992): Die Verbalkategorien des Deutschen. Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung. Berlin/New York.
Vater, H. (2000): Das deutsche Perfekt-Tempus oder Aspekt oder beides? In: Kątny, A. (Hrsg.): Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen. S. 87-107. Poznań.
[1] Bartnicka et. al. (2004), S. 113
[2] zur gesamten Beschreibung der Kategorisierung vgl. ebd., S. 110-132
[3] Bondarko (1976), S.136.
[4] Einen Überblick über die Begriffsgeschichte und Abgrenzung verwandter Begriffe gibt Czarnecki (1998).
[5] Bartnicka et. al. (2004), S.131.
[6] Genau wird die Kategorie als pragmatische Definitheit bezeichnet, die Subkategorien temporale und modale Definitheit enthaltend. Da die modale D. jedoch als marginal bezeichnet wird, wird sie im folgenden nicht weiter behandelt. Vgl. Bartnicka et. al. (2004), S.361.
[7] vgl. Bartnicka et. al. (2004), S.317.
[8] ebd., S.362.
[9] ebd., S.372.
[10] ebd.
[11] vgl. Bartnicka et. al. (2004), S. 363f.
[12] vgl. ebd., S.365ff.
[13] Nach Bartnicka et. al. zählt auch das Ersetzen eines vorhandenen Suffix am pf. Stamm durch das Aspektsuffix zur regulären Imperfektivierung, da es formal der Regel entspricht: „ipf. Verb mit Suffix mit /(v)a/<pf.Verb ohne solches Suffix“. Bartnicka et. al. (2004), S. 389.
[14] Bartnicka et. al. (2004), S. 388.
[15] vgl. auch Guławska (2000), S.21.
[16] Bartnicka et. al. (2004), S. 405.
[17] ebd., S. 414f.
[18] ebd., S. 398f.
[19] ebd., S. 403.
[20] ebd., S. 403.
[21] vgl. z. B. Hentschel (2010), S. 40, Kotin (2000).
[22] Leiss (1992), S. 35, 40.
[23] Czochralski (1972).
[24] Agrell (1908), S. 78.
[25] Bußmann (1990), S. 60.
[26] Bartnicka et. al. (2004), S. 394.
[27] Czarnecki (1998), S.17.
[28] Gross (1974), S. 7.
[29] vgl. z. B. Bybee/Dahl (1989).
[30] Czarnecki (1998), S.21-23.
[31] ebd., S.31-35.
[32] vgl. ebd., S. 164ff.
[33] Glinz (1970), S. 149.
[34] vgl. Vater (2000).
[35] vgl. Ehrich/Vater (1989).
[36] vgl. Czarnecki (1998), S.26ff; Vater (2000), S.97f.
[37] vgl. Ehrich/Vater (1989), S. 108ff.; Vater (2000), S. 98ff.
[38] vgl. Czarnecki (1998), S.174ff.
[39] Guławska (2000), S. 28.
[40] ebd., S. 33.
[41] ebd., S. 82ff.
[42] Czarnecki (1998), S. 189.
[43] ebd., S. 181f.
[44] d.h. nicht unmittelbar, sondern nur über andere, absolute Tempusformen auf die Sprechzeit bezogen, vgl. Guławska (2000), S. 29.
[45] Czarnecki (1998), S. 165f.
[46] Guławska (2000), S. 157.
[47] Czarnecki (1998), S. 188.
[48] z. B. in Gross (1974).
[49] vgl. Metzler Lexikon Sprache (2005), S. 61f.
[50] Gross (1974), S. 138.
[51] Czarnecki (1998), S. 188.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit zum polnischen Verbalaspekt?
Die Arbeit befasst sich mit dem sprachlichen Phänomen des Verbalaspekts, das in einigen Sprachen formal ausgebildet ist (wie im Polnischen) und in anderen nicht (wie im Deutschen). Sie untersucht, ob das, was im Polnischen durch den Verbalaspekt ausgedrückt wird, im Deutschen eine Entsprechung hat. Es wird ein bilateraler Vergleich zwischen einer Aspekt- und einer Nichtaspektsprache durchgeführt.
Was sind die Hauptkapitel der Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptkapitel:
- Kapitel I: Der polnische Verbalaspekt (Beschreibung des Aspekts im Polnischen)
- Kapitel II: Ausdrucksformen für den Verbalaspekt im Deutschen (Untersuchung, wie die im Polnischen durch den Aspekt ausgedrückten Bedeutungen im Deutschen wiedergegeben werden können)
Was versteht man unter Aspekt und Aspektualität im Kontext dieser Arbeit?
- Aspekt: Eine morphologische Kategorie des Verbs.
- Aspektualität: Die Funktionen des Aspekts, die sich über alle Beschreibungsebenen erstrecken und von Kontextfaktoren abhängen.
Welche Ebenen der sprachlichen Beschreibung werden im Hinblick auf den polnischen Aspekt betrachtet?
Der polnische Aspekt wird auf drei Ebenen betrachtet:
- Lexikalische Ebene: Betrachtung der lexikalischen Bedeutung von Verben und ihrer Aspektpartner.
- Morphologische Ebene: Analyse der Bildung von Aspektpartnern durch Suffigierung und Präfigierung.
- Syntaktische Ebene: Untersuchung der Auswirkungen des Aspekts auf die Satzfunktion.
Was ist der Unterschied zwischen Aktionsart und Aspekt im Deutschen?
Die Abgrenzung der Begriffe Aspekt und Aktionsart ist terminologisch unklar und inhaltlich schwierig. Der Aspekt wird als in der Morphologie einzelner Sprachen grammatikalisierte Kategorie geführt, Aktionsart dagegen als eine "in der Verbbedeutung objektiv verankerte", lexikalisch-semantische Kategorie.
Was ist die Perfekthypothese im Zusammenhang mit dem deutschen Aspekt?
Die Perfekthypothese besagt, dass das deutsche Perfekt neben einer temporalen Komponente (Vergangenheitsbedeutung) auch eine aspektuelle Komponente besitzt, die als Relation zwischen Referenzzeit und Situationszeit angegeben wird. Es wird diskutiert, ob das Perfekt eine aspektuelle Bedeutung hat, die der Vollzogenheit und Abgeschlossenheit entspricht.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Deutsch zwar keine grammatische Kategorie des Verbalaspekts besitzt wie das Polnische, aber dennoch die Bedeutungen, die der Aspekt ausdrückt, auf anderen Ebenen (z. B. durch Tempusformen, lexikalische Mittel) wiedergeben kann. Die Kategorie "Aspektualität" vereint dabei die Begriffe Aspekt und Aktionsart.
- Quote paper
- Lena Dopheide (Author), 2013, Der polnische Verbalaspekt und seine Entsprechungen im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1483975