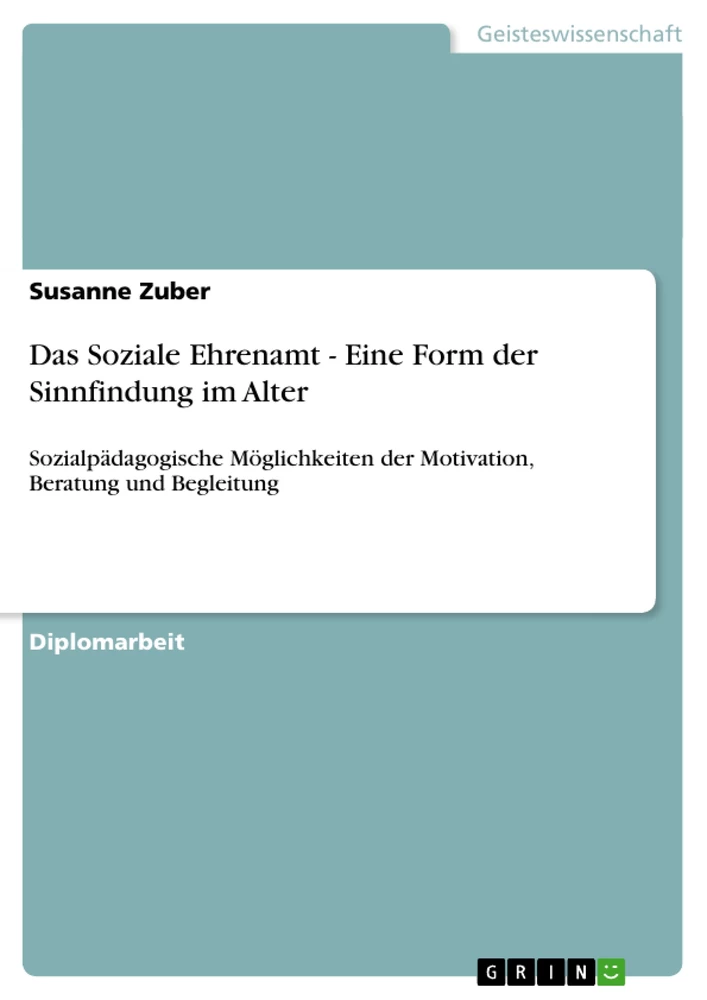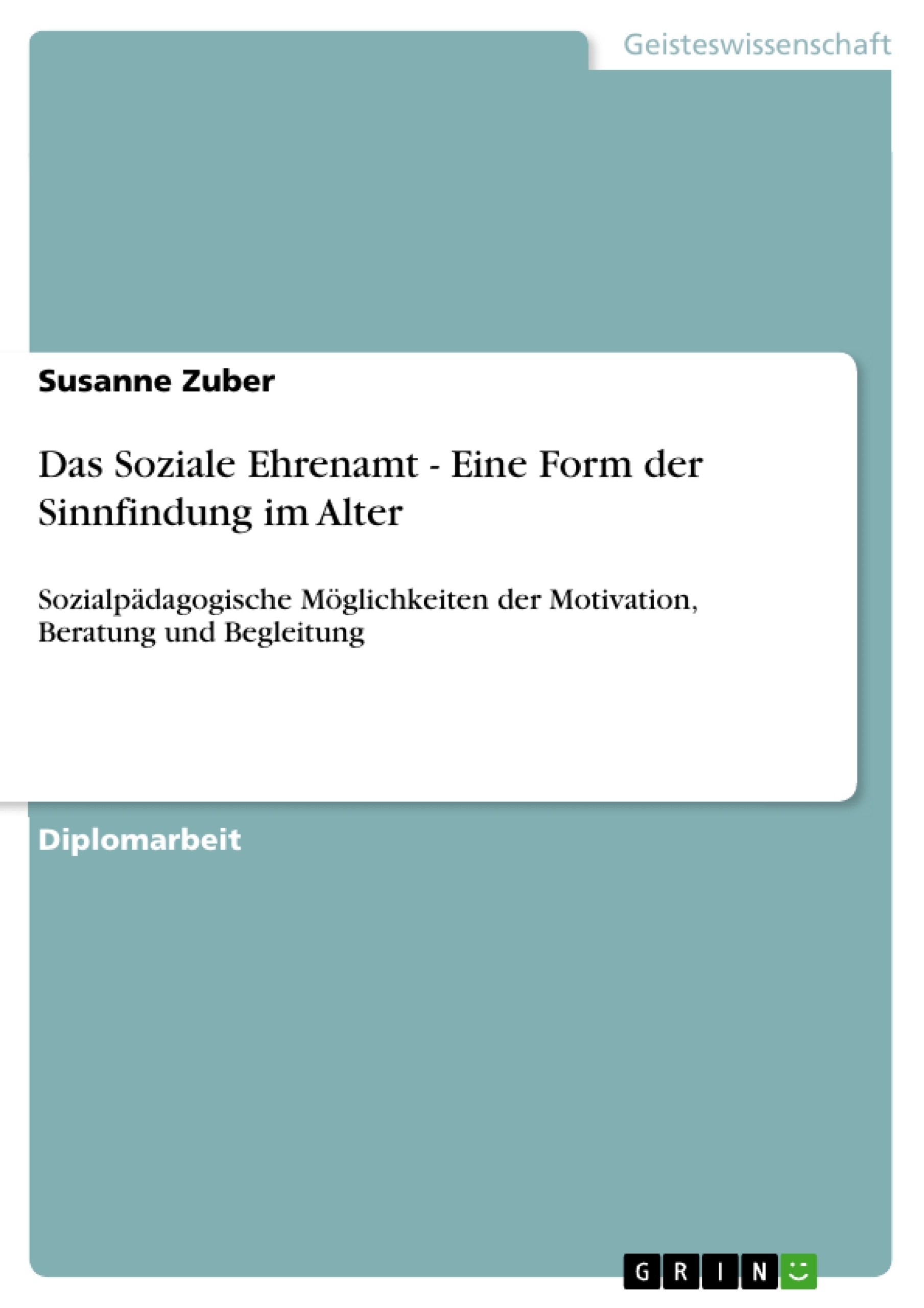In den letzten Jahrzehnten war das Wort "Wertewandel" in aller Munde. Ein Teil der Bevölkerung verbindet damit vorwiegend positive Vorstellungen, da es um Modernisierung und Reformierung unserer Gesellschaft geht. Andere dagegen sehen im Wertewandel eine Abkehr von bewährten und traditionellen Tugenden und Normen.
Inzwischen hat sich das Blatt nahezu vollständig zugunsten der Skeptiker gewendet, die in den Tenor der Klage über den "Werteverfall" miteinstimmen. Noch scheint aber Einverständnis darüber zu herrschen, dass es bei dem Verfall nicht um das Wertegerüst an sich geht, sondern um die Menschen in der Bevölkerung, die sich in ihren Individuellen Wertorientierungen und ihrem Verhalten immer weiter vom offiziellen Wertesystem entfernen, das allerdings immer noch als positiv und verbindlich angesehen wird. "Dominierten in den 50er Jahren die sogenannten Sekundärtugenden "Ordnungsliebe und Fleiß" im Verein mit dem autoritären Wert "Gehorsam und Unterordnung", so übernahm seit den 60er Jahren die individualistische Vorstellung "Selbständigkeit und freier Wille" die Führung." (Gensicke, 1994, S. 1117).
Glaubt man aktuellen Berichten, so unterliegt auch das soziale Ehrenamt einem "Wertewandel", der dem gesellschaftlichen Trend folgt. Auch hier vollzieht sich ein Individualisierungsprozess, innerhalb dessen die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit des menschlichen Individuums zur obersten kulturellen Leitgröße erklärt wurde. Da der demographische Trend - eine alternde Gesellschaft - vorgegeben und durch Politik - jedenfalls kurz- und mittelfristig - kaum zu verändern ist, müssen die Älteren im Interesse der Gesellschaft insgesamt für soziale Aufgaben gewonnen werden. Soziales Ehrenamt geht alle an und kann eine Sinnfindung im Alter sein. Gezielte sozialpädagogische Beratung und Begleitung der ehrenamtlich tätigen älteren Menschen ist aber unumgänglich, um sie zu motivieren, sie vom "Rückzug aufs Altenteil" abzuhalten und sie zu ermutigen, ihre Lebenserfahrungen und Kenntnisse für andere einzusetzten. In dieser Arbeit wird vorgestellt, welche Methoden und sozialpädagogische Aufgaben zu erfüllen sind, um ältere Menschen zur Übernahme eines Ehrenamtes zu bewegen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- 1. Was bedeutet „alt sein“ beim Menschen?
- 1.1 Der Altersbegriff
- 1.1.1 Die Brauchbarkeit des Begriffs
- 1.1.2 Altern als ein lebenslanger Prozess
- 1.2 Älterwerden
- 1.2.1 Medizinische Aspekte
- 1.2.2 Psychologische Aspekte
- 1.2.3 Soziologische Aspekte
- 1.3 Die „Alten“ eine heterogene Gruppe
- 1.3.1 Junge Alte als „Senioren“
- 1.3.2 „Hochbetagte“
- 1.3.3 Die Notwendigkeit einer begrifflichen Differenzierung des Alters
- 1.4 Individuelles Altern vor dem Hintergrund der eigenen Biographie
- 1.5 Altwerden im 20. Jahrhundert: Atomzeitalter und Multimedia-Entwicklung
- 1.6 Altern ein Stigma. Zwei Sichtweisen: Fremdbild und Selbstbild
- 1.7 Frauen altern anders als Männer
- 1.7.1 Feminisierung und Singularisierung des Alters
- 1.7.2 Altern vor dem Hintergrund unterschiedlicher Sozialisation
- 1.7.3 Differenzierende Daseinsbewältigung im Alter: Ein unterschiedliches Rollenfach
- 1.7.4 Ökonomische Situation
- 1.7.5 Kooperation der Geschlechter
- 1.8 Demographische Entwicklung
- 1.8.1 Der Alterbaum: Von der Pyramide zum Pilz
- 1.8.2 Auswirkungen auf den Generationen
- 1.9 Sozialpädagogische Möglichkeiten der Motivation, Beratung und Begleitung
- 1.9.1 Alternstheorien
- 1.9.1.1 Aktivitätstheorie
- 1.9.1.2 Disengagementtheorie
- 1.9.1.3 Relevanz
- 1.9.2 Aufgabenorientierte Ansätze
- 1.9.2.1 Altern als Hindurchgehen durch Krisen
- 1.9.2.2 Altern als Bewältigung von Entwicklungsaufgaben
- 1.9.2.3 Relevanz
- 1.9.3 Theorie des „erfolgreichen Alterns“
- 1.10 Die,,ewige Fehlbarkeit“: Die Theorie
- 2. Das Ehrenamt
- 2.1 Hilfe als Urkategorie menschlichen Handelns
- 2.2 Das soziale Ehrenamt: Ein Definitionsversuch
- 2.2.1 Abgrenzung des sozialen Ehrenamtes von anderen Formen ehrenamtlicher Tätigkeit
- 2.2.2 Ehrenamtliches Engagement und Geschlechterrollen
- 2.2.3 Veränderungen in den Geschlechterrollen führt zum Wandel des sozialen Ehrenamtes
- 2.3 Begriffsverwirrung: Klassisches Ehrenamt, Selbsthilfe und „,Neues Ehrenamt“
- 2.4 Historische Eckpunkte
- 2.4.1 Der „Barmherzige Samariter“
- 2.4.2 Die christlichen Gemeinden und die Nächsten
- 2.4.3 Das,,Elberfelder System“ (1852)
- 2.4.4 Das,,Straßburger System“ (1907)
- 2.4.5 Das ehrenamtliche soziale Engagement und die erste Frauenbewegung
- 2.4.6 Weimarer Republik und Drittes Reich
- 2.4.7 Jüngere Vergangenheit und derzeitiger Diskussionsstand
- 3. Ein soziales Ehrenamt innehaben: Bedeutung für ältere Menschen
- 3.1 Persönliche Voraussetzungen für die Übernahme eines Ehrenamtes
- 3.1.1 Gesundheit
- 3.1.2 Mobilität
- 3.1.3 Kompetenz
- 3.2 Ressourcen des Alters: Besondere ,,Schätze“
- 3.2.1 Flexibles Zeitbudget
- 3.2.2 Erfahrungswissen: „Man muß lange leben, um ein Mensch zu werden“
- 3.3 Zur Motivationslage älterer Menschen
- 3.3.1 Die „Alten der Zukunft“
- 3.3.2 Was sich die Senioren heute wünschen: Tätigsein auch im Alter
- 3.3.3 ,,Das Recht auf Faulheit“
- 3.3.4 Produktivität des Alters
- 3.3.5 Spaß muss sein
- 3.4 Die Frage nach dem Sinn des Lebens
- 3.4.1 Das Thema Lebenssinn in Religion, Wissenschaft und Literatur
- 3.4.2 Viktor Frankl: Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn
- 3.4.3 Sinnfindung und Alter
- 3.4.4 Geben und Nehmen: Das soziale Ehrenamt im Alter
- 4. Sozialpädagogische Möglichkeiten der Motivation, Beratung und Begleitung ehrenamtlich tätiger älterer Menschen
- 4.1 Beispiel: Altentagesstätte
- 4.2 Herausforderung Alter
- 4.3 „Ohne Nachwuchs läuft nichts“
- 4.4 Sozialpädagogisches Handeln vor dem Hintergrund eines bestehenden Menschenbildes
- 4.5 Die Bedeutung von Planung für sozialpädagogisches Handeln
- 4.6 Die Elemente eines Konzeptes
- 4.6.1 Konzept-Modelle
- 4.6.2 Die drei Teile eines Konzepts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob das soziale Ehrenamt eine Form der Sinnfindung im Alter darstellt. Sie untersucht die Möglichkeiten der Motivation, Beratung und Begleitung älterer Menschen im sozialen Ehrenamt aus sozialpädagogischer Sicht. Die Arbeit betrachtet das Ehrenamt als eine wichtige Ressource im Alter und analysiert die Faktoren, die ältere Menschen motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren.
- Der Altersbegriff und die Herausforderungen des Älterwerdens
- Die Bedeutung des sozialen Ehrenamtes für ältere Menschen
- Motivationale Aspekte und Ressourcen des Alters im Kontext des Ehrenamtes
- Sozialpädagogische Ansätze zur Motivation, Beratung und Begleitung ehrenamtlich tätiger älterer Menschen
- Die Rolle von Planung und Konzepten im sozialpädagogischen Handeln im Bereich des Ehrenamtes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt den Altersbegriff und die verschiedenen Aspekte des Älterwerdens. Es beleuchtet medizinische, psychologische und soziologische Perspektiven und stellt die Heterogenität der Altersgruppe heraus. Das Kapitel analysiert auch die Veränderungen des Alterns im 20. Jahrhundert und die Herausforderungen, die mit dem Älterwerden in der heutigen Gesellschaft verbunden sind.
Im zweiten Kapitel wird das soziale Ehrenamt definiert und abgegrenzt. Es werden historische Eckpunkte des Ehrenamtes beleuchtet und die Entwicklung des sozialen Ehrenamtes im Wandel der Geschlechterrollen betrachtet. Das Kapitel untersucht auch die Begriffsverwirrung zwischen klassischem Ehrenamt, Selbsthilfe und „Neuem Ehrenamt“.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des sozialen Ehrenamtes für ältere Menschen. Es analysiert die persönlichen Voraussetzungen für die Übernahme eines Ehrenamtes, die Ressourcen des Alters und die Motivationslage älterer Menschen. Das Kapitel beleuchtet auch die Frage nach dem Sinn des Lebens und die Rolle des sozialen Ehrenamtes im Alter.
Das vierte Kapitel widmet sich den sozialpädagogischen Möglichkeiten der Motivation, Beratung und Begleitung ehrenamtlich tätiger älterer Menschen. Es stellt ein Beispiel aus der Praxis vor und diskutiert die Herausforderungen des Alterns im Kontext des Ehrenamtes. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung von Planung und Konzepten im sozialpädagogischen Handeln im Bereich des Ehrenamtes.
Schlüsselwörter
Soziale Ehrenamt, Sinnfindung im Alter, Motivation, Beratung, Begleitung, Sozialpädagogik, Ressourcen des Alters, Erfahrungswissen, Altersbegriff, Älterwerden, Demographische Entwicklung, Altentagesstätte, Konzeptentwicklung, soziales Engagement, Lebensqualität, Lebenszufriedenheit, Selbstbestimmung, Generationenbeziehungen.
- Citar trabajo
- Susanne Zuber (Autor), 1996, Das Soziale Ehrenamt - Eine Form der Sinnfindung im Alter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148544