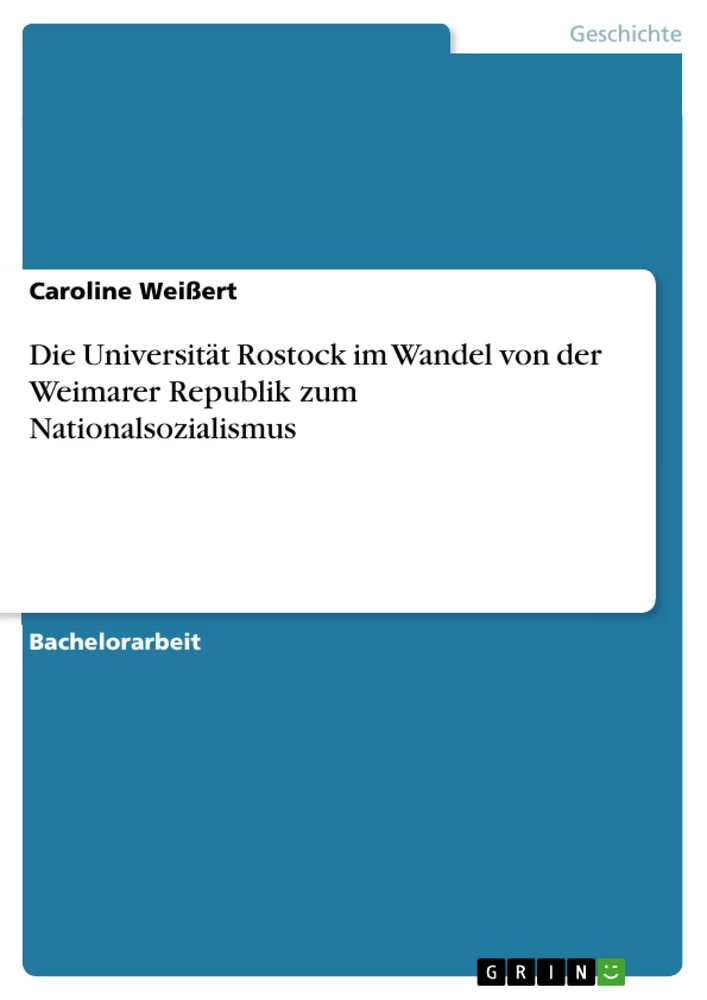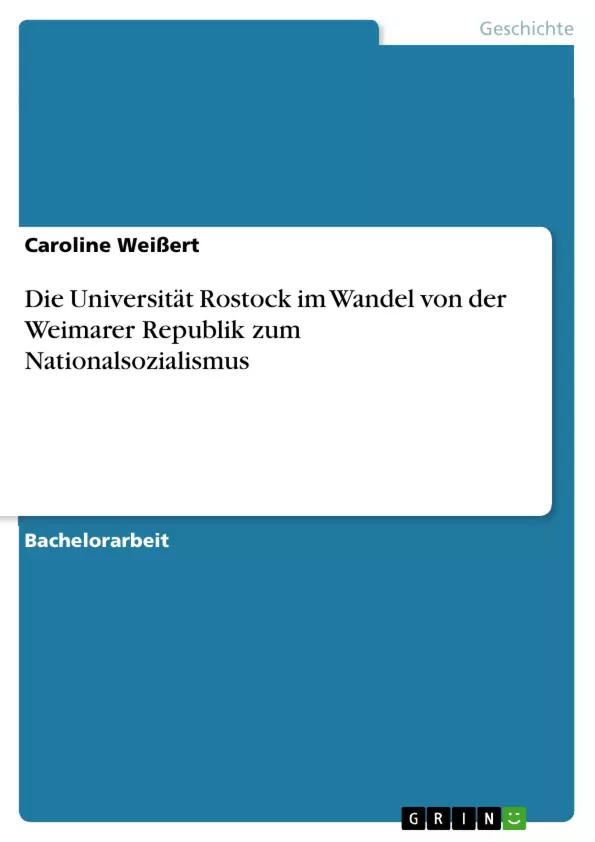Wie viele andere Universitäten unterlag auch die Universität Rostock dem Wandel der Zeit. Hierbei zeigte sich die größte Diskrepanz bei der Umwälzung von einer Institution der Weimarer Republik hin zu einer nationalsozialistischen Universität. Die Einführung des „Führerprinzips“ durchzog die gesamte Universität vom Rektor, über die Dozenten bis hin zur Studierendenschaft. Der Rektor, welcher diese Umwälzung maßgeblich unterstützte, war Prof. Dr. Paul Schulze. Die Einführung des „Führerprinzips“ wurde allerdings von den Studenten auf dem Königsberger Studententag im Juli 1932 beschlossen und deutschlandweit im Sommer 1933 eingeführt. Hier fasste man den Beschluss, die Studentenschaftswahlen abzuschaffen und dies ebnete wiederum den Weg für die Abschaffung der studentischen Selbstverwaltung und die Einführung des „Führerprinzips“.
Dieser Ausarbeitung liegen Dokumente aus dem Universitätsarchiv der Universität Rostock zu Grunde. Diese wurden eigens für die vorliegende Arbeit aufbereitet und ausgewertet, um den Unterschied der Hochschulpolitik zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus zu verdeutlichen.
Während Friedrich Brunstäd noch den Versuch unternahm eine demokratisch geprägte, der Weimarer Republik entsprechende, Satzung für die Universität zu gestalten, warf Paul Schulze dieses Konzept während seiner Amtszeit als Rektor in den Jahren 1933 bis 1936 vollständig um. Er orientierte sich dabei an einer Entscheidung der Studentenschaft, die besagte, dass das „Führerprinzip“ auch an der Universität Rostock einzuführen sei. In einer Akte mit der Aufschrift: „Hochschulreform 1933“ finden sich verschiedene Entwürfe, die verdeutlichen, wie der organisatorische Aufbau der Universität zu regeln sei, um das „Führerprinzip“ durchführen zu können. Zu diesen Entwürfen gehören unter anderem: ein Disziplinargesetz für die Studierenden der Deutschen Hochschulen, ein Vorschlag zur Reform des Kolleggeldwesens oder auch das „Politische Semester“.
Der so genannte „Berliner Entwurf“ sollte eine Sammlung all dieser Vorschläge darstellen. Der endgültigen nationalsozialistisch geprägten Satzung lag eben dieser „Berliner Entwurf“ zu Grunde.
Im wesentlichen wird sich die Bakkalaureus Artium Arbeit auf die hochschulpolitischen Maßnahmen des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volkbildung stützen und deren Umsetzung an der Universität Rostock darbieten. Dabei werden die führenden akademischen Persönlichkeiten vorgestellt und in die Betrachtung eingebunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hochschulpolitik
- Die Universitäten in der ausgehenden Weimarer Republik
- Die Universitäten im Verlauf der Errichtung einer faschistischen Diktatur
- Die Rektoren an der Universität Rostock in der Zeit zwischen 1930 und 1936
- Prof. Dr. Friedrich Brunstäd
- Prof. Dr. Curt Elze
- Prof. Dr. Kurt Poppe
- Prof. Dr. Paul Schulze
- Hauptteil
- Die „Brunstäd-Verfassung“
- Die Einführung des Nationalsozialismus an der Universität Rostock
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Transformation der Universität Rostock vom Umfeld der Weimarer Republik hin zur nationalsozialistischen Hochschule. Im Mittelpunkt steht die Einführung des „Führerprinzips“ und die damit verbundenen Veränderungen in der Hochschulstruktur, den Statuten und der Rolle der Studenten. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Rektoren in diesem Prozess und untersucht die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Universität Rostock.
- Die Einführung des „Führerprinzips“ an der Universität Rostock
- Der Wandel der Hochschulpolitik von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus
- Die Rolle der Rektoren Friedrich Brunstäd und Paul Schulze in der Transformation der Universität
- Die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Struktur und den Betrieb der Universität Rostock
- Die Veränderung der Studentenrolle und der studentischen Selbstverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die Veränderungen in der Hochschulpolitik während der Weimarer Republik und der frühen Jahre des Nationalsozialismus. Sie führt die wichtigsten Akteure und Dokumente ein, die in der Arbeit untersucht werden.
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Einführung des „Führerprinzips“ an der Universität Rostock. Zuerst wird die „Brunstäd-Verfassung“ analysiert, die den Versuch einer demokratisch geprägten Satzung für die Universität darstellt. Anschließend wird die Einführung der nationalsozialistischen Satzung unter Rektor Paul Schulze beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen den beiden Satzungen und die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Organisation und den Betrieb der Universität.
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlüsse über die Transformation der Universität Rostock in der Zeit des Nationalsozialismus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen der Hochschulpolitik, Nationalsozialismus, „Führerprinzip“, Universität Rostock, Studentenrolle, Rektorat, Satzungen, Weimarer Republik, Brunstäd-Verfassung, Paul Schulze und die Transformation von Universität und Hochschulstruktur.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte der Nationalsozialismus die Universität Rostock?
Die größte Veränderung war die Einführung des „Führerprinzips“, die Abschaffung der studentischen Selbstverwaltung und die politische Gleichschaltung der Gremien.
Wer war Prof. Dr. Paul Schulze?
Er war der Rektor der Universität Rostock von 1933 bis 1936, der die Umwälzung hin zur nationalsozialistischen Hochschule maßgeblich unterstützte.
Was war der „Berliner Entwurf“?
Es war eine Sammlung von Reformvorschlägen zur Hochschulpolitik, die als Grundlage für die neue, nationalsozialistisch geprägte Satzung der Universität diente.
Wie unterschied sich die „Brunstäd-Verfassung“ von der NS-Satzung?
Friedrich Brunstäd versuchte eine demokratisch geprägte Satzung im Sinne der Weimarer Republik zu gestalten, während die spätere NS-Satzung alle Macht dem Rektor (Führerprinzip) zusprach.
Welche Rolle spielten die Studenten bei der Einführung des Führerprinzips?
Bereits im Juli 1932 beschlossen Studenten auf dem Königsberger Studententag die Einführung des Führerprinzips, was den Weg für die spätere staatliche Umsetzung ebnete.
- Arbeit zitieren
- Caroline Weißert (Autor:in), 2009, Die Universität Rostock im Wandel von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148564