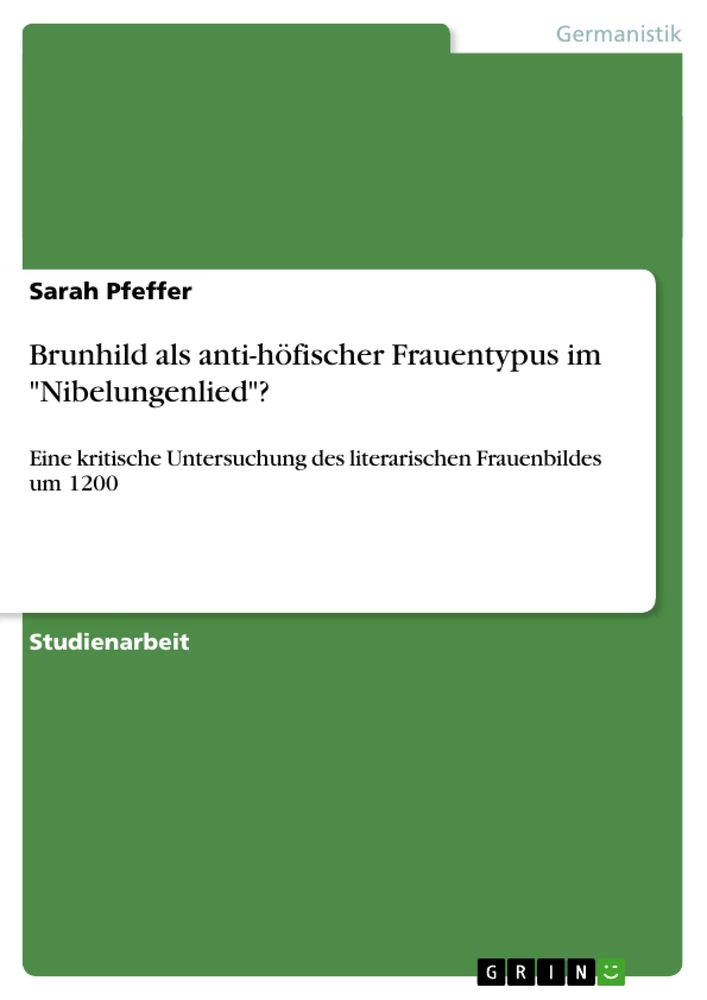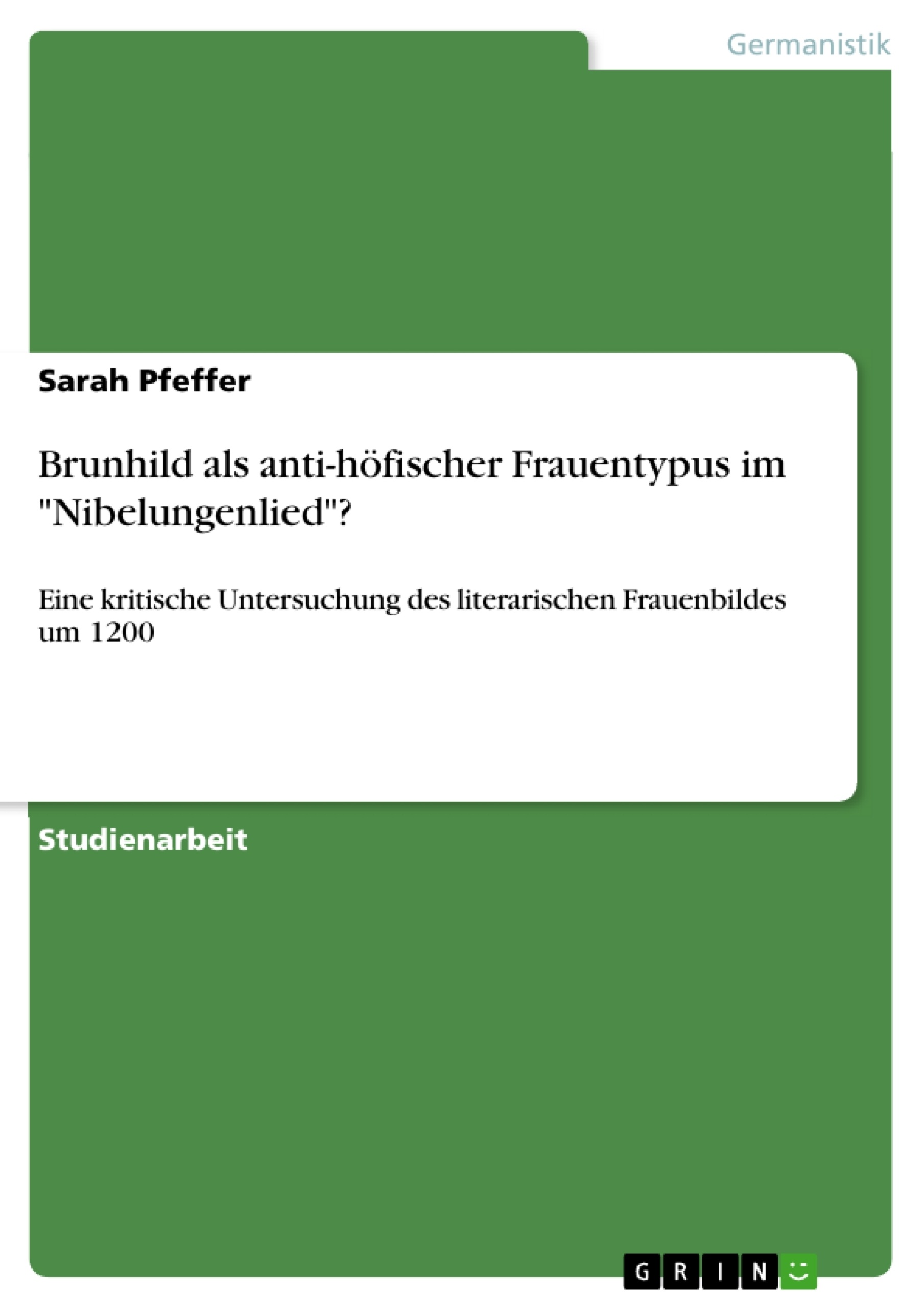Ez was ein küneginne gesezzen über sê
Ir gelîche einheine man wesse ninder mê.
Diu was unmâzen scoene, vil michel was ir kraft.
Sie scôz mit snellen degenen umbe minne den scaft.1(326)
Ein für das Mittelalter ungewöhnliches Frauenbild begegnet uns in dieser ersten
Erwähnung Brunhilds im Nibelungenlied. Scoene und kraft, höfische und
„urtümliche“2, archaische Dimensionen verbinden sich in dieser Figur und werden
im Fortlauf des Textes weiter ausdifferenziert. Autonomie und die sonst das
männliche Geschlecht charakterisierende Gewaltbereitschaft kontrastieren in dem
dargestellten Frauenbild mit der konventionellen Weiblichkeit der Literatur des
Mittelalters. Die mythischen Elemente der Brunhild aus Isenstein, ihre heroische
Kraft wirken zunächst als Bedrohung der feudalen, höfischen Weltordnung.
Ziel dieser Arbeit soll sein, diese Abweichungen der Figur Brunhilds von
gängigen Konzepten mittelalterlicher Dichtung aufzuzeigen und zu untersuchen.
Hierzu soll zunächst der Begriff hövescheit näher betrachtet und eine Annäherung
an dessen Dimensionen und Bedeutungen erreicht werden – was bedeutet überhaupt
hövescheit? Was prägt höfisches Verhalten und Hofkonzepte, wie werden diese in
Literatur verarbeitet? Inwiefern ist hövescheit im Bezug auf das Nibelungenlied
relevant, wenn in der Forschung wiederholt von höfischer Überformung der
ursprünglichen Quellen die Rede ist?
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Dimension von hövescheit
- I.1 Was bedeutet hövescheit?
- I.1.1 hövescheit als Wertekodex
- I.1.2 Das Idealkonzept der höfischen Frau um 1200
- I.2 Der Nibelungenstoff und dessen höfische Überformung
- II. Frauenbilder im Nibelungenlied
- II.1 Kriemhild – die ideal-höfische Frau?
- II.2 Brunhild der anti-höfische Frauentypus?
- II.2.2 Werbungsbedingungen und Betrug auf Isenstein
- II.2.3 Brautnacht in Worms
- II.3 Höfische Weiblichkeit als Bedrohung?
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur Brunhild im ersten Teil des Nibelungenlieds und deren Abweichung von gängigen Konzepten mittelalterlicher Frauenbilder. Sie analysiert den Begriff „hövescheit“ und dessen Bedeutung im Kontext des Nibelungenlieds, vergleicht Brunhild mit der Figur Kriemhild und beleuchtet die Frage, ob Brunhild als anti-höfischer Frauentypus dargestellt werden kann.
- Der Begriff „hövescheit“ und seine Bedeutung im Hochmittelalter
- Das Idealbild der höfischen Frau um 1200
- Vergleich der Frauenfiguren Kriemhild und Brunhild im Nibelungenlied
- Brunhilds unhöfische Charakterisierung und deren Ursachen
- Die Darstellung von höfischer Weiblichkeit als potenzielle Bedrohung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Dimension von hövescheit: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen und vielschichtigen Bedeutung des Begriffs „hövescheit“. Es untersucht die etymologischen Wurzeln des Wortes, analysiert die Schwierigkeiten seiner Übersetzung ins Neuhochdeutsche und beleuchtet dessen Bedeutung als Wertekodex im Kontext der höfischen Kultur des Hochmittelalters. Die Analyse umfasst die Einbettung von „hövescheit“ in die höfische Gesellschaft, die damit verbundenen Tugenden (wie Treue, Mäßigung und Großzügigkeit) und die Verbindung von inneren und äußeren Werten. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der höfischen Literatur bei der Vermittlung und Verbreitung dieser Ideale gewidmet.
II. Frauenbilder im Nibelungenlied: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Frauen im Nibelungenlied, insbesondere die Figuren Kriemhild und Brunhild. Es untersucht Kriemhild als Beispiel für eine ideal-höfische Frau und stellt diese im Kontrast zu Brunhilds anti-höfischem Auftreten dar. Die Analyse konzentriert sich auf Brunhilds unkonventionelle Charaktereigenschaften – ihre Stärke, Autonomie und Gewaltbereitschaft – und wie diese im Kontext der höfischen Weltordnung wirken. Die Ereignisse um Brunhilds Werbung und die Brautnacht in Worms werden als zentrale Beispiele für ihre anti-höfischen Züge analysiert.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Brunhild, Kriemhild, hövescheit, höfische Kultur, Frauenbild, Mittelalter, Anti-höfischer Frauentypus, mittelhochdeutsche Literatur, Tugenden, Hofgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Nibelungenlied und dem Begriff "hövescheit"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur Brunhild im Nibelungenlied und untersucht, inwieweit sie von den gängigen Konzepten mittelalterlicher Frauenbilder abweicht. Sie befasst sich mit dem Begriff "hövescheit" und dessen Bedeutung im Kontext des Nibelungenlieds, vergleicht Brunhild mit Kriemhild und erörtert, ob Brunhild als anti-höfischer Frauentypus betrachtet werden kann.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von "hövescheit" im Hochmittelalter, das Idealbild der höfischen Frau um 1200, einen Vergleich der Frauenfiguren Kriemhild und Brunhild, Brunhilds unhöfische Charakterisierung und deren Ursachen sowie die Darstellung höfischer Weiblichkeit als potenzielle Bedrohung.
Was ist "hövescheit" und welche Rolle spielt es in der Arbeit?
„Hövescheit“ ist ein zentraler Begriff der Arbeit. Es wird untersucht, was "hövescheit" bedeutet, welche ethischen und gesellschaftlichen Werte es umfasst und wie es sich im Kontext der höfischen Kultur des Hochmittelalters manifestiert. Die Analyse beleuchtet die Schwierigkeiten der Übersetzung ins Neuhochdeutsche und die Einbettung von „hövescheit“ in die höfische Gesellschaft, inklusive der damit verbundenen Tugenden.
Wie werden Kriemhild und Brunhild im Nibelungenlied dargestellt?
Kriemhild wird als Beispiel für eine ideal-höfische Frau dargestellt, während Brunhild als anti-höfischer Frauentypus charakterisiert wird. Die Arbeit analysiert Brunhilds unkonventionelle Eigenschaften wie Stärke, Autonomie und Gewaltbereitschaft und deren Wirkung innerhalb der höfischen Weltordnung. Die Ereignisse um Brunhilds Werbung und die Brautnacht in Worms dienen als zentrale Beispiele für ihre anti-höfischen Züge.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln. Kapitel I befasst sich mit der Bedeutung des Begriffs "hövescheit". Kapitel II analysiert die Frauenbilder im Nibelungenlied, insbesondere Kriemhild und Brunhild. Kapitel III fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Nibelungenlied, Brunhild, Kriemhild, hövescheit, höfische Kultur, Frauenbild, Mittelalter, Anti-höfischer Frauentypus, mittelhochdeutsche Literatur, Tugenden und Hofgesellschaft.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für das Nibelungenlied, mittelalterliche Literatur, Frauenbilder und die höfische Kultur interessiert. Sie eignet sich besonders für Studierende der Germanistik, Literaturwissenschaft und Geschichte.
- Citar trabajo
- Sarah Pfeffer (Autor), 2007, Brunhild als anti-höfischer Frauentypus im "Nibelungenlied"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148712