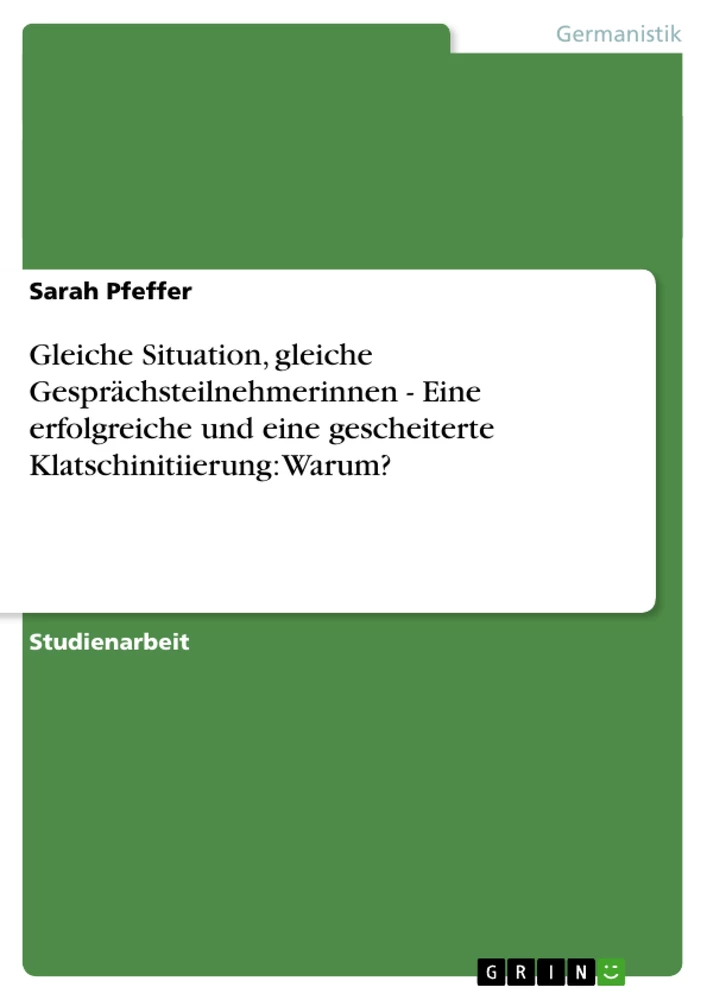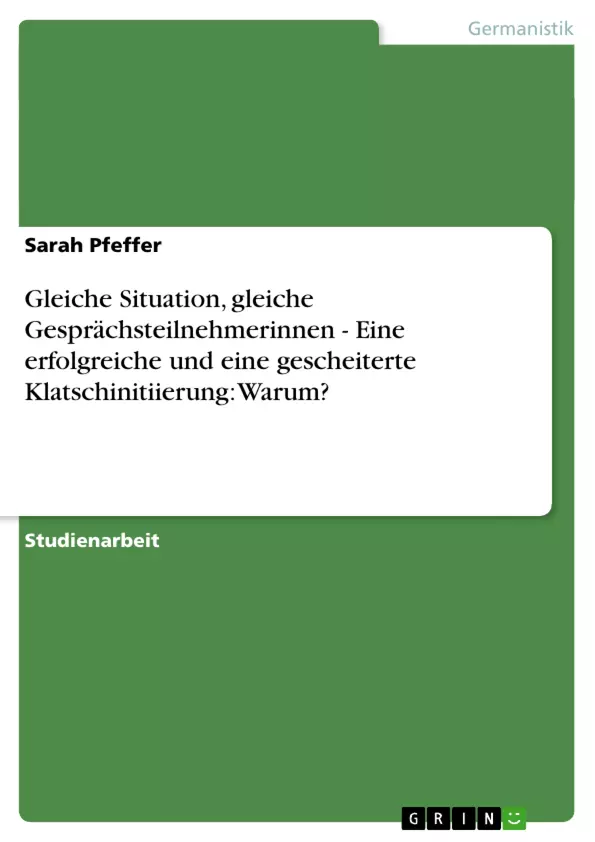Klatsch wird sozial geächtet, seine Anwendung wird als moralisch kontaminiert und die
Beschimpfung “Klatschbase” oder “Klatschweib” als soziale Diskredition empfunden.
Gleichzeitig wird im Alltag trotzdem geklatscht. Wer kennt sie nicht, die Situation:
“Sag mal, hast Du auch schon gehört...” oder “Die Frau Müller hat letzte Woche ja...”?
Bereits Aussagen wie diese implizieren, dass es klatschtypische Situationen,
Beziehungskonstellationen, Interaktionsabläufe, Themen, Instrumentarien, Initiierungen
und Beendigungen dieser Gespräche gibt, die die kommunkative Gattung Klatsch
innerhalb des kommunikativen Haushalts einer Gesellschaft beschreiben, definieren und
gegenüber anderen Gattungen abgrenzen (Luckmann 1988, 282). Luckmann bezeichnet
als kommunikative Gattung die routinisierte Antwort auf spezifische kommunikative
Probleme einer Gesellschaft: wie sollen bestimmte Ereignise, Themen oder
Sachverhalte intersubjektiv thematisiert, vermittelt und bewältigt werden und dies
erschwerend unter verschieden kontextuellen Bedingungen? Für bestimmte Probleme
existieren nach Luckmann deshalb strukturell relativ statische Lösungen, die zum
Beisipiel den Beteiligten Beziehungsmuster zuweisen, den Handlungsablauf
vorzeichnen und die Benutzung bestimmter kommunikativer Elemente und Instrumente
selektieren. Der kommunikative Haushalt wird von Luckmann als die Gesamtheit dieser
kommunikativen Gattungen innerhalb einer Gesellschaft bezeichnet.
Bisher wendeten sich wenige wissenschaftliche Untersuchungen dem Phänomen
Klatsch über die Frage zu, unter welchen Bedingungen und wie es als eine
kommunikative Gattung interaktiv generiert wird. Besonders Bergmann (1987) nähert
sich dem Klatsch jedoch unter Berücksichtigung dieser Aspekte und mithilfe
konversationsanalytischer Untersuchungen natürlicher Daten, nämlich transkribierter
Klatschgespräche. Um klatschtypische Merkmale zu bestimmen und zu überprüfen ist
es unter konversationsanalytischer Prämisse von basaler Notwendigkeit, natürliche
Daten zunächst zu gewinnen und diese auszuwerten, denn nur unter diesen
Bedingungen lassen sich zuverlässige und begründbare Aussagen über
klatschkonstituierende Elemente treffen.
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Gespräch, von dem zunächst angenommen wird, dass es ein
Klatschgespräch ist, auf Merkmale des Klatschgesprächs hin konversationsanalytisch zu
untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. ,,Felix und seine praktische Begabung"
- I.1 Die Initiierung des Gesprächs
- I.2 Die Darstellung des Klatschobjekts
- I.2.1 Das Auftreten von Zitaten und deren Funktionen
- I.2.2 Generalisierungen und der moralische Aspekt
- II. Der gescheiterte Klatschversuch – Klatschobjekt Nr.2: Felix Mutter?
- II.1 Die Initiierung
- II.2 Das Zustandekommen eines neuen Klatschgesprächs?
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Gespräch, von dem zunächst angenommen wird, dass es ein Klatschgespräch ist, auf Merkmale des Klatschgesprächs hin konversationsanalytisch zu untersuchen. Der Augenmerk liegt auf zwei dieser Klatschmerkmale und soll ihre Unverzichtbarkeit für das interaktive Herstellen von Klatsch – mitunter anhand eines gescheiterten Versuchs belegen: Klatschinitiierung und Darstellung des Klatschobjekts. Wie wird Klatsch erfolgreich eröffnet? Wie wird das Klatschobjekt dargestellt? Ein Klatschgespräch kommt im vorliegenden Gesprächausschnitt zunächst zustande. Der im Verlauf des Gesprächs auftretende Versuch einer Gesprächsteilnehmerin, ein neues Klatschobjekt einzuführen, scheitert. Was ist hier anders als zuvor? Warum klappt die Initiierung diesmal nicht?
- Analyse eines Gesprächs auf Klatschmerkmale
- Untersuchung der Klatschinitiierung
- Darstellung des Klatschobjekts
- Erfolgreiche und gescheiterte Klatschversuche
- Konversationsanalytische Untersuchung von natürlichen Daten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Klatsch ein und erläutert die Bedeutung der konversationsanalytischen Untersuchung von natürlichen Daten. Sie stellt die Zielsetzung der Arbeit vor und beschreibt den Fokus auf die Klatschinitiierung und die Darstellung des Klatschobjekts. Das erste Kapitel analysiert das Gespräch zwischen Anna und Sina, in dem Felix als Klatschobjekt eingeführt wird. Es werden die Initiierung des Gesprächs, die Darstellung von Felix und die Funktionen von Zitaten und Generalisierungen im Klatschkontext untersucht. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem gescheiterten Versuch, ein neues Klatschobjekt einzuführen. Es wird analysiert, warum die Initiierung des Klatschgesprächs in diesem Fall nicht gelingt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Klatsch, Konversationsanalyse, Klatschinitiierung, Darstellung des Klatschobjekts, gescheiterter Klatschversuch, natürliche Daten, Gesprächsanalyse, kommunikative Gattung, Interaktion, soziale Diskredition, moralische Kontamination.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine „kommunikative Gattung“ im Sinne Luckmanns?
Es handelt sich um eine routinisierte Antwort auf spezifische kommunikative Probleme einer Gesellschaft, die Handlungsabläufe und Rollenverteilungen vorgibt.
Warum wird Klatsch oft sozial geächtet?
Klatsch gilt als moralisch kontaminiert und wird mit Begriffen wie „Klatschweib“ assoziiert, was zu einer sozialen Diskreditierung der Beteiligten führen kann.
Wie wird ein Klatschgespräch erfolgreich initiiert?
Eine erfolgreiche Initiierung erfordert typische Einstiege wie „Hast du schon gehört...“, die das Interesse des Gegenübers wecken und ein gemeinsames Klatschobjekt etablieren.
Warum scheitern manche Versuche, Klatsch zu verbreiten?
Klatschversuche scheitern oft, wenn die Darstellung des Klatschobjekts nicht die notwendige moralische oder interaktive Resonanz beim Gesprächspartner findet.
Welche Rolle spielen Zitate im Klatsch?
Zitate dienen dazu, das Klatschobjekt lebendig darzustellen und die Glaubwürdigkeit der Erzählung durch scheinbar authentische Aussagen zu untermauern.
- Arbeit zitieren
- Sarah Pfeffer (Autor:in), 2007, Gleiche Situation, gleiche Gesprächsteilnehmerinnen - Eine erfolgreiche und eine gescheiterte Klatschinitiierung: Warum?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148718