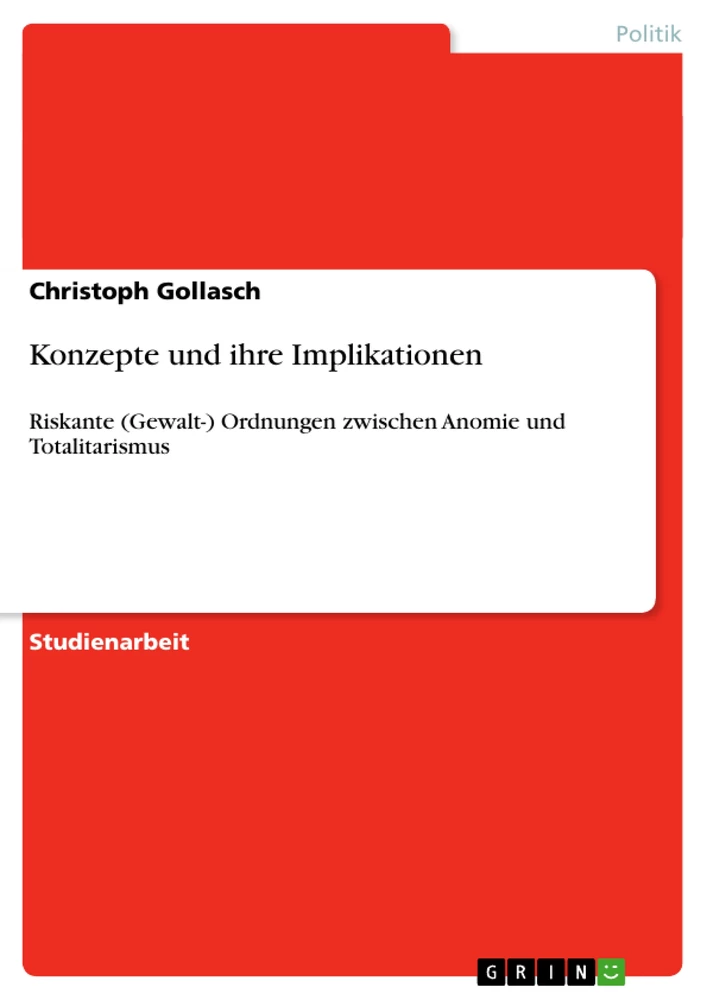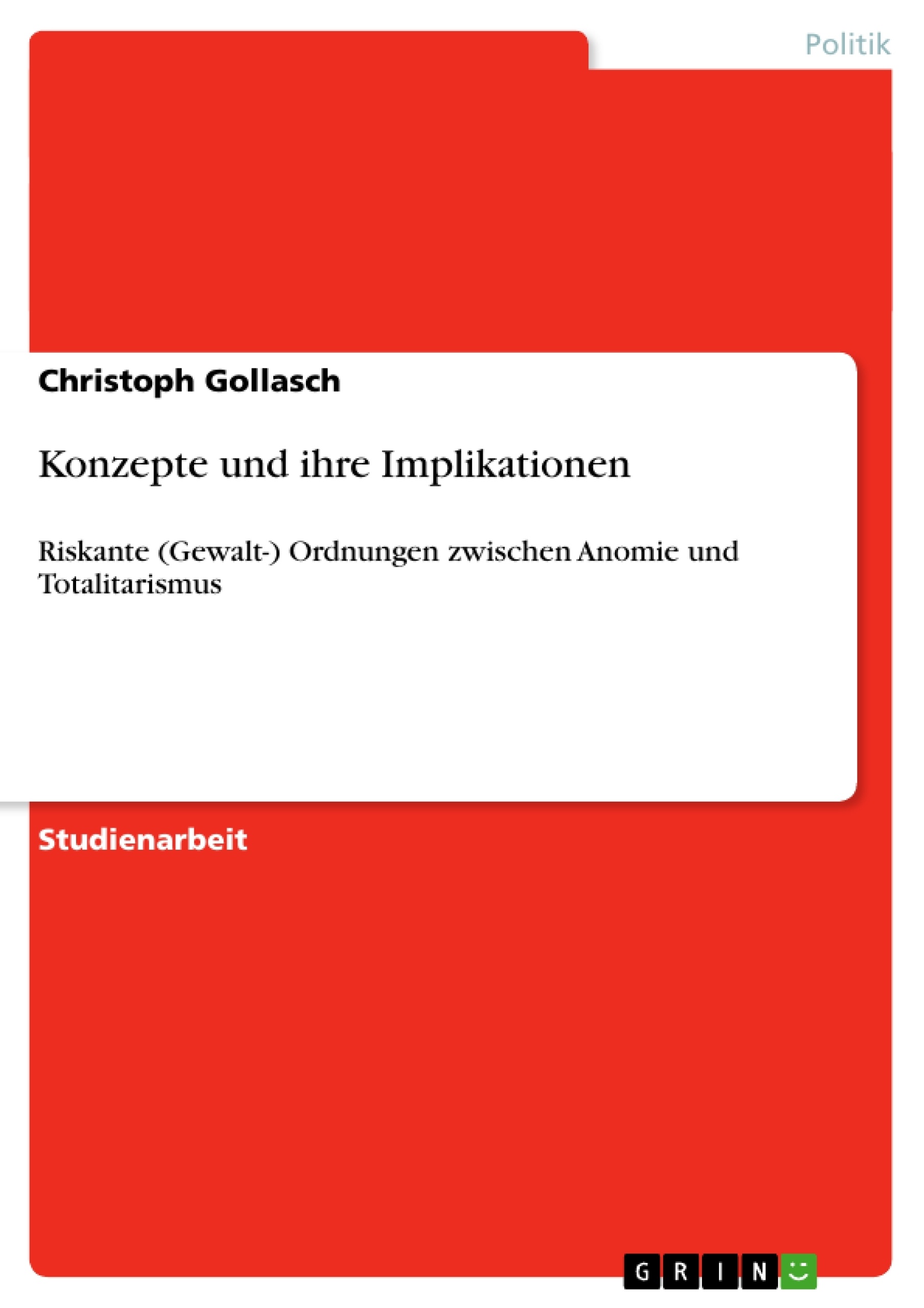‚Ordnung ist ein Teil der Welt. Ich lebe auf dem anderen Teil’, lautet ein Statement, welches an so mancher Zimmertür adoleszenter Rebellen prangert und den Eltern zu verstehen gibt, dass hier, bei Überqueren der Türschwelle, die Enklave legitimer Devianz im Elternhaus beginne. Mit dem Recht auf Eigentum, Persönlichkeit
und Eigenständigkeit erlangen Heranwachsende fundamentale Anerkennung durch die autoritäre Instanz – im gewählten Beispiel durch die Familienoberhäupter im oikos. Hält sich jene Devianz – beispielweise die Unaufgeräumtheit des eigenen Raumes – welche durch die genannten Rechte erst möglich wird, soweit im Rahmen, dass sie die grundlegende Ordnungsstruktur nicht gefährdet, wird sie vielleicht nicht
akzeptiert, zumindest aber toleriert.
Die jeweilige Ordnungsstruktur hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Werden christliche Werte im einen Elternhaus hoch geschätzt, mag das Verhalten des Kindes insbesondere dann kontrolliert werden, wenn Eltern die ‚Gefahr’ erster sexueller Erfahrungen ausmachen. Steht im anderen Elternhaus der Leistungsgedanke im Fokus, erfolgt die Intervention ins Kinderzimmer im Falle zeitintensiver– wie z.B. Fernsehen oder Computer – oder anderer hinderlicher Ablenkungen wie z.B. Drogenkonsum. Allein, die Souveränität bleibt allen Autoritäten das gemeinsame Merkmal, den unterschiedlichen Determinanten der Ordnungsstrukturen zum Trotz.
Nicht anders verhält es sich mit dem Staate, wie er im westlich-europäischen Denken existiert. In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) ist es die so genannte‚ freiheitliche demokratische Ordnung’, welche den Grad an ‚Streitbarkeit’ absteckt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISIERUNG
- Alt- und Neubackenes über Gewalt
- Ätiologische Gewaltforschung
- Soziologisch-strukturalistische Gewaltforschung
- Anomie als Spiegelbild von Veränderung und Möglichem
- DER ANOMISCHE STAAT
- Zur Abgrenzung: moderner Staat versus post-moderner Staat
- Marginalität als Strukturphänomen
- Gewaltordnung mit Unter- und Überbau
- Zwischen postmoderner Gewaltordnung und Totalitarismus
- KONKLUSION
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Begriffen „Gewalt“, „Anomie“ und „Ordnung“. Aus westlicher Perspektive werden Länder in Lateinamerika und Afrika oft als Orte wahrgenommen, die durch einen Mangel an Ordnung gekennzeichnet sind, da der Staat sein Gewaltmonopol nicht aufrechterhalten kann. Ausgehend von einer umfassenden Übersicht der wichtigsten Konzepte stellt die Arbeit verschiedene Ansätze vor, die versuchen, die Zwickmühle zu beschreiben, in der sich mehrere Länder befinden. Das Hauptargument ist, dass Gewalt, anstatt zwangsläufig mit Unordnung verbunden zu sein, neue Formen der Ordnung hervorbringt. Diese entsprechen nicht den voreingenommenen westlichen Konzepten und können daher fälschlicherweise als unordentlich angesehen werden.
- Theoretische Analyse des Begriffs „Gewalt“
- Untersuchung des Konzepts der „Anomie“ im Kontext von Gewalt und Ordnung
- Analyse des staatlichen Gewaltmonopols und seiner Herausforderungen in „anomischen“ Staaten
- Beurteilung der Entstehung neuer Ordnungsstrukturen durch Gewalt
- Kritik an westlichen Konzepten von Ordnung und Unordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Gibt es eine Gewaltordnung in „anomischen“ Staaten? Sie beleuchtet die Bedeutung von Ordnung und Devianz im Kontext von Familie und Staat und stellt die Herausforderungen des staatlichen Gewaltmonopols in „failing states“ dar.
Das Kapitel „Theoretisierung“ befasst sich mit der Definition des Begriffs „Gewalt“ und unterscheidet zwischen ätiologischer und soziologisch-strukturalistischer Gewaltforschung. Es werden verschiedene Ansätze zur Erklärung von Gewalt vorgestellt, darunter die Theorien von Thomas Hobbes und Norbert Elias.
Das Kapitel „Der anomische Staat“ analysiert die Abgrenzung zwischen modernem und post-modernem Staat und untersucht die Rolle von Marginalität als Strukturphänomen. Es beleuchtet die Entstehung einer Gewaltordnung mit Unter- und Überbau und diskutiert die Beziehung zwischen postmoderner Gewaltordnung und Totalitarismus.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gewalt, Anomie, Ordnung, Staat, Gewaltmonopol, „failing states“, Marginalität, postmoderne Gewaltordnung, Totalitarismus, westliche Konzepte von Ordnung, Latinamerika, Afrika.
- Quote paper
- Christoph Gollasch (Author), 2010, Konzepte und ihre Implikationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148791