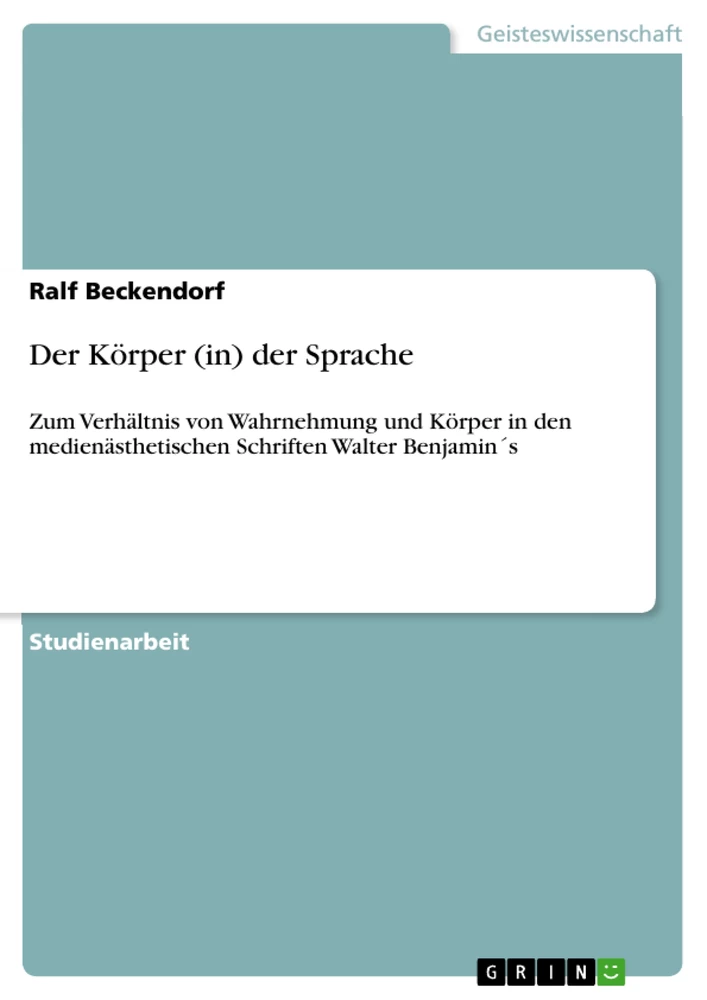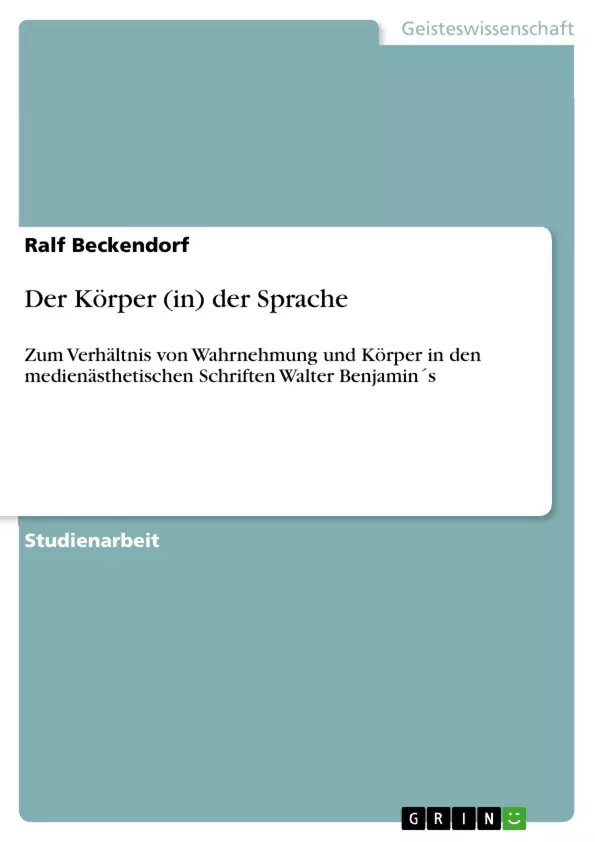Nicht nur die Realität hat sich gewandelt, sondern auch die Mittel ihrer Darstellung. Es sollte die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass es sich anders herum verhält, dass sich die Realität ihrer Darstellung angenähert hat und das die Wiedergabe von Realität, tatsächlich mehr Einfluss auf die Realität hat, als Brecht es hier vermutete. Es mag stimmen, dass sich durch den Verlust von Ideologien die Realität in gewisser Weise in Funktionalität und fragmentarische Strukturen verschoben hat, doch verhält es sich nicht auch so, dass wir in eine Wahrnehmungswelt hineingeboren werden, die diesen Umstand noch zusätzlich begünstigt? Walter Benjamin geht in seinen medien- und kunsttheoretischen Texten, die er in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts verfasste, auf diese Fragen ein. Im Mittelpunkt seiner Untersuchungen stehen dabei immer die Begriffe von Wahrnehmung und dem Körper (in) der Sprache. In dieser Arbeit wird vor allem auf den „Kunstwerkaufsatz“ Bezug genommen, in welchem Benjamin sich speziell mit dem Film und einer durch Filmrezeption veränderten Wahrnehmung auseinander setzt. [...]
Vor dem Hintergrund der Kunstrezeption erkennt Benjamin eine Wahrnehmungsentwicklung, weg von der Kontemplation, hin zur Zerstreuung und setzt dies in Zusammenhang mit einem veränderten Körperbewusstsein. Benjamin arbeitet hier mit einem bipolaren Begriffspaar, wenn er Kontemplation und Zerstreuung einander gegenüberstellt. Gleichzeitig versteht er diese Form der Rezeption auch als eine Möglichkeit und vergleicht sie etwa mit der Kunstrezeption der Architektur. Die Architektur wird ebenso in gewohnheitsmäßiger Weise wahrgenommen und nicht primär als Kunstgegenstand verstanden, sondern als etwas, das sich vor allem durch seinen Gebrauchswert definiert und auf diese Weise einen bedeutenden, obgleich unbewussten Einfluss auf unsere Wahrnehmung hat. Eine gewohnheitsmäßige Rezeption durch die Massen, löst die kontemplative Rezeption des Einzel-Kunstwerkes ab. Im Falle des Films vergleicht Benjamin diesen mit dem Theater und sieht in der Inszenierung eines Theaterstückes vor Publikum noch eine „Kunstleistung“, wohingegen der Film durch die technischen Mittel, vor allem der Montage, bestimmt ist, wodurch bereits seine Rezeption bestimmt wird. Nach Benjamins Ansicht entsteht bei der Filmrezeption eine Ohnmachtsituation, da nicht in das Geschehen, das der Wirklichkeit zum verwechseln ähnlich sieht, eingegriffen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- BENJAMIN'S KUNSTWERKAUFSATZ
- DAS ,,AURATISCHE KUNSTWERK‘
- DIE VERÄNDERTE WAHRNEHMUNG: DAS „OPTISCH-UNBEWUSSTE“.
- DAS,,MIMETISCHE VERMÖGEN“: DER KÖRPER (IN) DER SPRACHE.
- LEIB UND KÖRPER......
- SCHLUSSTEIL UND PERSPEKTIVEN
- QUELLENANGABEN
- PRIMÄRLITERATUR
- SEKUNDÄRLITERATUR..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Wahrnehmung und Körper in den medienästhetischen Schriften Walter Benjamins. Sie analysiert, wie Benjamin die Veränderungen der Wahrnehmung durch neue Medien wie Film und Fotografie beschreibt und wie diese Veränderungen mit dem Körper (in) der Sprache zusammenhängen. Die Arbeit untersucht insbesondere Benjamins Konzept des „Optisch-Unbewussten“ und seine Kritik an der „Zerstreuung“ als Form der Kunstrezeption.
- Die Auswirkungen der technischen Reproduzierbarkeit von Kunstwerken auf die Wahrnehmung
- Das Konzept des „Optisch-Unbewussten“ und seine Bedeutung für die moderne Wahrnehmung
- Die Rolle des Körpers (in) der Sprache in Benjamins medienästhetischen Schriften
- Der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Kunstrezeption und dem Körpergedächtnis
- Die Bedeutung des Films als Archiv moderner Bewegungs- und Körperkulturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und führt in die Thematik ein. Sie beleuchtet die Relevanz der Frage nach der Wiedergabe von Realität in einer Welt, die sich durch Funktionalität und Fragmentierung auszeichnet. Die Arbeit stellt Walter Benjamin als zentralen Bezugspunkt vor und erläutert seine Auseinandersetzung mit den Begriffen Wahrnehmung und Körper (in) der Sprache.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Benjamins „Kunstwerkaufsatz“ und analysiert seine Kritik an der technischen Reproduzierbarkeit von Kunstwerken. Es wird gezeigt, wie Benjamin die Veränderungen der Wahrnehmung durch den Film und die Fotografie beschreibt und das Konzept des „Optisch-Unbewussten“ einführt.
Das dritte Kapitel untersucht den Begriff des „mimetischen Vermögens“ und die Rolle des Körpers (in) der Sprache in Benjamins Schriften. Es wird gezeigt, wie Benjamin den Körper als Ort des Gedächtnisses und der kulturellen Prägung versteht und wie er die Bedeutung von Körpertechniken und Habitus für die Wahrnehmung und den Ausdruck von Realität betont.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Walter Benjamin, Medienästhetik, Wahrnehmung, Körper, Sprache, Film, Fotografie, Kunstwerk, technische Reproduzierbarkeit, Optisch-Unbewusste, Zerstreuung, Kontemplation, Körpergedächtnis, Körpertechniken, Habitus, Realität, Wiedergabe, Ausdruck.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Walter Benjamin unter dem "Optisch-Unbewussten"?
Es beschreibt Wahrnehmungsbereiche, die dem menschlichen Auge entgehen, aber durch technische Mittel wie Zeitlupe oder Großaufnahme im Film sichtbar gemacht werden.
Wie verändert der Film laut Benjamin unsere Wahrnehmung?
Benjamin beobachtet eine Entwicklung weg von der kontemplativen Versenkung des Einzelnen hin zu einer kollektiven Rezeption in der "Zerstreuung", ähnlich der Wahrnehmung von Architektur.
Welche Bedeutung hat der Körper in Benjamins Medientheorie?
Benjamin setzt Wahrnehmung in Zusammenhang mit einem veränderten Körperbewusstsein und untersucht, wie Medien als Archiv moderner Bewegungs- und Körperkulturen fungieren.
Was ist das "auratische Kunstwerk"?
Die Aura beschreibt das "Hier und Jetzt" des Originals. Benjamin argumentiert, dass durch die technische Reproduzierbarkeit (Film, Fotografie) die Aura des Kunstwerks verfällt.
Was meint Benjamin mit dem "mimetischen Vermögen"?
Es bezieht sich auf die menschliche Fähigkeit zur Nachahmung und Ähnlichkeitsproduktion, die tief im Körper und in der Sprache verwurzelt ist.
- Arbeit zitieren
- Ralf Beckendorf (Autor:in), 2009, Der Körper (in) der Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148798