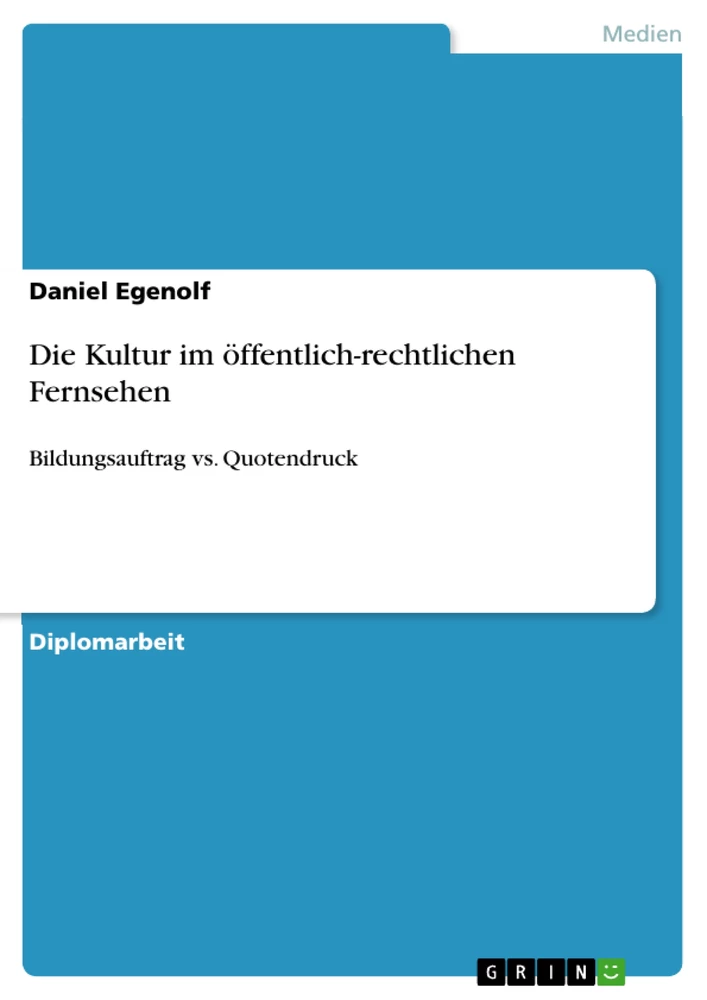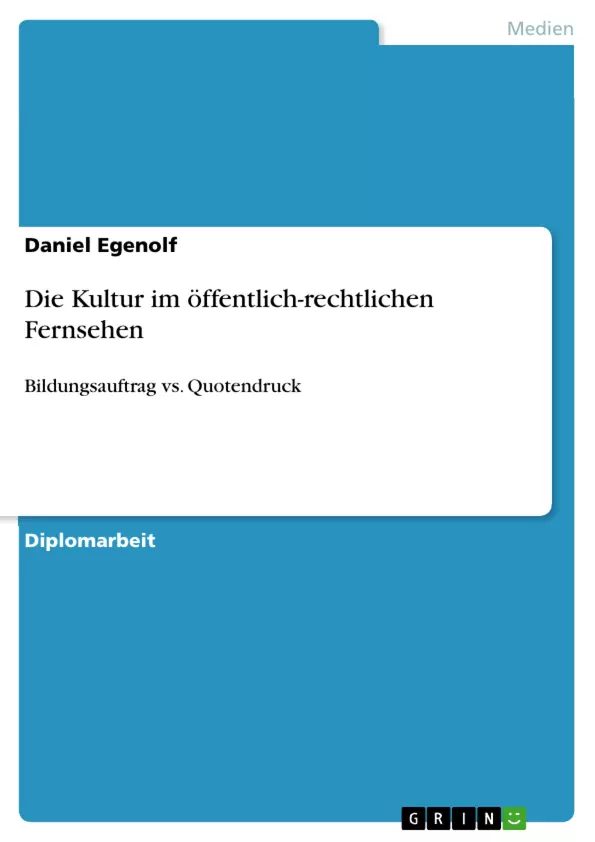Seit vielen Jahren steht das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Kritik nicht nur die Kultur im Programm immer mehr zu vernachlässigen, und damit einen wichtigen Teil seines Auftrags nicht ordnungsgemäß zu erfüllen, sondern auch aktiv und im Gleichschritt mit dem privaten Fernsehen, an einer schleichenden Verflachung der Kultur in Deutschland mitzuwirken. Darin zeigt sich sogleich die doppelte Rolle des Fernsehens allgemein: Zum einen selbst ein relevanter Teil der Gegenwartskultur der Gesellschaft zu sein, Kultur also als (noch) Leitmedium Nummer eins direkt zu gestalten, sowie im Sinne des Bildungsauftrags die Kultur zu fördern und ihr eine Bühne zu geben. Diese Arbeit soll ein kompakt abgefasstes Panorama der Vergangenheit, Gegenwart und möglichen Zukunft des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland darstellen; immer vor dem Hintergrund der bereits sehr alten Debatte um Programmqualität gegen Programmreichweite.
Ich beschreibe in Kürze die Entwicklung der Fernsehlandschaft hin zum heutigen dualen System. Dann gehe ich explizit auf die neueren Sender 3sat und arte als namentliche Kultursender im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein, da diesen Sendern heute der größte Teil der Kulturvermittlung im Fernsehen überlassen wird.
In Kapitel 3 beschäftige ich mich eingehender mit den gesetzlichen Grund- und Auflagen, die das öffentlich-rechtliche System in der Bundesrepublik Deutschland legitimieren. Außerdem beschreibe ich die Kulturinteressen des Fernsehpublikums, soweit diese darstellbar sind. In Kapitel 4 beschreibe ich konkret die verschiedenen heutigen Darstellungsformen von Kultur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und unterscheide dabei zwischen den großen Vollprogrammen Das Erste und ZDF sowie den Kultursendern 3sat und arte. Die Kulturmagazine nehmen aufgrund ihres expliziten Kulturcharakters einen überproportionalen Anteil ein, aber auch Kultur in Form von Dokumentar- und Spielfilmen und die Kulturberichterstattung als Teil von Nachrichten werden dargestellt. In Kapitel 5 gehe ich auf die massive publizistische Kritik an der Qualität des öffentlich-rechlichen Systems ein.
Auch zukünftige Entwicklungen, soweit diese absehbar sind, werden vorgestellt. Einen wichtigen Stellenwert hat hier die Legitimationsdebatte, bei der es um die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Systems in der Bevölkerung und dessen davon abhängige zukünftige Finanzierung geht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Kultur und Fernsehen
- 2.1 Der Kulturbegriff in Bezug zum Fernsehen
- 2.2 Das öffentlich-rechtliche System
- 2.3 Definition und Abgrenzung zu anderen Fernsehformen
- 2.4 Eine kurze Entstehungsgeschichte von ARD und ZDF
- 2.5 Die Entstehung der expliziten Kultursender 3sat und arte
- 2.6 Der Nutzungswandel des Fernsehens, gestern und heute
- 3 Auftrag und Ziel des öffentlich-rechtlichen Fernsehens
- 3.1 Der Grundversorgungsauftrag
- 3.2 Der Bildungs- und Kulturauftrag
- 3.3 Die Kulturinteressen des Fernsehpublikums
- 4 Kultur im Fernsehprogramm
- 4.1 Die Darstellungsformen von Kultur im Medium Fernsehen
- 4.2 Kultur auf den Kultursendern arte und 3sat
- 4.3 Die Kulturmagazine
- 4.4 Kultur in Form von Dokumentar- und Spielfilmen
- 4.5 Kultur in den Nachrichten
- 5 Boulevardisierung / Banalisierung / Qualitätsverfall?
- 5.1 Der übermächtige Einfluss der GfK-Zuschauerforschung
- 5.2 Optimierungsstrategien in der Programmplanung
- 5.3 Die fortwährende Kritik an der Programmgestaltung
- 5.4 Auflagen und Reaktionen auf die vorgebrachte Kritik
- 5.5 Die Entwicklungen im Kulturangebot an konkreten Beispielen
- 5.6 Die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ und ihre Empfehlungen
- 6 Zukunftsperspektiven
- 6.1 Der Legitimationsdruck des gebührenfinanzierten Fernsehens
- 6.2 Die zukünftige Finanzierungsform des öffentlich-rechtlichen Fernsehens
- 6.3 Online- und Interaktivitätstendenzen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kulturvermittlung
- 6.4 Die Forderungen nach einer qualitativ orientierten Erfolgsmessung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
- 6.5 Das Problem mit dem Zuschaueralter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Kultur im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen, insbesondere den Konflikt zwischen Bildungsauftrag und Quotendruck. Sie analysiert die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die verschiedenen Formen der Kulturvermittlung und die Kritik an der Programmgestaltung im Hinblick auf Boulevardisierung und Qualitätsverlust.
- Der Kulturbegriff im Kontext des Fernsehens
- Der Spagat zwischen Bildungsauftrag und Quotenmaximierung
- Die verschiedenen Darstellungsformen von Kultur im Fernsehen
- Die Auswirkungen von Zuschauerforschung auf die Programmgestaltung
- Zukunftsperspektiven des öffentlich-rechtlichen Fernsehens im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den anhaltenden Konflikt um die vermeintliche Vernachlässigung von Kultur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dessen Beitrag zur kulturellen Verflachung. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der ein umfassendes Bild der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland im Spannungsfeld von Programmqualität und -reichweite zeichnet. Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung der Fernsehlandschaft, den gesetzlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und die konkreten Ausprägungen der Kulturvermittlung im Programm.
2 Kultur und Fernsehen: Dieses Kapitel definiert den Kulturbegriff im Kontext des Fernsehens und beschreibt die Entwicklung des dualen deutschen Fernsehsystems. Es beleuchtet die Entstehung und Rolle der Kultursender 3sat und arte und analysiert den Wandel der Fernsehnutzung. Die verschiedenen Aspekte des Begriffs „Kultur“ im Fernsehen werden erörtert, einschließlich der Herausforderungen der Definition und Abgrenzung zu anderen Fernsehformaten. Die Entstehungsgeschichte von ARD und ZDF wird kurz skizziert, um den historischen Kontext zu beleuchten.
3 Auftrag und Ziel des öffentlich-rechtlichen Fernsehens: Kapitel 3 befasst sich ausführlich mit den rechtlichen Grundlagen und dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland, insbesondere mit dem Grundversorgungs- und dem Bildungs- und Kulturauftrag. Es untersucht die Kulturinteressen des Fernsehpublikums, soweit diese messbar und analysierbar sind. Der Schwerpunkt liegt auf der Legitimation des öffentlich-rechtlichen Systems und dessen Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft.
4 Kultur im Fernsehprogramm: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Formen der Kulturvermittlung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es differenziert zwischen den Vollprogrammen ARD und ZDF sowie den Kultursendern arte und 3sat, untersucht Kulturmagazine, Dokumentationen, Spielfilme und die Behandlung von Kulturthemen in Nachrichtensendungen. Die verschiedenen Darstellungsweisen von Kultur im Medium Fernsehen werden detailliert beschrieben und verglichen.
5 Boulevardisierung / Banalisierung / Qualitätsverfall?: Kapitel 5 befasst sich kritisch mit dem Vorwurf der Boulevardisierung, Banalisierung und des Qualitätsverlusts im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es analysiert den Einfluss der Zuschauerforschung (GfK), die Strategien der Programmplanung und die Reaktionen auf die Kritik an der Programmgestaltung. Konkrete Beispiele aus dem Kulturangebot verdeutlichen die Entwicklungen und die Bemühungen um eine Verbesserung der Situation. Die Empfehlungen der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ werden eingeordnet und diskutiert.
Schlüsselwörter
Öffentlich-rechtliches Fernsehen, Kultur, Bildungsauftrag, Quotendruck, Programmqualität, Zuschauerforschung, Kultursender, ARD, ZDF, 3sat, arte, Boulevardisierung, Qualitätsverfall, Medienlandschaft, Kulturvermittlung, Finanzierung, Zukunftsperspektiven.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Rolle von Kultur im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Kultur im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen, insbesondere den Konflikt zwischen dem Bildungsauftrag und dem Quotendruck. Analysiert werden die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, verschiedene Formen der Kulturvermittlung und Kritik an der Programmgestaltung hinsichtlich Boulevardisierung und Qualitätsverlust.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Kulturbegriff im Kontext des Fernsehens, den Spagat zwischen Bildungsauftrag und Quotenmaximierung, verschiedene Darstellungsformen von Kultur im Fernsehen, die Auswirkungen der Zuschauerforschung auf die Programmgestaltung und Zukunftsperspektiven des öffentlich-rechtlichen Fernsehens im digitalen Zeitalter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt den Konflikt um die vermeintliche Vernachlässigung von Kultur im Fernsehen. Kapitel 2 (Kultur und Fernsehen) definiert den Kulturbegriff und beschreibt die Entwicklung des deutschen Fernsehsystems, inklusive der Kultursender 3sat und arte. Kapitel 3 (Auftrag und Ziel des öffentlich-rechtlichen Fernsehens) befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen und dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Kapitel 4 (Kultur im Fernsehprogramm) analysiert die konkreten Formen der Kulturvermittlung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Kapitel 5 (Boulevardisierung / Banalisierung / Qualitätsverfall?) befasst sich kritisch mit dem Vorwurf des Qualitätsverlusts und analysiert den Einfluss der Zuschauerforschung. Kapitel 6 (Zukunftsperspektiven) diskutiert die zukünftige Finanzierung und die Herausforderungen im digitalen Zeitalter.
Welche Sender werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF, 3sat und arte und analysiert deren Rolle in der Kulturvermittlung.
Welche Rolle spielt die Zuschauerforschung (GfK)?
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Zuschauerforschung (GfK) auf die Programmplanung und die damit verbundenen Strategien zur Quotenmaximierung, und deren Auswirkungen auf die Programmqualität und den Kulturanteil im Programm.
Welche Kritikpunkte werden an das öffentlich-rechtliche Fernsehen gerichtet?
Die Arbeit analysiert die Kritik an der Programmgestaltung, insbesondere die Vorwürfe der Boulevardisierung, Banalisierung und des Qualitätsverlusts im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Wie werden die Zukunftsperspektiven des öffentlich-rechtlichen Fernsehens eingeschätzt?
Die Arbeit diskutiert die Zukunftsperspektiven des öffentlich-rechtlichen Fernsehens im Hinblick auf die Finanzierung, die Digitalisierung und die Notwendigkeit einer qualitativ orientierten Erfolgsmessung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Öffentlich-rechtliches Fernsehen, Kultur, Bildungsauftrag, Quotendruck, Programmqualität, Zuschauerforschung, Kultursender, ARD, ZDF, 3sat, arte, Boulevardisierung, Qualitätsverfall, Medienlandschaft, Kulturvermittlung, Finanzierung, Zukunftsperspektiven.
- Quote paper
- Daniel Egenolf (Author), 2009, Die Kultur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148805