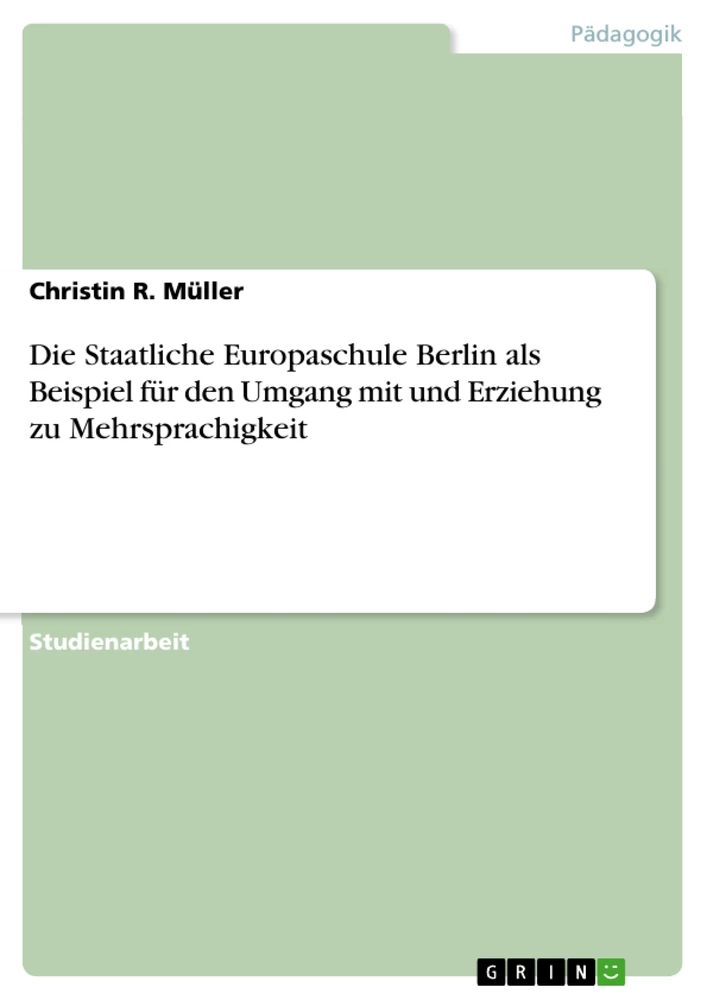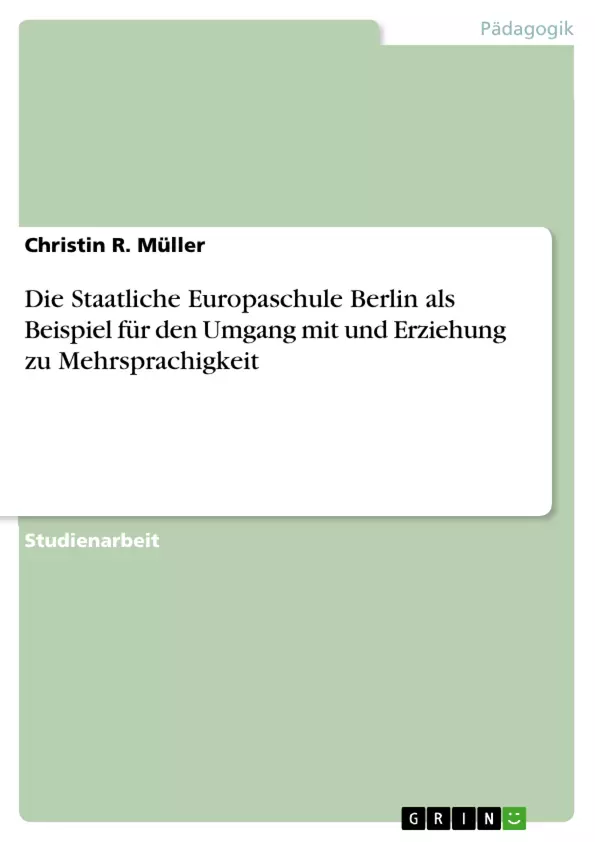Innerhalb der Europäischen Union leben circa 175 Nationalitäten, was eine ungemein große sprachliche und kulturelle Vielfalt bedingt. Die EU reagiert darauf mit der Forderung nach M+2 als Beitrag zum interkulturellen Dialog, zum sozialen Zusammenhalt, zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit und zu umfangreichen Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bürger der EU. (vgl. Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber auch gemeinsame Verpflichtung)
Durch den dadurch wachsenden Bedarf an Fremdsprachen werden diese zu elementaren Kulturtechniken und die individuelle Mehrsprachigkeit wird zur zentralen Aufgabe für Ausbildung, Beschäftigung, kulturellen Austausch und die per- sönliche Entfaltung des Einzelnen. (vgl. Zydatiß 2000, S. 152 ff.)
Bedingt durch den Globalisierungsprozess und anwachsende Migrationsströme entstehen internationale Kooperationen und der Arbeitsmarkt wird räumlich entgrenzt. Sprachenkenntnisse und das Verständnis für fremde Kulturen werden da- mit zu unerlässlichen Kompetenzen. (vgl. Schiersmann 2008, S. 19 f.)
Weiterhin werden durch die demografische Entwicklung und sich verändernde Familienstrukturen vorhandene Humanressourcen knapp. Das heißt, dass vorhandene Ressourcen effektiver genutzt werden müssen. Damit wird Bildung die Voraussetzung für Beschäftigung und somit auch für den Wohlstand der EU. (vgl. Mattern/Münk 2008, S.19 ff.)
Die Bundesregierung sieht die kulturelle und sprachliche Vielfalt als selbstverständlichen Teil der deutschen Schule an. Eine Erziehung zu Mehrsprachigkeit sollte deshalb der Auftrag an die deutsche Schule sein. Europaschulen können für die Erfüllung dieser Aufgabe gute Hinweise geben. (vgl. Mehrsprachigkeit an deutschen Schulen 2001, S. 38 ff.)
Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit der Forderung nach Mehrsprachigkeit im europäischen Rahmen und versucht zu zeigen, dass die Europaschulen eine geeignete Möglichkeit sind, diese Forderung zu erfüllen.
Dazu werden zunächst die zentralen Begriffe Mehrsprachigkeit und Europaschule erläutert. Daran anschließend erfolgt die Herleitung der forschungsleitenden Fragestellung. Informationen über die SESB, der Europaschule zugrunde liegende Sprachlernkonzepte, den Unterricht sowie über außerunterrichtliche Programme werden gegeben. Im Anschluss daran werden einige kritische Punkte der Europa- schule benannt. Zum Schluss werden die Forschungsfrage beantwortet und eine Zusammenfassung der Arbeit gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition der zentralen Begriffe
- 2.1 Definition Europaschule
- 2.2 Definition Mehrsprachigkeit
- 3. Herleitung der Forschungsfrage
- 4. SESB als Beispiel in Berlin
- 4.1 Konzepte
- 4.2 Unterricht und Lehrer
- 4.3 Außerunterrichtliche Programme
- 4.4 Kritik
- 5. Beantwortung der Forschungsfrage
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Staatliche Europaschule Berlin (SESB) als Beispiel für den Umgang mit und die Erziehung zu Mehrsprachigkeit im Kontext der europäischen Bildungslandschaft. Ziel ist es, die Eignung von Europaschulen zur Erfüllung des wachsenden Bedarfs an Mehrsprachigkeit in einer zunehmend globalisierten Welt zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Europaschulen und Mehrsprachigkeit
- Konzepte und Praktiken der SESB im Umgang mit Mehrsprachigkeit
- Analyse des Unterrichts und der Lehrerrolle an der SESB
- Bewertung außerunterrichtlicher Programme zur Förderung der Mehrsprachigkeit
- Kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Limitationen des Europaschulmodells
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Mehrsprachigkeit im europäischen Kontext ein und verdeutlicht die wachsende Bedeutung von Sprachkompetenz in einer globalisierten Welt. Sie begründet die Relevanz von Europaschulen als mögliche Lösungsansätze für die Förderung von Mehrsprachigkeit und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage, inwieweit Europaschulen, wie die SESB, die Forderung nach Mehrsprachigkeit erfüllen können. Die zunehmende sprachliche und kulturelle Vielfalt innerhalb der EU und die damit verbundenen Herausforderungen für Bildung und Arbeitsmarkt bilden den Ausgangspunkt der Argumentation.
2. Definition der zentralen Begriffe: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der zentralen Begriffe "Europaschule" und "Mehrsprachigkeit". Es differenziert zwischen "echten" und "unechten" Europaschulen, wobei die Arbeit sich auf letztere konzentriert. Die Definition von Mehrsprachigkeit beleuchtet den Wandel von der früheren Einsprachigkeitsideologie hin zu einer Anerkennung der sprachlichen Vielfalt als Bereicherung. Das Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der zentralen Konzepte und dient als Basis für die anschließende Analyse der SESB.
4. SESB als Beispiel in Berlin: Dieses Kapitel analysiert die Staatliche Europaschule Berlin (SESB) als Fallbeispiel. Es beleuchtet die an der Schule implementierten Sprachlernkonzepte, die Unterrichtsmethoden und die Rolle der Lehrkräfte im Umgang mit Mehrsprachigkeit. Darüber hinaus werden außerunterrichtliche Programme, die die Mehrsprachigkeit fördern, vorgestellt und kritisch evaluiert. Die verschiedenen Aspekte des Schulalltags werden untersucht, um ein umfassendes Bild des Umgangs mit Mehrsprachigkeit an dieser Schule zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Europaschule, Staatliche Europaschule Berlin (SESB), interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Bilingualität, Sprachlernen, europäische Bildung, Globalisierung, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Analyse der Staatlichen Europaschule Berlin (SESB)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Staatliche Europaschule Berlin (SESB) als Beispiel für den Umgang mit und die Erziehung zu Mehrsprachigkeit im Kontext der europäischen Bildungslandschaft. Sie untersucht die Eignung von Europaschulen, den wachsenden Bedarf an Mehrsprachigkeit in einer globalisierten Welt zu erfüllen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Europaschulen und Mehrsprachigkeit; Konzepte und Praktiken der SESB im Umgang mit Mehrsprachigkeit; Analyse des Unterrichts und der Lehrerrolle an der SESB; Bewertung außerunterrichtlicher Programme zur Förderung der Mehrsprachigkeit; Kritische Auseinandersetzung mit Herausforderungen und Limitationen des Europaschulmodells.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition der zentralen Begriffe (Europaschule und Mehrsprachigkeit), Herleitung der Forschungsfrage, SESB als Beispiel in Berlin (Konzepte, Unterricht und Lehrer, Außerunterrichtliche Programme, Kritik), Beantwortung der Forschungsfrage, Zusammenfassung und Ausblick.
Was sind die zentralen Begriffe und wie werden sie definiert?
Die zentralen Begriffe sind "Europaschule" und "Mehrsprachigkeit". Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Arten von Europaschulen und liefert eine genaue Definition von Mehrsprachigkeit, die den Wandel von der Einsprachigkeitsideologie hin zur Anerkennung sprachlicher Vielfalt als Bereicherung berücksichtigt.
Wie wird die SESB in der Arbeit analysiert?
Die SESB wird als Fallbeispiel analysiert, indem die an der Schule implementierten Sprachlernkonzepte, Unterrichtsmethoden, die Rolle der Lehrkräfte, außerunterrichtliche Programme und kritische Aspekte beleuchtet werden. Ziel ist ein umfassendes Bild des Umgangs mit Mehrsprachigkeit an dieser Schule.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit beantwortet die Forschungsfrage, inwieweit Europaschulen wie die SESB die Forderung nach Mehrsprachigkeit erfüllen können. Die Zusammenfassung und der Ausblick liefern eine Bewertung der Ergebnisse und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, Europaschule, Staatliche Europaschule Berlin (SESB), interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Bilingualität, Sprachlernen, europäische Bildung, Globalisierung, Integration.
- Quote paper
- Christin R. Müller (Author), 2009, Die Staatliche Europaschule Berlin als Beispiel für den Umgang mit und Erziehung zu Mehrsprachigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148864