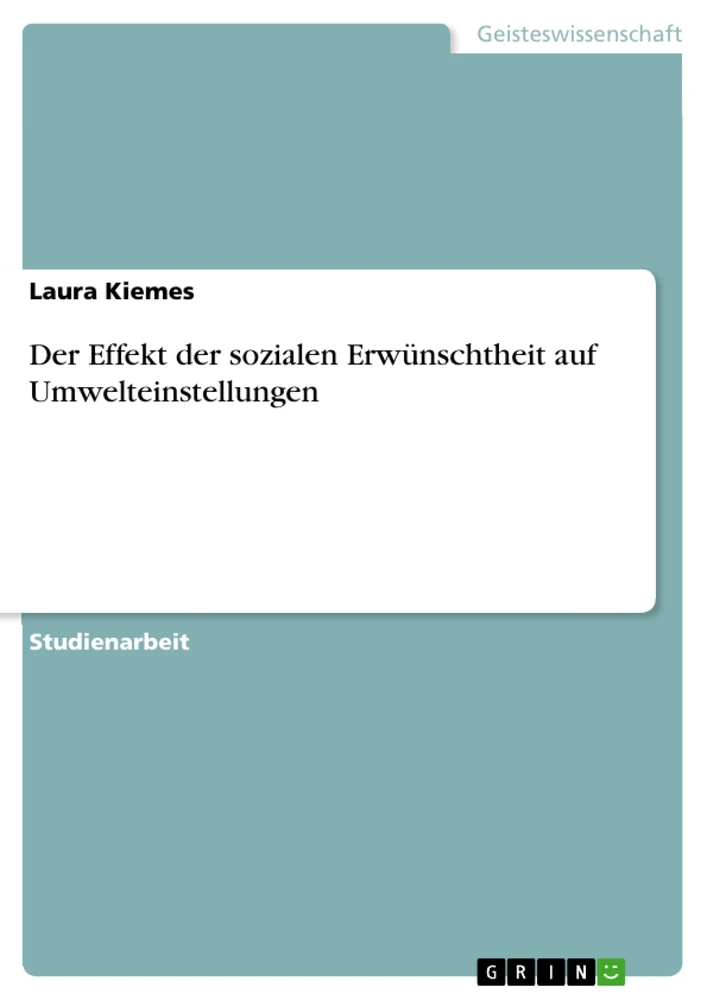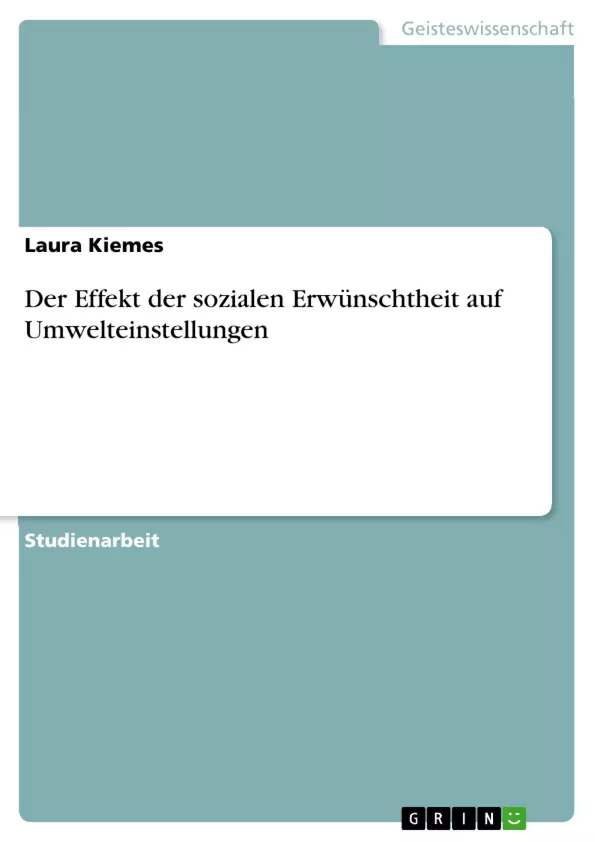Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der sozialen Erwünschtheit auf geäußerte Umwelteinstellungen. Im weiteren Verlauf werden das Konzept der sozialen Erwünschtheit, eine theoretische Herleitung sowie Methoden zur praktischen Bewältigung von sozialer Erwünschtheit erörtert und anhand ausgewählter Studien veranschaulicht.
Ob es um Corona-Todesfälle, den Klimawandel oder das Verstehen eines simplen Graphen in einer Zeitung geht – ein gewisses statistisches Grundverständnis ist für die fundierte Meinungsbildung heutzutage essenziell. Dies gilt insbesondere für Sozialforscher*innen. Von diesen wird nicht nur eine transparente Präsentation von Ergebnissen erwartet, sondern auch die Messung von sozialen Phänomenen muss wissenschaftlichen Standards entsprechen. Speziell die Ungenauigkeit von Messungen stellt in diesem Kontext eine große Herausforderung dar. In einer Befragung geäußerte Antworten sowie deren Interpretation können von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden. Aus diesem Grund sind Ergebnisse von aus Umfragen hervorgehenden Statistiken möglicherweise von Unsicherheiten behaftet. Um die Richtigkeit von Forschungsergebnissen zu gewährleisten, ist demnach ein tiefgreifendes Verständnis der Messung von entscheidender Bedeutung.
Die Problematik vertieft sich weiter, wenn es um das Erfragen sensibler oder polarisierender Themen geht. Da Umwelteinstellungen eng mit persönlichen Überzeugungen, Verhaltensweisen und politischen Geschehen verbunden sind, fallen diese ebenfalls unter die Kategorie sensible Themen, die soziale Erwünschtheit begünstigen. Um möglichst wahrheitsgetreue Antworten zu erhalten, müssen vor dem Befragen von Individuen zu Umwelteinstellungen einige messmethodische Überlegungen getroffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Rahmen und Forschungsstand
- 2.1 Konzept der sozialen Erwünschtheit
- 2.2 Theorie zur sozialen Erwünschtheit
- 2.3 Umgang mit sozialer Erwünschtheit
- 2.3.1 Ex-post
- 2.3.2 Fragformülierüng ünd Fragekontext
- 2.3.3 Interviewende ünd Bystander
- 2.3.4 Befragüngsmodüs
- 2.3.5 Befragüngstechniken
- 3 Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis V
Abkürzungsverzeichnis
- ACASI
- Audio-enhanced Computer Assisted Self-Interviewing
- CAPI
- Computer Assisted Personal Interviewing
- CASI
- Computer Assisted Self-Interviewing
- CATI
- Computer Assisted Telephone Interviewing
- CAWI
- Computer Assisted Web Interviewing
- ICT
- Item-Count-Technik
- PAPI
- Paper-and-Pencil Interviewing
- RC-Theorie
- Rational-Choice-Theorie
- SAQ
- Paper-and-Pencil Self-Administered Questionnaires
- SET
- Sealed-Envelope-Technique
- SEU-Theorie
- Subjektive Erwartungsnutzentheorie
- T-ACASI
- Telephone Audio-enhanced Computer Assisted Self-Interviewing
1 Einleitung
„Saatistiken lügen selbst nicht, sie lassen zumeist nur lügen.“1
Ob es um Corona-Todesfalle, den Klimawandel oder das Verstehen eines simplen Graphen in einer Zeitung geht - ein gewisses statistisches Grundverständnis ist für die fundierte Meinungsbildung heutzutage essenziell (Rohwedder, 2021, Reveland et al., 2023). Dies gilt insbesondere fuür Sozialforscher*innen. Von diesen wird nicht nur eine transparente Prüasentation von Ergebnissen erwartet, sondern auch die Messung von sozialen Phüanomenen muss wissenschaftlichen Standards entsprechen. Speziell die Ungenauigkeit von Messungen stellt in diesem Kontext eine große Herausforderung dar. In einer Befragung geaüußerte Antworten sowie deren Interpretation küonnen von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden. Aus diesem Grund sind Ergebnisse von aus Umfragen hervorgehenden Statistiken müoglicherweise von Unsicherheiten behaftet. Um die Richtigkeit von Forschungsergebnissen zu gewüahrleisten, ist demnach ein tiefgreifendes Verstüandnis der Messung von entscheidender Bedeutung.
Bei Messeinheiten der Sozialforschung füallt das Konzept der Reaktivitaüt2besonders stark auf. Befindet sich ein Mensch in einer unnatuürlich anmutenden Befragungssituation, kann er dazu neigen, Antworten unbewusst oder bewusst zu modifizieren. Müoglicherweise fuühlt sich die befragte Person sozial akzeptierter, wenn sie eine Antwort gibt, die nicht ihrer wahren Meinung entspricht. Bei diesem Phüanomen handelt es sich um diesoziale Erwüunschtheit. Da es sich hierbei um eine der haüufigsten Ursachen fuür Verzerrungen in Umfragedaten handelt, gilt es vor allem bei Befragungen zu Verhaltensweisen und Einstellungen das Auftreten sozialer Erwuünschtheit zu beruücksichtigen und so weit wie moüglich zu verhindern. Trotz der existierenden Methodologie zu diesem Phaünomen ist es bis heute nicht abschließend geklaürt, ob die Verzerrung wahrscheinlich ist und wie mit ihr am besten umgegangen werden soll (Blair et al., 2020, 1297).
Die Problematik vertieft sich weiter, wenn es um das Erfragen sensibler oder polarisierender Themen geht. Da Umwelteinstellungen eng mit persüonlichen Uü berzeugungen, Verhaltensweisen und politischen Geschehen verbunden sind, fallen diese ebenfalls unter die Kategorie sensible Themen, die soziale Erwuünschtheit beguünstigen (Blasius, 1998, 19f ). Um moüglichst wahrheitsgetreue Antworten zu erhalten, muüssen vor dem Befragen von Individuen zu Umwelteinstellungen einige messmethodische Uü berlegungen getroffen werden.
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der sozialen Erwuünschtheit auf geüaußerte Umwelteinstellungen. Im weiteren Verlauf werden das Konzept der sozialen Erwuünschtheit, eine theoretische Herleitung sowie Methoden zur praktischen Bewüaltigung von sozialer Erwünschtheit erörtert und anhand ausgewählter Studien veranschaulicht.
2 Theoretischer Rahmen und Forschungsstand
Um soziale Phöanomene zu erforschen, ist es zunöachst erforderlich, grundlegende Begriffe und Erklaörungsmechanismen genau zu definieren.
3 Fazit und Ausblick
Die soziale Erwuänschtheit bezieht sich auf ein Phaänomen, das in Befragunssituationen auftritt. Hierbei neigen Menschen dazu, Antworten zu geben, die gesellschaftlich akzeptiert oder positiv bewertet werden, selbst wenn diese Antworten nicht mit ihren wahren Ansichten uäbereinstimmen. In Umweltsurveys fuührt dies dazu, dass sich Befragte umweltfreundlicher äaußern, als sie tatsäachlich sind, um der sozialen Norm des Umweltbewusstseins zu entsprechen.
Diese Arbeit zeigt, dass Studien zu Umweltthematiken durch sozial erwuänschtes Antwortverhalten verzerrt sein koännen. Trotz der geringen Anzahl an Studien, die soziale Erwuänschtheit im Kontext von Umwelteinstellungen untersuchen, scheint es trotzdem einen Zusammenhang zwischen den beiden Gräoßen zu geben. Besonders aufschlussreich ist dabei die zuvor diskutierte Studie von Beiser-McGrath und Bernauer (2021). Laut dieser verheimlichen rund 10 % der direkt Befragten umweltfeindliche Einstellungen. Dieser Anteil aäußert seine tatsäachlichen Ansichten erst dann, wenn ein häoherer Grad an Anony- mitaät gewaährleistet wird. Hieraus laässt sich schließen, dass ein nicht zu vernachlaässigender Anteil an Befragten aufgrund sozial erwünschten Antwortverhaltens nicht wahrheitsgemäße Antworten gibt. Somit werden Befragungen zum Thema Umwelteinstellungen durch soziale Erwuünschtheit zu einem gewissen Grad verfüalscht.
Um trotz dieser Herausforderung weiterhin qualitativ hochwertige Befragungsergebnisse zu erhalten, ist es entscheidend, ein müogliches Auftreten von sozial erwuünschtem Antwortverhalten im Rahmen einer Befragung zu Umweltthematiken zu beruücksichtigen oder diesem vorzubeugen. Um die Verzerrung durch soziale Erwuünschtheit zu minimieren, eignen sich eine Vielzahl an methodischen Vorgehensweisen. Diese beinhalten Methoden der Frageformulierung, den Fragekontext, Interviewende und Bystander, Befragungsmodi sowie spezielle Befragungstechniken. Diese Methoden unterscheiden sich hinsichtlich ihres Ansatzes, ihres Implementierungsaufwands und ihrer Kosten. So sind vor allem Verfahren, die Ausbildung und Anwesenheit von Personen erfordern, zeit- und kostenintensiv. Das jeweilige Forschungsinteresse sowie der gegebene finanzielle Rahmen sind entscheidend fuür die Wahl der zu verwendenden Methoden bei einem Forschungsvorhaben.
Bislang existieren noch wenig Studien uüber den Zusammenhang zwischen sozialer Erwuünschtheit und Umwelteinstellungen. Insbesondere der Einfluss von Interviewenden und Bystandern sowie der Effekt von Befragungsmodi in Umweltsurveys ist bislang wenig erforscht. Zudem thematisiert diese Arbeit lediglich soziale Erwuünschtheit im Kontext von Umwelteinstellungen. Müogliche Drittvariableneffekte wie Geschlecht, Alter oder Bildung haütten den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und wurden entsprechend außen vor gelassen. Insgesamt handelt es sich bei der Verzerrung durch soziale Erwuünschtheit um ein umfangreiches wie relevantes Thema. Aus diesem Grund ist weitere Forschung fuür die Sozialwissenschaften noütig, um moüglichst valide Forschungsergebnisse zu erhalten.
Literaturverzeichnis
- Becker, R. (2006). Selective Response to Questions on Delinquency,Quality and Quantity40(4): 483-498.
- Becker, R. (2014). Delinquenz als soziales Handeln: Eine erweiterte Modellierung und empirische Überprüfung,Soziale Weltpp. 373-397.
- Beiser-McGrath, L. F. und Bernauer, T. (2021). Current surveys may underestimate climate change skepticism evidence from list experiments in Germany and the ÜSA,Plos one16(7): e0251034.
- Blair, G., Coppock, A. und Moor, M. (2020). When to Worry about Sensitivity Bias: A Social Reference Theory and Evidence from 30 Years of List Experiments,American Political Science Review114(4): 1297-1315.
- Blasius, J. (1998). Zur Messung von Ümweltverhalten,Umwelt und empirische Sozial-und Wirtschaftsforschung. Berlin: Duncker & Humblot.
- Bogner, K. und Landrock, Ü. (2015). GESIS Survey Guidelines: Antworttendenzen in standardisierten Ümfragen, pp. 1-15.
- Bradburn, N. M., Sudman, S. und Wansink, B. (2004a). Aksing Questions About Attitudes and Bevarioral Intentions,Asking Questions: The Definitive Guide toQuestionnaire Design-for Market Research, Political Polls, and Social and HealthQuestionnaires, John Wiley & Sons, pp. 117-150.
- Bradburn, N. M., Sudman, S. und Wansink, B. (2004b). Asking and Recording Open- Ended and Closed-Ended Questions,Asking Questions: The Definitive Guide toQuestionnaire Design-for Market Research, Political Polls, and Social and HealthQuestionnaires, John Wiley & Sons, pp. 151-178.
- Diekmann, A. (2008).Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen, 18 edn, Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, Reinbek bei Hamburg.
- Duden (n.d.). Leugnen, https://www.duden.de/rechtschreibung/leugnen.
- Esser, H. (2002).Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 4, Opportunitäten und Restriktionen, Vol. 4, Campus Verlag, Frankfurt am Main.
- Grimm, P. (2010). Social desirability bias,Wiley international encyclopedia of marketing.
- Kreuter, F., Presser, S. und Tourangeau, R. (2008). Social desirability bias in cati, ivr, and web surveysthe effects of mode and question sensitivity,Public opinion quarterly72(5): 847-865.
- Krosnick, J. A. und Presser, S. (2010). Question and questionnaire design. Handbook of Survey Research,Education Emerald, London.
- Krumpal, I. (2013). Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: A literature review,QUALITY &QUANTITY47(4): 2025-2047.
- Lischewski, J. (2015). Soziale Erwünschtheit im Licht des Rational-Choice Ansatzes.
- Loureiro, M. L. und Lotade, J. (2005). Interviewer Effects on the Valuation of Goods with Ethical and Environmental Attributes,Environmental and Resource Economics30(1): 49-72.
- Nederhof, A. J. (1985). Methods of coping with social desirability bias: A review,European Journal of Social Psychology15(3): 263-280.
- Neugebauer, B. (2004). Die Erfassung von Umweltbewusstsein und Umweltverhalten.
- Noack, E. M., Rovers, A.-K., Kühling, L. und Marggraf, R. (2016). Was Menschen bewegt, Lebensmittel aus dem Müll zu holen: Eine explorative Studie zum Containern, pp. 1-12.
- Oerke, B. und Bogner, F. X. (2013). Social Desirability, Environmental Attitudes, and General Ecological Behaviour in Children,International Journal of Science Education35(5): 713-730.
- Reinecke, J. (1991). Interviewereffekte und soziale Erwuünschtheit. Theorie, Modell und empirische Ergebnisse,Journal für Sozialforschung31(3): 293-320.
- Reveland, C., Siggelkow, P. und ARD-faktenfinder (2023). Desinformation: Irrefuührende Grafik verharmlost Klimawandel, https://www.tagesschau.de/faktenfinder/mortalitaetsfaelle-durch-klimakrise- 101.html.
- Rohwedder, W. (2021). Impfungen: Irrefuührende Statistik zu Sterberaten, https://www.tagesschau.de/faktenfinder/impfquote-sterblichkeitsrate-101.html.
- Schahn, J. und Bohner, G. (1996). Methodische Aspekte sozialwissenschaftlicher Evaluationsforschung im Umweltbereich,inA. Diekmann und C. C. Jaüger (eds),Umweltsoziologie (Sonderheft 36 der Küolner Zeitschrift füur Soziologie und Sozialpsychologie), Westdeutscher Verlag, Opladen.
- Schnell, R., Hill, P. B. und Esser, E. (2013).Methoden Der Empirischen Sozialforschung, 10 edn, Oldenbourg Verlag Muünchen, Muünchen.
- Schnell, R. und Kreuter, F. (2003). Separating Interviewer and Sampling-Point Effects.
- Schroder, J. und Schmiedeberg, C. (2023). Effects of partner presence during the interview on survey responses: The example of questions concerning the division of household labor,Sociological Methods & Research52(2): 933-955.
- Soutter, A. R. B. und Mottus, R. (2020). ’Global warming’ versus ’climate change’: A replication on the association between political self-identification, question wording, and environmental beliefs,JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY69.
- Stocke, V. und Hunkler, C. (2007). Measures of Desirability Beliefs and Their Validity as Indicators for Socially Desirable Responding,Field Methods19(3): 313-336.
- Tourangeau, R., Rips, L. J. und Rasinski, K. (2000). The psychology of survey response.
- Tourangeau, R. und Smith, T. W. (1996). Asking sensitive questions: The impact of data collection mode, question format, and question context,Public opinion quarterly60(2): 275-304.
- Tourangeau, R. und Yan, T. (2007). Sensitive questions in surveys.,Psychological bulletin133(5): 859.
- Vesely, S. und Klöckner, C. A. (2020). Social Desirability in Environmental Psychology Research: Three Meta-Analyses,Frontiers in Psychology11.
- Wolter, F. (2022). Sensitive und heikle Themen,inN. Baur und J. Blasius (eds),HandbuchMethoden der empirischen Sozialforschung, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, pp. 359-370.
[...]
- Martin Gerhard Reisenberg (1949 - 2023), Diplom-Bibliothekar und Autor
- Reaktivität: Einfluss des Mess- oder Erhebungsvorgangs auf die Studienteilnehmer und die resultierenden Daten (Wolter, 2022, 364)
- Containern: „eine Handlung, bei der Müllcontainer nach noch verzehrbaren Nahrungsmitteln durchsucht werden“ (Noack et al., 2016, 1f)
- Bystander: Andere anwesende Person (z. B. Partnerinnen, Familienangehörige, Freundinnen, Bekannte, Nachbar*innen, Dritte) (Bogner und Landrock, 2015, 6f)
- Satisficing: Reduzierung von Belastung durch Verkürzen des Informationsverarbeitungsprozesses (Bogner und Landrock, 2015, 1)
- Nonresponse: „Weigerungen der Zielpersonen [...], überhaupt an der Studie teilzunehmen (UnitNonresponse) oder einzelne Fragen in Befragungen zu beantworten (Item-Nonresponse)“ (Wolter, 2022, 363)
- Item-Count-Technik (ICT)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument befasst sich mit dem Einfluss sozialer Erwünschtheit auf geäußerte Umwelteinstellungen in Umfragen. Es werden das Konzept der sozialen Erwünschtheit, theoretische Grundlagen und Methoden zur Bewältigung dieses Phänomens erörtert.
Was versteht man unter sozialer Erwünschtheit?
Soziale Erwünschtheit beschreibt die Tendenz von Befragten, in Umfragen Antworten zu geben, die als sozial akzeptabel oder erwünscht gelten, auch wenn diese nicht ihren tatsächlichen Einstellungen oder Verhaltensweisen entsprechen.
Warum ist soziale Erwünschtheit ein Problem bei Umfragen zu Umwelteinstellungen?
Umweltfreundliche Einstellungen und Verhaltensweisen werden zunehmend als sozial erwünscht angesehen. Dies kann dazu führen, dass Befragte in Umfragen ihre tatsächlichen, möglicherweise weniger umweltfreundlichen, Einstellungen und Verhaltensweisen übertreiben.
Welche theoretischen Erklärungen gibt es für soziale Erwünschtheit?
Soziale Erwünschtheit wird oft mithilfe der Rational-Choice-Theorie (RC-Theorie) oder der Subjektiven Erwartungsnutzentheorie (SEU-Theorie) erklärt. Diese Theorien gehen davon aus, dass Individuen Kosten und Nutzen verschiedener Handlungsoptionen abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Im Kontext von Umfragen kann die Angst vor sozialer Missbilligung dazu führen, dass Befragte sozial erwünschte Antworten geben.
Welche Methoden gibt es, um mit sozialer Erwünschtheit umzugehen?
Es gibt verschiedene Methoden, um soziale Erwünschtheit zu minimieren oder zu berücksichtigen. Diese umfassen:
- Ex-post-Kontrolle: Analyse von Fragebatterien zur Erfassung der Neigung zu sozialer Erwünschtheit.
- Frageformulierung und Fragekontext: Gestaltung von Fragen und Fragebögen, um soziale Normen nicht zu stark zu betonen und indirekte Fragen zu stellen.
- Berücksichtigung von Interviewenden und Bystandern: Minimierung des Einflusses anwesender Personen auf das Antwortverhalten.
- Wahl des Befragungsmodus: Verwendung von selbstadministrierten Befragungen (z.B. Online-Umfragen) anstelle von persönlichen Interviews.
- Spezielle Befragungstechniken: Einsatz von Techniken wie der Item-Count-Technik (ICT), um die Anonymität zu erhöhen und Antworten zu verschleiern.
Was ist die Item-Count-Technik (ICT)?
Die Item-Count-Technik (ICT) ist eine spezielle Befragungstechnik, bei der Befragte eine Liste von Aussagen (Items) vorgelegt bekommen und angeben, wie viele dieser Aussagen auf sie zutreffen, ohne jedoch anzugeben, welche Aussagen dies konkret sind. Dadurch soll die Anonymität erhöht und die Verzerrung durch soziale Erwünschtheit reduziert werden.
Welchen Einfluss hat der Befragungsmodus auf soziale Erwünschtheit?
Selbstadministrierte Befragungsmodi, wie z.B. Online-Umfragen, führen tendenziell zu ehrlicherem Antwortverhalten bei sensiblen Themen, da die Befragten sich weniger beobachtet fühlen als bei persönlichen Interviews.
Welche Rolle spielen Interviewende und Bystander bei sozialer Erwünschtheit?
Die Anwesenheit von Interviewenden und Bystandern kann das Antwortverhalten beeinflussen, da Befragte möglicherweise versuchen, deren Erwartungen zu erfüllen oder soziale Missbilligung zu vermeiden. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Durchführung von Umfragen zu berücksichtigen.
Gibt es empirische Belege für den Einfluss sozialer Erwünschtheit auf Umwelteinstellungen?
Studien deuten darauf hin, dass soziale Erwünschtheit Antworten zu Umwelteinstellungen verzerren kann. Beispielsweise haben Beiser-McGrath und Bernauer (2021) in einer Studie gezeigt, dass Befragte in direkten Befragungen ihre Skepsis gegenüber dem Klimawandel verschleiern, während sie in einem anonymeren Setting (ICT) ehrlicher antworten.
Was sind die Schlussfolgerungen und der Ausblick dieser Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass soziale Erwünschtheit ein relevanter Faktor bei Umfragen zu Umwelteinstellungen sein kann und es wichtig ist, dies bei der Durchführung von Studien zu berücksichtigen. Es wird weiterer Forschungsbedarf gesehen, insbesondere in Bezug auf den Einfluss von Interviewenden, Bystandern und Befragungsmodi sowie die Berücksichtigung von Drittvariablen.
- Quote paper
- Laura Kiemes (Author), 2024, Der Effekt der sozialen Erwünschtheit auf Umwelteinstellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1489619