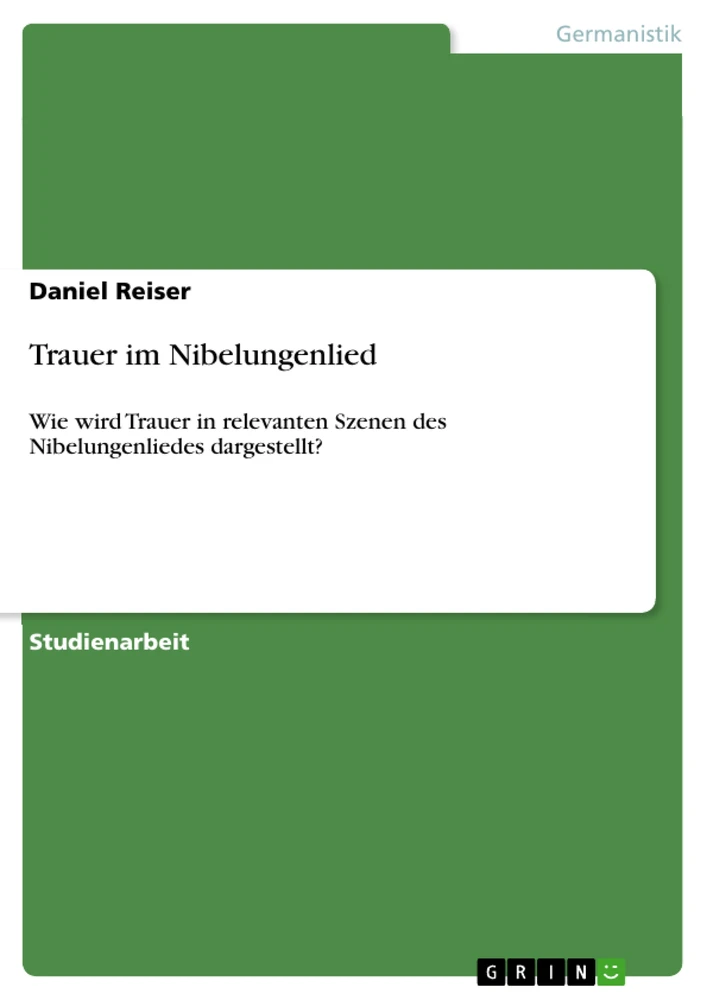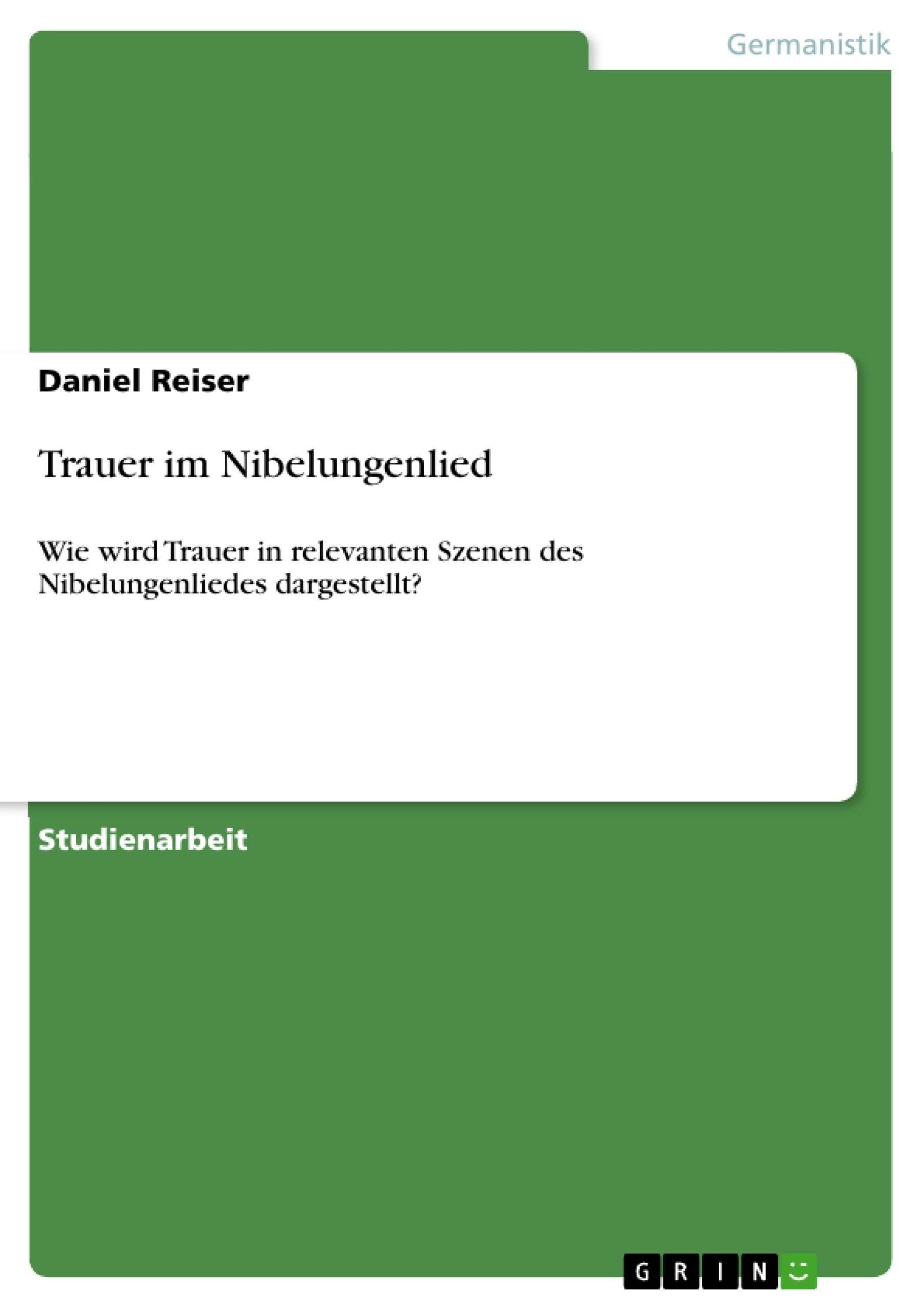Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Emotion Trauer im Mittelalter. Hierbei wird die Trauer im Heldenepos Nibelungenlied anhand unterschiedlicher Textstellen untersucht. Da die Emotion Trauer an einigen Stellen präsent ist und auf verschiedene Weisen inszeniert wird, geht diese Arbeit der Frage nach, wie Trauer in relevanten Szenen des Nibelungenliedes dargestellt wird.
Zu allererst wird Trauer im Kontext des Mittelhochdeutschen aufgegriffen und die historische Emotionsforschung beleuchtet. Hierzu ist es von hoher Bedeutung auf die Emotionswörter „klagen“, „jâmer“, „trûren“ sowie „leit“ einzugehen und diese im Kontext mittelalterlicher Literatur einzuordnen.
In einem nächsten Schritt folgt die Interpretation drei zentraler Textstellen, nämlich Sifrits Todes, des Königinnenstreites sowie der Trauer Rüdigers und dessen Tod am Ende des Heldenepos. Es wurde sich explizit für diese Textstellen entschieden, weil durch das Sterben Sifrits die Trauer Kriemhilts, einer zentralen Figur im Nibelungenlied, im Vordergrund steht, sich im Königinnenstreit zwei unterschiedliche weibliche Figuren gegenseitig beleidigen und folglich trauern sowie im Hinblick auf Rüdiger und dessen Tod primär die männliche Trauer eine wichtige Rolle einnimmt. Die Schwerpunkte für die Analysen liegen auf der weiblichen Trauer im Vergleich zur männlichen Trauer sowie auf dem Unterschied zwischen privater und öffentlicher Trauer. In diesem Zuge soll beleuchtet werden, wie die Trauer jeweils inszeniert wird, welche Rolle dabei der Erzähler des Heldenepos spielt und zudem, wo die Trauer in den einzelnen Textstellen ausgetragen wird, also eher privat oder öffentlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trauer im Mittelhochdeutschen
- Analyse ausgewählter Textstellen
- Sifrits Tod
- Der Königinnenstreit
- Rüdigers Trauer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Emotion Trauer im Mittelalter, insbesondere im Heldenepos Nibelungenlied. Sie analysiert, wie Trauer in verschiedenen Szenen des Nibelungenliedes dargestellt wird, und beleuchtet die Inszenierung von Trauer in Bezug auf Geschlecht, Privatsphäre und Öffentlichkeit.
- Die Darstellung von Trauer im Mittelhochdeutschen
- Die Inszenierung von Trauer in ausgewählten Textstellen des Nibelungenliedes
- Die Rolle der weiblichen Trauer im Vergleich zur männlichen Trauer
- Der Unterschied zwischen privater und öffentlicher Trauer
- Die Rolle des Erzählers in der Darstellung von Trauer
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Trauer im Nibelungenlied vor und gibt einen Überblick über die Forschungsfrage und die Herangehensweise der Arbeit. Sie beleuchtet die historische Emotionsforschung im Mittelalter und die Bedeutung von Emotionswörtern wie „klagen“, „jâmer“, „trûren“ und „leit“ im Kontext mittelalterlicher Literatur.
Trauer im Mittelhochdeutschen: Dieses Kapitel widmet sich dem Begriff der Trauer im Mittelhochdeutschen und analysiert verschiedene Emotionswörter, die mit Trauer verbunden sind. Der Fokus liegt dabei auf dem Begriff „klage“, der im Nibelungenlied besonders häufig vorkommt. Die Analyse beleuchtet die Vielfältigkeit und die theatralische Darstellung von Trauer im Mittelalter.
Analyse ausgewählter Textstellen: Dieses Kapitel analysiert drei zentrale Textstellen des Nibelungenliedes: den Tod Sifrits, den Königinnenstreit und die Trauer Rüdigers. Die Analyse der verschiedenen Szenen beleuchtet die Inszenierung von Trauer in Bezug auf Geschlecht, Privatsphäre und Öffentlichkeit und die Rolle des Erzählers in der Darstellung von Trauer.
- Quote paper
- Daniel Reiser (Author), 2023, Trauer im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1490225