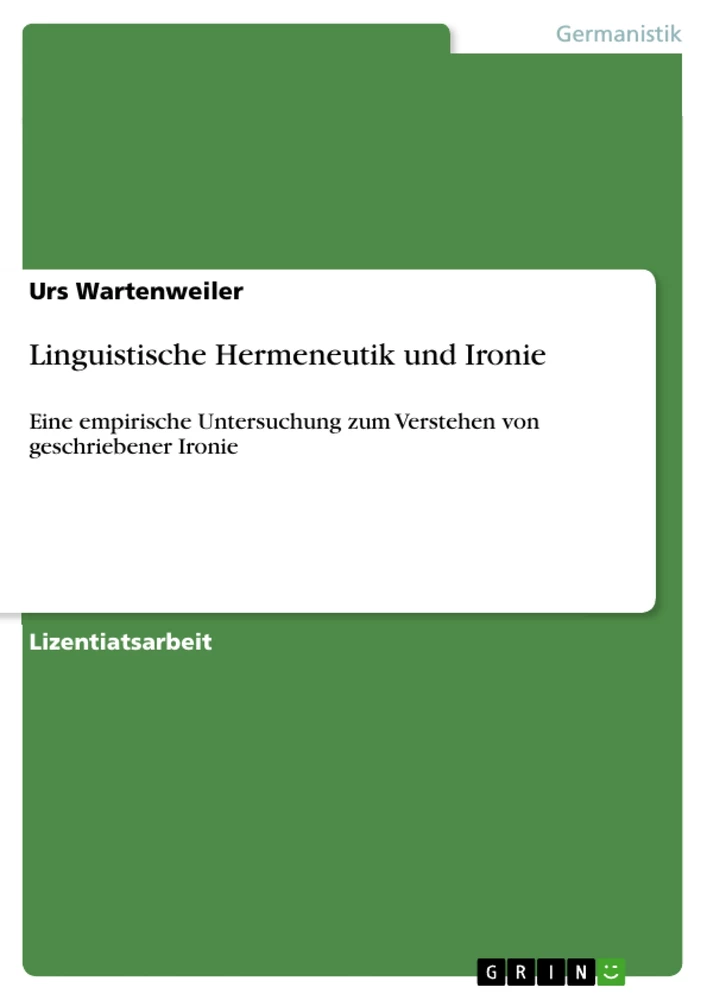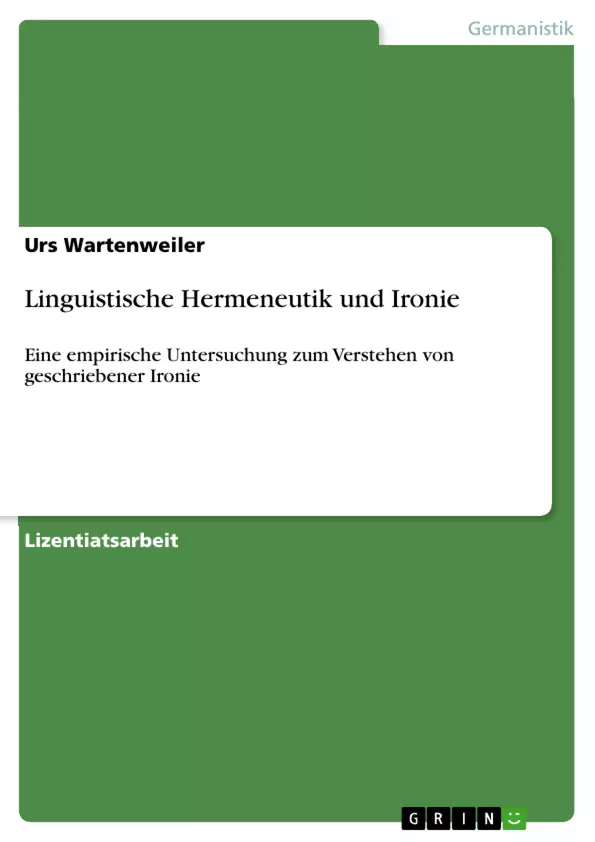Ironie wird gemeinhin als Kontextphänomen bezeichnet, was bedeutet, dass sie sich ausschließlich in Bezug auf außersprachliche Gegebenheiten einstellt und offenbart. Dies setzt voraus, dass Kenntnisse über die Äußerungssituation, die Person (beispielsweise ihre soziale Rolle), ihre Motive, ihre Intention, etc. bestehen oder erfasst und verstanden werden. In diesem Fall braucht die ironische Äußerung keine besonderen – sozusagen ironietypischen – Merkmale aufzuweisen, sie offenbart sich ja im außersprachlichen Zusammenhang.
Daneben existiert Ironie aber auch in geschriebenen Texten, deren Form keine besonderen, als ‚ironisch’ konventionalisierten Sprachmerkmale und -zeichen aufweist und bei denen auch der Kontext (die Sachverhalte, auf die der Text referiert) unbekannt ist. Trotzdem lassen sich auch diese Texte ironisch verstehen. Dies lässt nur den Schluss zu, dass sich die Ironie in diesen Fällen allein auf der Textebene konstituiert. Ein an diese Bedingungen angepasstes Analyseverfahren hat Kohvakka (1997) in ihrer Dissertation „Ironie und Text“ vorgelegt, in der sie Ironie anstatt als Kontext-, als Kotextphänomen darstellt und untersucht. Anhand ihres Analyseverfahrens kann erklärt werden, wie man idealerweise versteht.
Allerdings stellt sich die Frage, ob Leser tatsächlich so verstehen, denn es ist fraglich, ob diese Methode auch abbilden kann, wie der quasi Unwissende oder Unvorbereitete beim Verstehen vorgeht. Woran machen sie die Ironie fest? Warum erkennen sie diese allenfalls nicht? Erkennen sie mehr oder weniger? Welche Schlüsse ziehen sie? Welche Erwartungen haben sie an den Text und seinen Verlauf? Welche Emotionen weckt der Text bei ihnen?
Das Ziel der Arbeit: Sie soll den relativ neuen Ansatz der linguistischen Hermeneutik vorstellen und vor der aktuellen Diskussion um einen allfälligen Paradigmenwechsel in der (angewandten) Linguistik eine mögliche Umsetzung hermeneutischer Verfahren in Bezug auf das Verständnis schriftlicher Ironie, sowie den Rückschluss auf die didaktische Hermeneutik aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- I Erkenntnisinteresse
- II Aufbau und Vorgehen
- III Hinweise zur Form der Arbeit
- IV Fritz Hermanns (1940-2007)
- 1. Erster Teil: Hermeneutik
- 1.1 Zum Verhältnis von Hermeneutik und Sprachwissenschaft
- 1.2 Linguistische Hermeneutik
- 1.2.1 Wo wird sie angegliedert?
- 1.2.2 Gliederung innerhalb des Teilfaches linguistische Hermeneutik
- 1.3 Theoretische Hermeneutik
- 1.3.1 Was ist Hermeneutik?
- 1.3.2 Was ist Verstehen?
- 1.3.2.1 Verstehen als Erkennen
- 1.3.2.2 (Richtig) Verstehen, Missverstehen, Missverständnis
- 1.3.2.3 Verstehen und Meinen
- 1.3.2.4 Zwei Zirkel des Verstehens
- 1.3.2.4.1 Erster Zirkel: generelles Wissen vs. singuläres Wissen
- 1.3.2.4.2 Zweiter Zirkel: Interdependenz von Teil und Ganzem
- 1.3.2.5 Verstehensdynamik
- 1.3.2.6 Durch Empathie ermöglichtes Verstehen
- 1.3.3 Was ist Interpretieren?
- 1.4 Empirische Hermeneutik
- 1.4.1 Personenverstehen
- 1.4.2 Sinnverstehen
- 1.4.3 Situationsverstehen
- 1.4.4 Form- und Funktionsverstehen
- 1.4.5 Handlungstypverstehen
- 2. Zweiter Teil: Ironie
- 2.1 Griechische Antike
- 2.1.1 Antike Moralistik
- 2.1.2 Sokratische Ironie
- 2.1.3 Platons Dialoge
- 2.1.4 Aristoteles’ Tugendlehre
- 2.2 Römische Antike
- 2.2.1 Cicero
- 2.2.2 Quintilian
- 2.3 Von der Antike bis in die Gegenwart
- 2.4 Definition von Ironie
- 2.4.1 Wortironie, Satzironie
- 2.4.2 Geschriebene Ironie: Fiktionsironie vs. Stellenironie
- 2.4.3 Ironiesignal
- 2.4.4 Kontext, Kotext
- 2.4.5 Geteilte Werte: Der soziale Charakter der Ironie
- 2.4.6 Kritik, Konkurrenz, Negativität und Aggression
- 2.4.7 Enttäuschte Erwartung, Verstoß gegen die Logik
- 2.4.8 Paradox: Geschaffener Widerspruch
- 2.4.9 Ironienahe Phänomene
- 3. Dritter Teil: Linguistische Theorien
- 3.1 Searles Sprechakttheorie
- 3.2 Grice’ Kooperationsprinzip und Maximen
- 3.3 Sperber & Wilson: Relevance Theory; Echoic Mention Theory
- 3.4 Kohvakka: Kotextuelle Ironieidentifikation
- 3.4.1 Erwartungswidrigkeiten auf lexematischer Ebene
- 3.4.2 Erwartungswidrigkeiten auf thematischer Ebene
- 3.4.3 Argumentativer Aufbau des Textes
- 3.4.4 Relationen der einzelnen Konklusionen
- 4. Vierter Teil: Empirie
- 4.1 Textanalyse nach Kohvakka
- 4.2 Kontextuelle Ergänzungen zu Kohvakkas Analyse
- 4.3 Umstände der Datenerhebung und Methodendiskussion
- 4.3.1 Zu den Rezeptionsprotokollen
- 4.3.2 Zu Test und Testpersonen
- 4.4 Ergebnisse und Interpretation
- 4.4.1 Ironie erkannt
- 4.4.1.1 Ironie explizit erkannt: Typ „Kohvakka“
- 4.4.1.2 Ironie implizit erkannt: Typ „Antike Rhetorik“
- 4.4.1.3 Verstehende Testpersonen allgemein und im Vergleich: Interpretation
- 4.4.2 Ironie nicht erkannt
- 4.4.2.1 Ironie nicht erkannt oder angeblich erkannt
- 4.4.2.2 Problematische Interpretationen
- 4.4.2.3 Nichtverstehende Testpersonen allgemein und im Vergleich: Interpretation
- 4.4.3 Allgemeine Feststellungen und Vergleiche
- 4.4.4 Übersicht beantworteter und offener Fragen
- 4.4.4.1 Allgemeine Fragen
- 4.4.4.2 Verstehensgegenstände
- 4.4.4.3 Verstehensprozess
- Rückschluss und Ausblick
- Die sprachwissenschaftliche Analyse von Ironie
- Die Anwendung der linguistischen Hermeneutik auf das Ironieverstehen
- Der Vergleich von hermeneutischen und kotextuellen Analysemethoden
- Die Bedeutung von Verstehensbedingungen für das Erkennen von Ironie
- Die Möglichkeiten und Grenzen einer didaktischen Ironielehre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das neue Teilgebiet der Linguistik, die linguistische Hermeneutik, vorzustellen und die Frage zu klären, wie man schriftliche Ironie im Rahmen der linguistischen Hermeneutik und dem Analyseverfahren von Kohvakka verstehen kann. Des Weiteren soll der mögliche Nutzen der beiden Verfahren in Kombination aufgezeigt werden, sowie ein möglicher Rückschluss auf die didaktische Hermeneutik in Bezug auf das Ironieverstehen gezogen werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Erkenntnisinteresse und die Forschungsfragen erläutert. Der erste Teil behandelt die linguistische Hermeneutik und ihre Bedeutung für die Sprachwissenschaft, wobei die Begriffe Verstehen und Interpretieren in den Mittelpunkt gestellt werden. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Geschichte der Ironie in der Antike und ihrer Bedeutung für die Rhetorik. Im dritten Teil werden verschiedene pragmatische Theorien vorgestellt, die sich mit dem Phänomen der Ironie auseinandersetzen. Der vierte Teil der Arbeit enthält eine empirische Untersuchung, die die zuvor diskutierten Theorien anhand von Rezeptionsprotokollen von Testpersonen überprüft. Die Arbeit endet mit einem Schluss und Ausblick, in dem die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und weitere Forschungsfelder aufgezeigt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Begriffen Hermeneutik, Verstehen, Interpretieren, Ironie, Kotext, konklusive Struktur, argumentationstheoretisches Vorgehen, Rezeptionsprotokolle und Textsortenwissen. Sie analysiert und interpretiert einen Text aus der Zeitschrift „Die Zeit“ und untersucht dabei die Interpretationen von Testpersonen, die in einer Sekundarklasse am Gymnasium Lerbermatt, Köniz bei Bern, ermittelt wurden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist linguistische Hermeneutik?
Es ist ein Teilbereich der Linguistik, der sich mit dem Verstehen und Interpretieren von Sprache befasst, anstatt sie nur als statisches System zu analysieren.
Wie wird Ironie in dieser Arbeit definiert?
Neben dem klassischen Kontextphänomen wird Ironie nach Kohvakka als „Kotextphänomen“ untersucht, das sich allein auf der Textebene konstituiert.
Welche Rolle spielen Ironiesignale in geschriebenen Texten?
Sie dienen als Hinweise im Text, die dem Leser helfen, die ironische Intention zu erkennen, auch wenn der äußere Kontext unbekannt ist.
Welche pragmatischen Theorien werden zur Ironie herangezogen?
Die Arbeit diskutiert Searles Sprechakttheorie, Grice’ Kooperationsprinzip sowie die Relevance Theory von Sperber und Wilson.
Was ist das Ziel der empirischen Untersuchung in der Arbeit?
Die Untersuchung prüft anhand von Rezeptionsprotokollen, wie Leser Ironie tatsächlich erkennen und welche Erwartungen sie an den Textverlauf haben.
- Quote paper
- Urs Wartenweiler (Author), 2007, Linguistische Hermeneutik und Ironie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149052