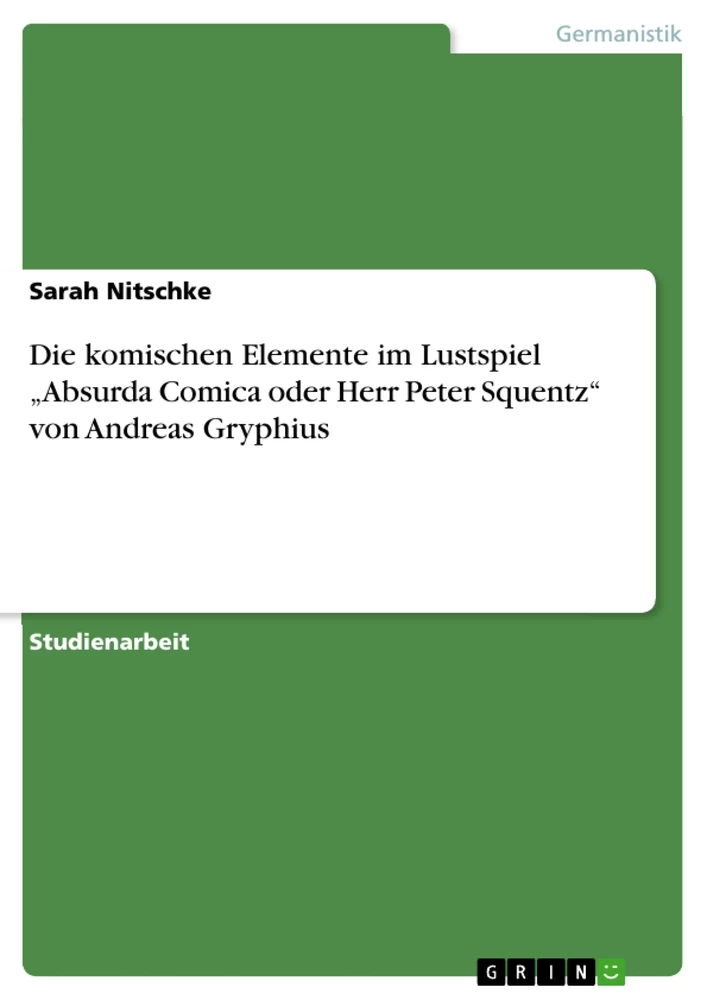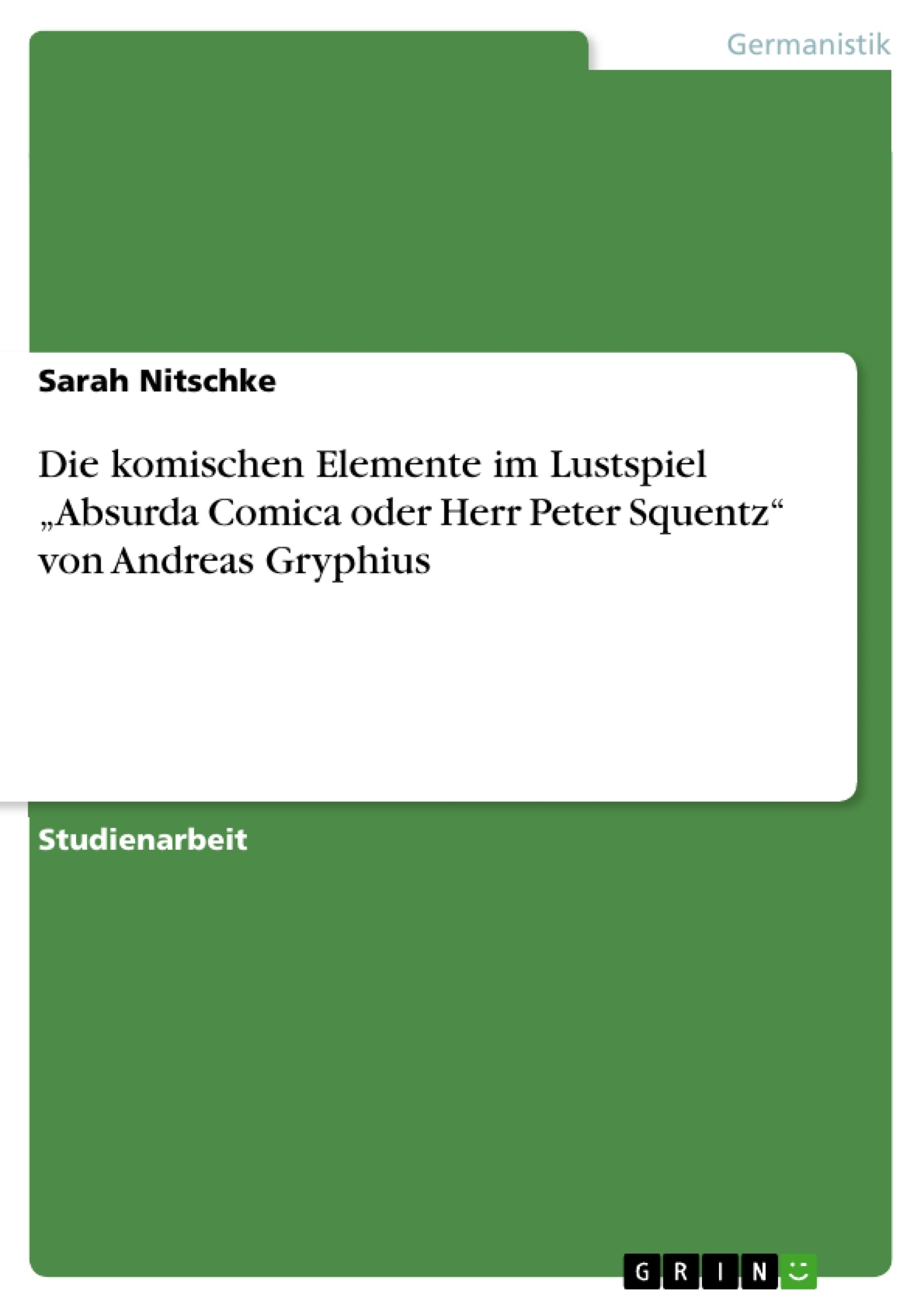Andreas Greif wurde am 2. Oktober 1616 als jüngster Sohn von Paulus und Anna Greif in Glogau geboren. Sein Vater starb schon früh, sein Stiefvater Michael Eder wurde vertrieben und kurz darauf verstarb auch seine Mutter. Außerdem lebte Gryphius, der sich als Künstlernamen diesen lateinischen Namen gab, in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, was seine Kindheit nicht leichter machte. Nachdem er seinem Ziehvater gefolgt war, besuchte Gryphius ein Gymnasium in Görlitz und studierte bald am Akademischen Gymnasium Danzig. Später arbeitete er als Hauslehrer. Er beherrschte elf Sprachen und war Mitglied der 1617 gegründeten Fruchtbringenden Gesellschaft.
Andreas Gryphius war Lutheraner und trat für seinen Glauben ein, was auch ein Motiv des Weltbildes im 17. Jahrhundert ist.
Wichtige Tendenzen in Gryphius´ Leben waren das Moment der Bildung, sein religiöses, evangelisch-christliches Weltverständnis, seine Arbeit in mehreren Berufen – Gryphius war Hauslehrer, Leiter von Kollegs, Landessyndikus von Glogau sowie Rechtsberater – und die Kriegserfahrung.
Gryphius Leben war geprägt von den Leiden und Erfahrungen seiner Zeit. Diese Erfahrungen der Unruhe, Einsamkeit, Zerrissenheit und des moralischen Verfalls während der Kriegsjahre thematisierte er in seinen Gedichten und Tragödien.
Weniger bedeutend in Bezug auf die Wirkungsgeschichte sind die Komödien von Andreas Gryphius, welche von der italienischen Commedia dell´arte beeinflusst wurden. Das bekannteste, „meistgespielte[n] [und] vermutlich erste[n]“ Lustspiel Gryphius´ ist „Absurda Comica oder Herr Peter Squentz“, das 1658 erstmals gedruckt wurde. Die genaue Entstehungszeit ist weitestgehend unbekannt. Bei dieser Komödie ist außerdem nicht hundertprozentig sicher, ob Gryphius der tatsächliche Verfasser ist, da diese mit dem Synonym „Philip – Gregorio Riesentod“ unterschrieben wurde. Man geht jedoch davon aus, dass dies das Pseudonym von Andreas Gryphius sei.
Das Lustspiel hat zum Ziel, das ungebildete Bürgertum zu verspotten und Maulhelden bloßzustellen. In „Absurda Comica“ ist der Titelheld Peter Squentz ein solcher Maulheld und bringt viele Begriffe durcheinander, die er verwendet, um gebildet zu erscheinen. Herr Squentz möchte mit einer Gruppe Handwerker eine Tragödie für den König vorspielen.
Thematisiert werden soll die Sage „Piramus und Thisbe“ auf den Ovidschen Metamorphosen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die komischen Elemente in „Absurda Comica oder Herr Peter Squentz“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komischen Elemente in Andreas Gryphius' Lustspiel „Absurda Comica oder Herr Peter Squentz“. Ziel ist es, die komischen Aspekte des Stücks zu analysieren und zu erklären, wie Gryphius literarische Normen seiner Zeit bricht und so komische Effekte erzielt.
- Die literarischen Konventionen des 17. Jahrhunderts und deren Unterwanderung in "Absurda Comica"
- Die Rolle der Figurenkomik und die Darstellung des ungebildeten Bürgertums
- Das "Spiel im Spiel" als komisches Element und seine Funktion
- Der Einsatz des Knittelverses im Kontrast zur Hochsprache
- Das Missverhältnis zwischen Sein und Schein als Quelle der Komik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung gibt einen kurzen Überblick über das Leben Andreas Gryphius, seinen Kontext im Dreißigjährigen Krieg und seine literarische Produktion. Sie hebt die Bedeutung von „Absurda Comica oder Herr Peter Squentz“ als eines der wenigen Lustspiele Gryphius' hervor und führt die Forschungsfrage ein: Wo genau liegt die Komik in Gryphius' Lustspiel? Die Einleitung stellt den Rahmen für die darauf folgende Analyse der komischen Elemente dar und betont die Besonderheit des Stücks im Kontext des literarischen Schaffens Gryphius'.
Die komischen Elemente in „Absurda Comica oder Herr Peter Squentz“: Dieses Kapitel analysiert die komischen Elemente in Gryphius' Stück. Es untersucht, wie Gryphius die literarischen Normen seiner Zeit, insbesondere die von Martin Opitz festgelegten Regeln der deutschen Dichtkunst, bewusst bricht. Der Kontrast zwischen dem hochgestochenen Anspruch der Handwerker, die eine Tragödie aufführen wollen, und ihrer ungeschickten und lächerlichen Umsetzung bildet einen zentralen komischen Aspekt. Der Einsatz des Knittelverses im "Spiel im Spiel" steht im starken Gegensatz zur Prosa des restlichen Stückes und unterstreicht die Komik der Situation. Weiterhin wird die Figurenkomik durch die Darstellung des ungebildeten Bürgertums, das mit Bildung protzt, die es nicht besitzt, beleuchtet. Das Kapitel betont die Bedeutung des "Missverhältnisses zwischen Sein und Schein" als Quelle der Komik im Stück.
Schlüsselwörter
Andreas Gryphius, Absurda Comica, Komödie, Lustspiel, Knittelvers, Figurenkomik, Martin Opitz, literarische Normen, „Spiel im Spiel“, Bürgertum, Sein und Schein.
Häufig gestellte Fragen zu "Absurda Comica oder Herr Peter Squentz"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die komischen Elemente in Andreas Gryphius' Lustspiel "Absurda Comica oder Herr Peter Squentz". Sie untersucht, wie Gryphius literarische Normen seiner Zeit bricht und dadurch komische Effekte erzielt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Komik in "Absurda Comica", darunter die Unterwanderung literarischer Konventionen des 17. Jahrhunderts, die Rolle der Figurenkomik und die Darstellung des ungebildeten Bürgertums, das "Spiel im Spiel" als komisches Element, der Kontrast zwischen Knittelvers und Hochsprache, sowie das Missverhältnis zwischen Sein und Schein als Quelle der Komik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Analyse der komischen Elemente in "Absurda Comica" und einen Schluss. Die Einleitung bietet einen Überblick über Gryphius' Leben und Werk und führt die Forschungsfrage ein. Das Hauptkapitel analysiert die verschiedenen komischen Aspekte des Stücks detailliert. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet eine prägnante Übersicht über den Inhalt.
Welche literarischen Konventionen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht, wie Gryphius die literarischen Normen des 17. Jahrhunderts, insbesondere die von Martin Opitz festgelegten Regeln der deutschen Dichtkunst, bewusst bricht. Der Fokus liegt auf dem Kontrast zwischen hochgestochenem Anspruch und ungeschickter Umsetzung, sowie dem Einsatz des Knittelverses im "Spiel im Spiel".
Welche Rolle spielt die Figurenkomik?
Die Figurenkomik spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit beleuchtet die Darstellung des ungebildeten Bürgertums, das mit Bildung protzt, die es nicht besitzt, als Quelle der Komik.
Welche Bedeutung hat das "Spiel im Spiel"?
Das "Spiel im Spiel" wird als wichtiges komisches Element analysiert und seine Funktion im Gesamtkontext des Stücks untersucht. Der Kontrast zwischen dem "Spiel im Spiel" und dem Hauptgeschehen wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Andreas Gryphius, Absurda Comica, Komödie, Lustspiel, Knittelvers, Figurenkomik, Martin Opitz, literarische Normen, „Spiel im Spiel“, Bürgertum, Sein und Schein.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wo genau liegt die Komik in Gryphius' Lustspiel?
Welche Bedeutung hat "Absurda Comica" im Werk Gryphius'?
"Absurda Comica" wird als eines der wenigen Lustspiele Gryphius' hervorgehoben und seine Besonderheit im Kontext seines literarischen Schaffens betont.
- Quote paper
- Sarah Nitschke (Author), 2009, Die komischen Elemente im Lustspiel „Absurda Comica oder Herr Peter Squentz“ von Andreas Gryphius, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149053