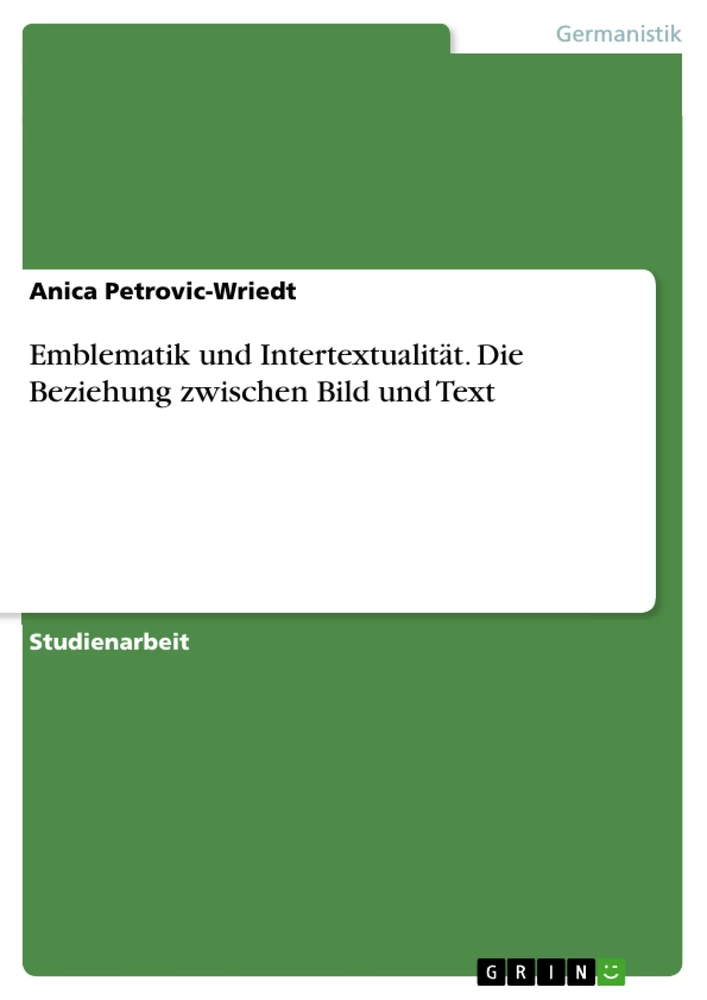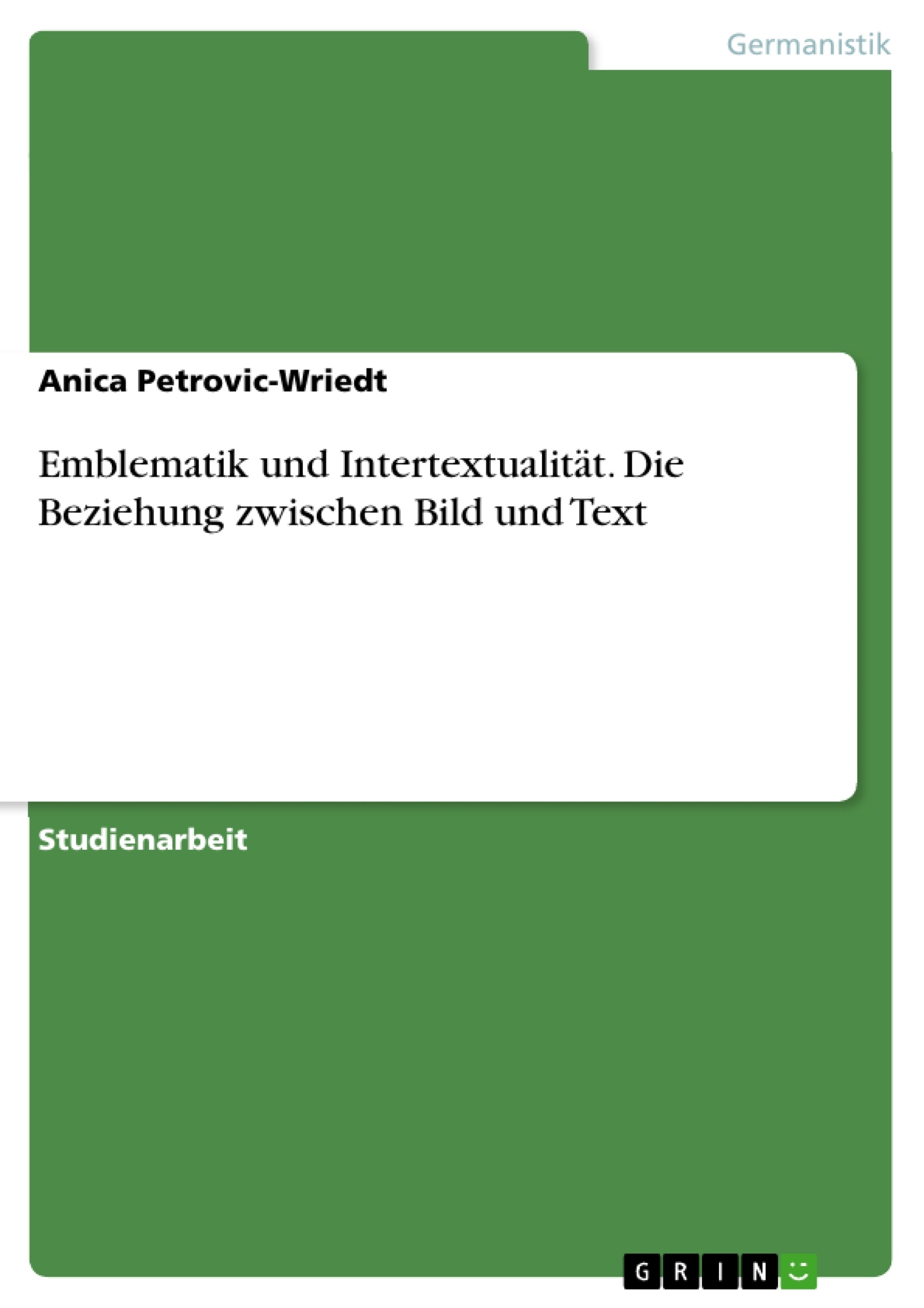Bernhard Scholz leitet seinen Aufsatz zu den Themen und Fragestellungen der Emblemforschung mit der Frage ein, wie das Emblem in seiner Zeit eigentlich einzuordnen sei. Ausgangspunkt ist für ihn die Frage nach dem Textkorpus der Emblematik, die als produktivste Wort-Bild-Gattung vom 16. bis zum 18. Jahrhundert gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Intertextualität und Systembeziehung¹
- Text-Bild-Beziehung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz von Bernhard Scholz befasst sich mit der Bedeutung des Emblems in der frühen Neuzeit und untersucht die Intertextualität und Systembeziehung des Emblems in Bezug auf andere Kunstformen und Wissensgebiete.
- Die Rolle des Emblems als produktivste Wort-Bild-Gattung des 16. bis 18. Jahrhunderts
- Die „semiotische Matrix“ der frühen Neuzeit und die Bedeutung des Emblems als Teil dieser Matrix
- Die Intertextualitätsbeziehungen des Emblems zu anderen Textformen
- Die Systembeziehungen des Emblems zu anderen semiotischen Systemen
- Die Text-Bild-Beziehung im Emblem und die unterschiedlichen Interpretationen der einzelnen Teile
Zusammenfassung der Kapitel
Der Aufsatz beginnt mit der Frage nach der Einordnung des Emblems in seiner Zeit und der Bedeutung des Textkorpus der Emblematik. Scholz argumentiert, dass das Emblem nicht nur in Emblembüchern, sondern auch in anderen Kunstformen wie Literatur, Malerei, Skulptur und Baukunst eine wichtige Rolle spielte. Er stellt die Definitionen des „emblematischen Zeitalters“ von Albrecht Schöne und der „semiotischen Matrix“ von Thomas M. Greene gegenüber und kritisiert beide Ansätze. Scholz argumentiert, dass die „semiotische Matrix“ für alle Kunstwerke der Epoche gelten sollte und dass diese Matrix einzelfallabhängig variiert und modifiziert werden kann. Er führt Beispiele für semiotische Systeme wie Geometrie, Affektenlehre, Alchemie und Rhetorik an, die alle ein bestimmtes Repertoire an Zeichen verwenden und eine Doppelfunktion haben. Aus dieser Analyse leitet Scholz zwei Fragestellungen ab: zum einen die Frage nach dem Schaffen eines umfangreichen Textkorpus und zum anderen die Frage nach der strukturellen Beeinflussung anderer Textkorpora.
Scholz untersucht dann die Intertextualitätsbeziehungen des Emblems, indem er die Frage stellt, ob solche zwischen einzelnen Texten erkennbar sind. Er führt das Drama als Beispiel an, bei dem ein als bekannt vorausgesetztes Emblem durch Schauspieler auf die Bühne gebracht wird. Er stellt fest, dass die Emblemforschung bereits seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Frage nach der Übertragbarkeit dieser Fragestellungen und der angedeuteten Doppelfunktion auf das Emblem beschäftigt ist.
Scholz untersucht auch die Systembeziehungen des Emblems, indem er die Frage stellt, ob solche erkennbar sind, d.h., ob es zur Übernahme „abstrakter Zeichensysteme“ innerhalb der Matrix und deren Aktualisierungen auf bzw. für das Emblem kommt. Er führt das Drama als Beispiel an und fragt, ob Analogien zwischen der Struktur des Emblems und des Dramas erkennbar sind. Er kritisiert die exzessive Suche nach „emblematischen Strukturen“ in anderen Textsorten, da die Struktur- und Textbegriffe nicht expliziert wurden und diese Forschung somit auch keine nachhaltigen Ergebnisse brachte.
Scholz analysiert dann Schönes Ansatz der Doppelfunktion des Emblems als „Abbilden und Auslegen, Darstellen und Deuten“ und untersucht den Einfluss dieses Ansatzes auf die Genese und Entwicklung der Emblematik. Er stellt fest, dass das Emblem zwischen zwei Textgruppen angesiedelt ist: der „darstellenden und auslegenden/ deutenden“ und der „abbildenden und auslegenden/ deutenden“ Textgruppe. Er zeigt, dass die Entwicklung der Emblematik auch durch das Begriffspaar „Assimilation“ und „Dissimilation“ beschrieben werden kann. Assimilation meint dabei das Ähnlichmachen von Elementen anderer Gattungen mit der Doppelfunktion „Darstellen und Auslegen“, während Dissimilation das Unähnlichmachen des Emblems gegenüber ähnlichen Wort-Bild-Gattungen meint.
Scholz untersucht schließlich die Text-Bild-Beziehung im Emblem und die unterschiedlichen Interpretationen der einzelnen Teile. Er stellt fest, dass es in der Emblemforschung unterschiedliche Ansätze gibt, wie die verschiedenen Teile des Emblems zusammenhängen. Ein Teil der Forschung geht von der picura als wichtigstem Bestandteil des Emblems aus, während ein anderer Forschungszweig die Ansicht vertritt, dass es sich bei der pictura nur um die Verbildlichung des Textes handelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Emblemforschung, Intertextualität, Systembeziehung, semiotische Matrix, Emblematik, Text-Bild-Beziehung, Dreiteiligkeit, Assimilation, Dissimilation, picura, subscriptio, inscriptio, frühe Neuzeit, Renaissance, Barock.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Emblem in der frühen Neuzeit?
Ein Emblem ist eine Wort-Bild-Gattung, die aus drei Teilen besteht: Inscriptio (Motto), Pictura (Bild) und Subscriptio (Erläuterungstext).
Was bedeutet „Intertextualität“ in der Emblemforschung?
Es beschreibt die Beziehung zwischen Emblemen und anderen Textformen wie Dramen oder wissenschaftlichen Traktaten der Epoche.
Was ist die „semiotische Matrix“?
Dieser Begriff nach Thomas M. Greene beschreibt das System von Zeichen und Symbolen, das Künstlern und Autoren der Renaissance als gemeinsames Repertoire diente.
Wie hängen Bild und Text im Emblem zusammen?
Die Forschung diskutiert, ob das Bild den Text illustriert oder der Text das oft rätselhafte Bild deutet („Abbilden und Auslegen“).
Was versteht man unter Assimilation und Dissimilation bei Emblemen?
Assimilation bezeichnet das Ähnlichmachen mit anderen Gattungen, während Dissimilation die Abgrenzung des Emblems als eigenständige Form beschreibt.
- Arbeit zitieren
- Anica Petrovic-Wriedt (Autor:in), 2008, Emblematik und Intertextualität. Die Beziehung zwischen Bild und Text, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149096