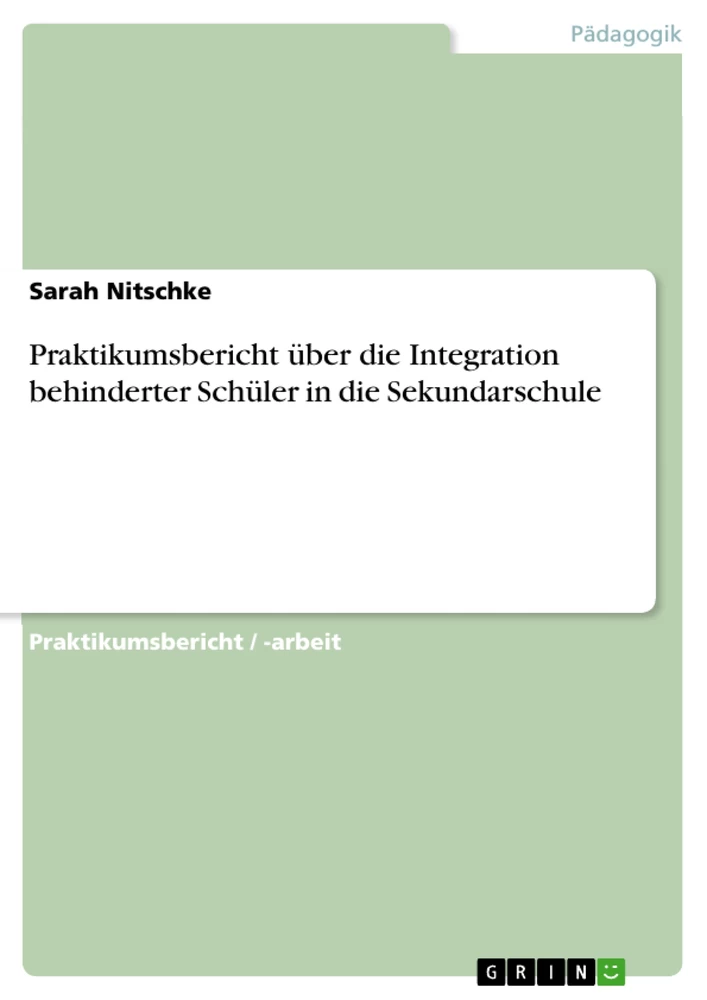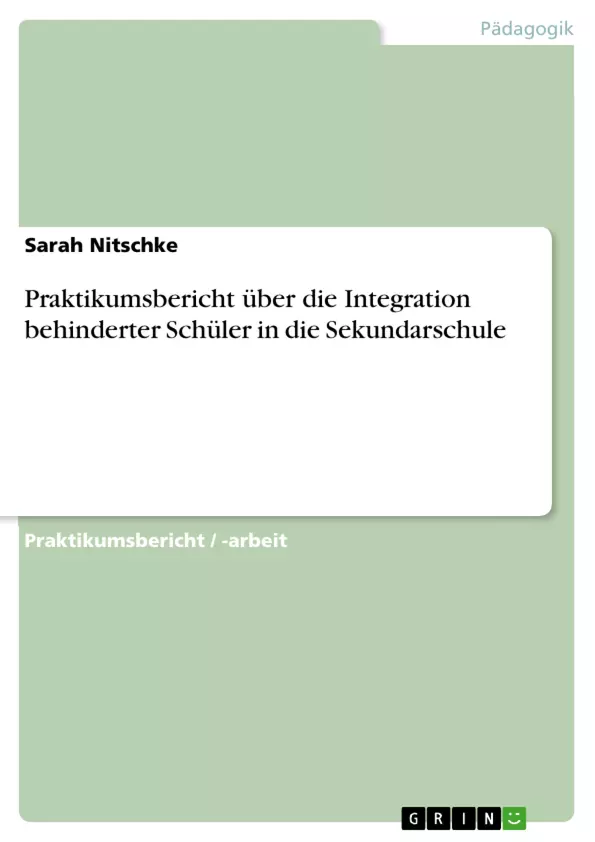Es gibt eine Vielzahl von pädagogischen Mitarbeitern, die sich um die Schüler und deren Probleme kümmern, mit ihnen Hausaufgaben machen und sie betreuen. An dieser Ganztagsschule in Köthen gibt es Klassen mit Regelschul- und Hauptschulniveau sowie gemischte Klassen, genannt Kombiklassen, in denen Schüler mit verschiedenem Leistungspotential sitzen. Der Sinn dabei besteht darin, dass die Regelschüler die Hauptschüler mitziehen sollen. Des Weiteren bietet diese Schule Möglichkeiten für körperlich und geistig behinderte Menschen, so gibt es beispielsweise einen Fahrstuhl im Gebäude sowie Hilfskräfte, die sich um die Betreffenden kümmern.
Durch das „dreigliedrige“ Schulsystem in Deutschland werden aus Schülern Menschen verschiedener sozialer Schichten gemacht, die meist nur mit Ihresgleichen in Kontakt stehen. Die Schule spaltet damit die Gesellschaft „und zieht Eliten heran, die ihren Lebensstil für das Maß aller Dinge halten“. Dadurch werden Vorurteile, soziale Ignoranz sowie Sprachlosigkeit gefördert. Dies wiederum führt zu sozialen Konflikten „und untergräbt die Demokratie“.
An allgemeinen Schulen würden viele Förderschüler nicht zurecht kommen, heißt es. Es ist jedoch die Aufgabe einer demokratischen Gesellschaft, benachteiligte Menschen zu integrieren. Nicht die Kinder müssen sich der Schule anpassen, sondern die Schule den Kindern. Dies bedeutet, dass die Gesellschaft viel mehr in die Schulen investieren muss:
„in mehr Lehrer, besser ausgebildete Lehrer, deutlich kleinere Klassen und individuelle Förderung“. Es ist die Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen für Chancengleichheit zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu schaffen4.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung mit Begründung der Themenwahl und Problemaufriss
- Grundlegende theoretische Einsichten und konkrete Beobachtungen zum Thema
- Schlusswort mit gewonnenen Einsichten und Schlussfolgerungen für das Lehrerhandeln
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Praktikumsbericht befasst sich mit der Integration geistig behinderter Schüler an einer Ganztagsschule. Der Bericht analysiert die Herausforderungen und Chancen der Integration anhand eines konkreten Fallbeispiels, einer Schülerin mit Downsyndrom. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Integration tatsächlich gelingt oder ob die Schülerin lediglich eine Regelschule besucht, ohne in die Gemeinschaft der anderen Schüler integriert zu werden.
- Theoretische Grundlagen der Integration
- Praktische Erfahrungen mit der Integration geistig behinderter Schüler
- Die Rolle der Integrationshelferin
- Herausforderungen und Chancen der Integration
- Schlussfolgerungen für das Lehrerhandeln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema des Praktikumsberichts vor und erläutert die Motivation für die Themenwahl. Der Bericht beleuchtet die Situation an der Ganztagsschule XXX, die sowohl Regelschüler als auch Schüler mit unterschiedlichen Leistungspotenzialen und Behinderungen unterrichtet. Die Einleitung kritisiert das dreigliedrige Schulsystem in Deutschland und plädiert für eine inklusive Gesellschaft, die Chancengleichheit für alle Menschen ermöglicht.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Integration und den konkreten Beobachtungen während des Praktikums. Es wird die Bedeutung der Individualisierung und Differenzierung im Unterricht für geistig behinderte Schüler hervorgehoben. Die Rolle der Integrationshelferin wird als essenziell für die Unterstützung des Kindes im Unterricht und bei der Integration in die Klassengemeinschaft beschrieben.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Integration behinderter Schüler an einer Regelschule?
Integration bedeutet, dass Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit Schülern ohne Behinderung unterrichtet werden, wobei die Schule sich an die Bedürfnisse der Kinder anpassen muss.
Welche Rolle spielt eine Integrationshelferin?
Eine Integrationshelferin unterstützt behinderte Schüler im Unterricht, hilft bei der Bewältigung von Aufgaben und fördert die soziale Einbindung in die Klassengemeinschaft.
Was sind die Herausforderungen bei der Integration von Schülern mit Downsyndrom?
Herausforderungen liegen in der individuellen Differenzierung des Lernstoffs, der Vermeidung von sozialer Isolation und der Sicherstellung, dass das Kind tatsächlich am Gemeinschaftsleben teilnimmt.
Warum wird das dreigliedrige Schulsystem in dieser Arbeit kritisiert?
Die Arbeit kritisiert, dass das System die Gesellschaft spaltet, Vorurteile fördert und benachteiligte Kinder oft in Förderschulen isoliert, statt sie frühzeitig in die Mitte der Gesellschaft zu integrieren.
Was ist eine Ganztagsschule und welche Vorteile bietet sie für die Integration?
Eine Ganztagsschule bietet über den Unterricht hinaus Betreuung und pädagogische Angebote. Dies ermöglicht mehr Zeit für individuelle Förderung und soziale Kontakte zwischen Schülern unterschiedlicher Leistungsniveaus.
Welche Rahmenbedingungen muss der Staat für Inklusion schaffen?
Notwendig sind mehr und besser ausgebildete Lehrer, deutlich kleinere Klassen, eine barrierefreie Infrastruktur sowie eine ausreichende Finanzierung für individuelle Fördermaßnahmen.
- Citar trabajo
- Sarah Nitschke (Autor), 2009, Praktikumsbericht über die Integration behinderter Schüler in die Sekundarschule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149152