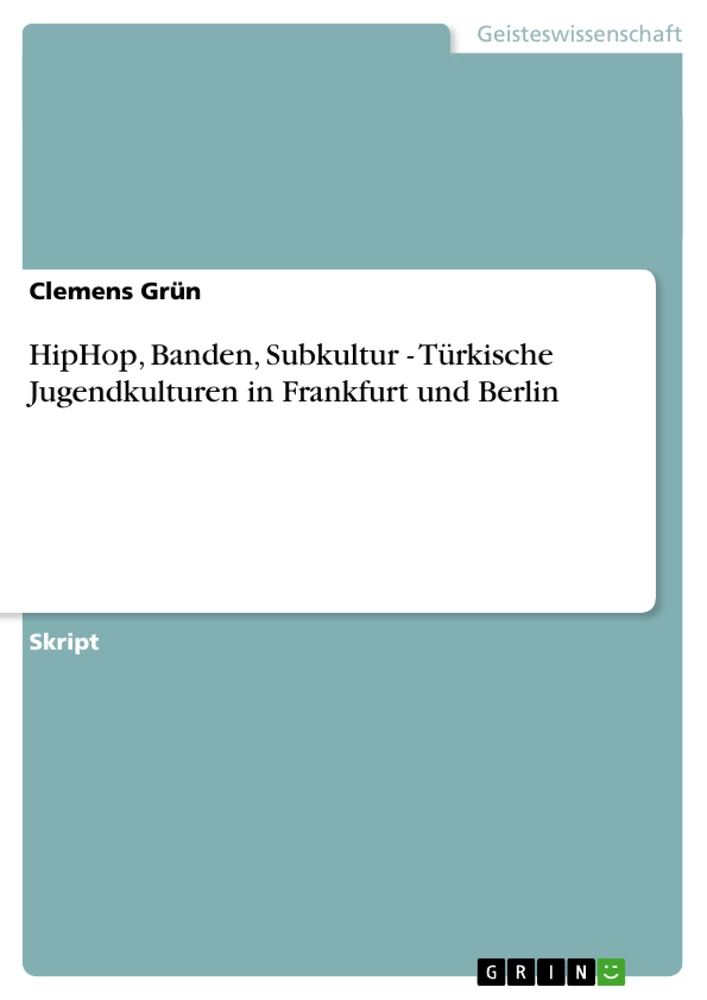Während meiner viermonatigen Projektarbeit mit marginalisierten türkischen
Jugendlichen in einem medienpädagogischen Projekt in Berlin-Kreuzberg im
Sommer 2002 gewann ich Erkenntnisse über deren Lebenswirklichkeit und
Werteorientierungen, die in überraschender Weise vom öffentlichen Diskurs über
diese Gruppierungen abwichen:
1. ein ausdifferenziertes Wertebewusstsein, dass vom Drogenverkauf und
bestimmtem delinquentem Verhalten über die dezidierte Ablehnung von
Waffen, Gewalt, Genussmittel- und Drogenmissbrauch bis hin zu einer
Statuszuschreibung reicht, die dem gesellschaftlichen Mainstream entspricht
2. eine weitreichende Kenntnis von und Sensibilisierung für den Widerspruch
zwischen der öffentlichen Debatte über dt.-türkische Jugendliche einerseits
und ihren tatsächlichen Werteorientierungen anderseits und das dezidiert
geäußerte Bedürfnis, beide Diskurse zu harmonisieren
Beispiele:
- Bandenführer Ibo: Statuszuschreibung und Autorität durch
abgeschlossene Ausbildung, Job, eigene Wohnung
- Erziehung junger Gruppenmitglieder zu „rechtschaffenem“ Verhalten
(kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen) durch höhergestellte
Gruppenmitglieder
- Gruppensolidarität geht über politische und kulturelle Grenzen
hinweg: Türkisch dominierte Gruppe integriert kurdische Mitglieder
Als Fragen für meinen Vortrag ergeben sich aus diesen Schlaglichtern:
1. Bandengründungen und Gruppendelinquenz werden häufig als kulturell
bedingte Phänomene dargestellt. Zu welchen Ergebnissen kommt die
soziologische und ethnologische Forschung hinsichtlich dieser Frage?
2. In welcher Beziehung stehen öffentliche Diskurse über dt.-türk. Jugendliche
(z.B. Ghettoisierung, Eherbegriff/Schiffauer, religiöser Fundamentalismus/
Heitmeyer) zur tatsächlichen Lebenswirklichkeit und Werteorientierung
dieser Jugendlichen?
3. Dt.-türk. Jugendliche der zweiten und dritten Generation wurden oft als
„verlorenen Generation“ tituliert. Wie gehen die Jugendliche mit dieser
Stigmatisierung um, und inwieweit ist dieses Bild heute noch stichhaltig?
4. Seit Mitte der 90er Jahre erregte eine neue transnationale Jugendkultur
(HipHop, Breakdance, Graffiti u.a.) große öffentliche Aufmerksamkeit. Wie
ist diese Kultur entstanden, und welche Auswirkungen hat sie Kultur auf das
Selbstverständnis und die Lebenswirklichkeit dt.-türk. Jugendlicher?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Jugendgang: Eine Begriffsgeschichte
- Chicago School
- 50er-80er Jahre
- Vergleich USA/Deutschland
- Türkische Jugendkulturen in Deutschland
- Öffentliche Diskurse: Ghetto, Eherbegriff, Fundamentalismus
- Ökonomisches, soziales und symbolisches Kapital
- Marginalität und Subkultur
- Selbst- und Fremdzuschreibung
- HipHop-Gruppen in Berlin-Kreuzberg
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Skript befasst sich mit der Begriffsgeschichte und Diskurskritik von türkischen Jugendkulturen in Deutschland. Es untersucht die Entstehung des Konzepts der „Jugendgang“ und beleuchtet die Entwicklung der öffentlichen Diskurse über türkische Jugendkulturen, insbesondere im Kontext von Ghettoisierung, Eherbegriff und Fundamentalismus. Das Skript analysiert zudem die soziale und kulturelle Positionierung türkischer Jugendlicher in Deutschland und beleuchtet die Rolle von HipHop-Gruppen als Ausdruck jugendlicher Identität und Lebenswirklichkeit.
- Begriffsgeschichte der „Jugendgang“
- Öffentliche Diskurse über türkische Jugendkulturen
- Soziale und kulturelle Positionierung türkischer Jugendlicher
- Rolle von HipHop-Gruppen
- Selbst- und Fremdzuschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einführung beschreibt die Entstehung des Skripts aus der persönlichen Erfahrung des Autors während einer Projektarbeit mit marginalisierten türkischen Jugendlichen in Berlin-Kreuzberg. Es werden zentrale Beobachtungsergebnisse und Fragestellungen vorgestellt, die im weiteren Verlauf des Skripts beleuchtet werden.
Jugendgang: Eine Begriffsgeschichte
Dieser Abschnitt analysiert die Entwicklung des Konzepts der „Jugendgang“ in den USA und Deutschland. Die Chicago School of Urban Sociology wird vorgestellt, sowie deren Fokus auf die zweite Einwanderergeneration und die Herausforderungen der Akkulturation. Die Entwicklung der „Jugendgang“-Forschung in den USA der 50er-80er Jahre wird ebenfalls beleuchtet, wobei die Bedeutung sozialer und ökonomischer Faktoren für die Persistenz der „Banden“-Subkultur hervorgehoben wird. Schließlich wird ein Vergleich zwischen den USA und Deutschland im Hinblick auf die „Ghetto“-Bildung und die soziale Positionierung von Einwandererkindern gezogen.
Türkische Jugendkulturen in Deutschland
Dieser Teil behandelt die öffentlichen Diskurse über türkische Jugendkulturen in Deutschland. Es werden verschiedene Studien und Sichtweisen vorgestellt, die von Ghettoisierung, Eherbegriff und Fundamentalismus ausgehen. Die Studie „Gewalt der Ehre“ von Schiffauer wird kritisch beleuchtet, ebenso wie die Bielefelder Untersuchung „Verlockender Fundamentalismus“ von Heitmeyer. Die Einordnung dieser Diskurse in den Kontext der allgemeinen Zuwanderungsdebatte in Deutschland wird ebenfalls analysiert.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter des Skripts sind: Jugendgang, Begriffsgeschichte, Türkische Jugendkulturen, Ghettoisierung, Eherbegriff, Fundamentalismus, Marginalisierung, Subkultur, HipHop, Selbst- und Fremdzuschreibung, Integration, Diskurskritik.
- Arbeit zitieren
- Clemens Grün (Autor:in), 2003, HipHop, Banden, Subkultur - Türkische Jugendkulturen in Frankfurt und Berlin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14917