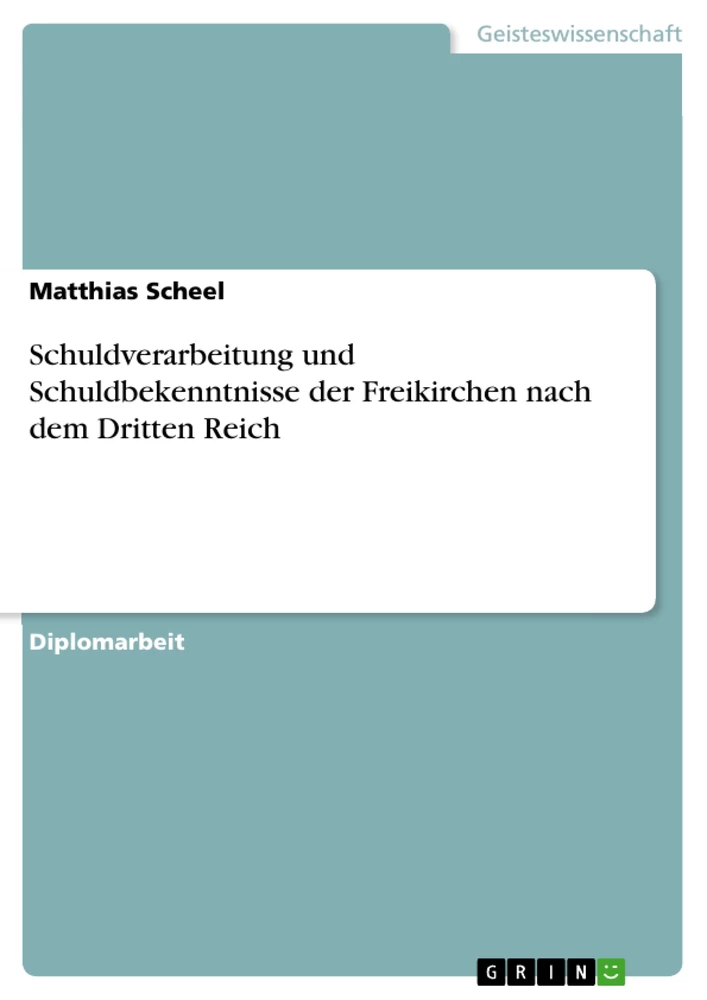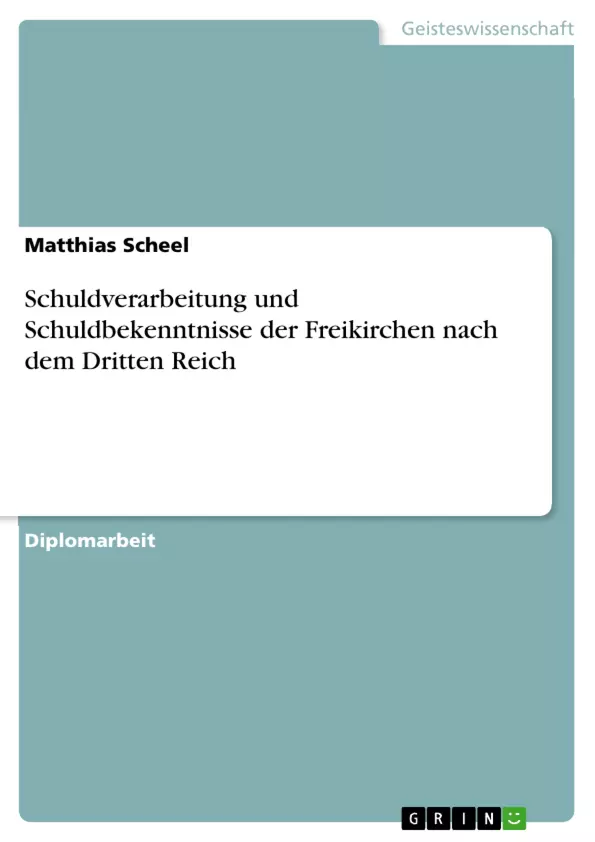Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, anhand der Betrachtung dreier Freikirchen deren Prozesse der Vergangenheitsbewältigung und Schuldverarbeitung in Bezug auf das eigene Verhalten im Dritten Reich darzustellen und miteinander zu vergleichen. Ein besonderer Fokus soll dabei auf den offiziellen Erklärungen der drei Freikirchen zu Verhalten, Schuld und Versagen im NS-Deutschland liegen.
Die Arbeit beginnt mit einer sehr allgemeinen Betrachtung über „Lage und Verhalten der Freikirchen im Dritten Reich“.
Wegen der ungeheuren Größe des Themas beschränke ich mich hierbei und im Folgenden auf die Bischöflich methodistische Kirche , den Bund der Baptistengemeinden (ab 1941 Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden) und die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, wobei letztere ob des leichteren Zugangs zu Quellenliteratur den Schwerpunkt bildet. Für die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten erfolgt darüber hinaus eine gesonderte, kurze Skizzierung der eigenen Lage im Dritten Reich, da die Gemeinschaft zur damaligen Zeit nicht Mitglied in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) war und auch kaum als Freikirche angesehen wurde. Es wird sich aber zeigen, dass sich ihr Verhalten während und nach der NS-Zeit nicht wesentlich unterschied von dem anderer Freikirchen. Nach der Darstellung der Schuld- und Vergangenheitsverarbeitung anhand öffentlicher und persönlicher Stellungnahmen, Dokumenten und Verlautbarungen werden in einem dritten Schritt die offiziellen Erklärungen der drei Freikirchen zu Verhalten, Schuld und Versagen im Dritten Reich auf inhaltliche sowie äußere Aspekte (Entstehungszeit und -anlass, Veröffentlichung und Wirkung des Textes) untersucht und anschließend miteinander verglichen.
In der folgenden Erarbeitung soll das Bewusstsein leitend sein, dass die Betrachtung von Schuld und Schuldverarbeitung aus einer Außenperspektive immer in der Gefahr steht, zu einer „Schuldzuweisung“ und damit selbst zu „Schuld“ zu werden, wenn nur noch das Versagen und nicht mehr die Menschen in ihren spezifischen Lebenssituationen gesehen werden. Um der Glaubhaftigkeit der christlichen Kirchen und ihrer Gläubigen willen ist es dennoch unbedingt erforderlich, dass das eigene Verhalten vor dem Hintergrund der Bibel – das heißt vor ethischen und theologischen Gesichtspunkten - ständig reflektiert wird, um mögliches Fehlverhalten zu erkennen, vor Gott und Menschen um Vergebung bitten zu können und frei zu werden für Gegenwart und Zukunft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lage und Verhalten der Freikirchen im Dritten Reich
- Schuldverarbeitung der Freikirchen in der Zeit nach der NS-Diktatur
- Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
- Die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten im Dritten Reich
- Die Schuldfrage in der Zeit des Umbruchs
- Erste Ansätze einer Rede von „Schuld“ in der adventistischen Zeitschrift „Der Botschafter“
- Schuldverarbeitung in den 70er und 80er Jahren
- Erste Anträge auf ein Schuldbekenntnis in den 80er Jahren
- Die Entwicklung in der DDR
- Die Entwicklung in der BRD
- Erste Anträge auf ein Schuldbekenntnis in den 80er Jahren
- Die Nachwendezeit
- Die Erklärung zum 50. Jahrestag des Kriegsendes 1995
- Die Erklärung der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und Österreich zum 60. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945
- Zusammenfassung und Bewertung
- Die Methodistenkirche in Deutschland
- Die BMKD am Ende des Zweiten Weltkrieges
- Die Frage nach der „Schuld“ und die „Brüderliche Resolution an die Gemeinden“ vom 25./26. Juli 1945
- Die „Erklärung [der Methodistenkirche] über die Stellung der Kirche zur gegenwärtigen Lage“ vom Dezember 1945
- Weitere Verlautbarungen zum Verhalten der BMKD im Dritten Reich aus dem Jahr 1946
- Die „Entschließung“ an die Gemeinden vom Februar 1946
- Die „Botschaft an die Mutterkirche“ vom Mai 1946
- „Botschaft von Bischof F. H. Otto Melle“ an die Zentralkonferenz vom November 1946
- Das gemeinsame Wort der evangelisch-methodistischen Kirche der BRD und der DDR anlässlich des 50. Jahrestages der Reichspogromnacht vom 9. November 1938
- Zusammenfassung
- Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
- Der deutsche Baptismus am Ende des Krieges
- Nachkriegsrundbrief vom 25. Juni 1945
- Die „Brüderliche Resolution“ vom 25./26. Juli 1945
- „Unser Weg“ – der Rechenschaftsbericht von Paul Schmidt
- Ernsthafte Mahner
- Das Schuldbekenntnis des BEFG in der BRD 1984
- Nachwirkungen der Erklärung von 1984
- Zusammenfassung
- Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
- Die Erklärungen im Vergleich
- Die „Erklärung [der Methodistenkirche] über die Stellung der Kirche zur gegenwärtigen Lage“ vom Dezember 1945
- Das „Hamburger Schuldbekenntnis“ des [westdeutschen] Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden von 1984
- Die Erklärung der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und Österreich zum 60. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945
- Zusammenfassung und Vergleich
- Auswertung und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Schuldverarbeitung und Schuldbekenntnisse verschiedener Freikirchen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ziel ist es, die unterschiedlichen Reaktionen und Strategien der Methodisten, Baptisten und Siebenten-Tags-Adventisten auf ihr Verhalten während des Nationalsozialismus zu analysieren und zu vergleichen.
- Reaktionen der Freikirchen auf die NS-Zeit
- Formulierung und Inhalt von Schuldbekenntnissen
- Theologische und gesellschaftliche Kontexte der Schuldverarbeitung
- Vergleichende Analyse verschiedener Freikirchen
- Langfristige Auswirkungen der Schuldverarbeitungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand, die Methodik und die Zielsetzung der Arbeit. Sie skizziert den historischen Kontext und die Bedeutung der Thematik im Hinblick auf die Aufarbeitung der Vergangenheit.
Lage und Verhalten der Freikirchen im Dritten Reich: Dieses Kapitel beleuchtet das Verhalten der verschiedenen Freikirchen während der NS-Zeit, indem es ihre jeweilige politische Haltung und ihr Verhältnis zum NS-Regime darstellt. Es wird untersucht, inwieweit sie sich dem Regime anpassten oder Widerstand leisteten.
Schuldverarbeitung der Freikirchen in der Zeit nach der NS-Diktatur: Dieses Kapitel analysiert die Prozesse der Schuldverarbeitung bei den einzelnen Freikirchen nach dem Krieg. Es werden die jeweiligen Reaktionen auf die Verbrechen des Nationalsozialismus, die Herausbildung von Schuldbekenntnissen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit untersucht.
Die Erklärungen im Vergleich: Hier werden die Schuldbekenntnisse der verschiedenen Freikirchen hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer Sprache und ihrer theologischen Argumentationen verglichen und bewertet. Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden herausgestellt und in den historischen Kontext eingeordnet.
Schlüsselwörter
Schuldverarbeitung, Schuldbekenntnis, Freikirchen, Nationalsozialismus, Drittes Reich, Methodistenkirche, Siebenten-Tags-Adventisten, Baptisten, Nachkriegszeit, DDR, BRD, Theologie, Geschichte, Erinnerungskultur.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Schuldverarbeitung in deutschen Freikirchen nach dem Zweiten Weltkrieg
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Schuldverarbeitung und die Schuldbekenntnisse verschiedener Freikirchen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Fokus stehen die Methodisten, Baptisten und Siebenten-Tags-Adventisten.
Welche Freikirchen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die Reaktionen und Strategien der Methodistenkirche, des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten) und der Siebenten-Tags-Adventisten auf ihr Verhalten während des Nationalsozialismus.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist der Vergleich der unterschiedlichen Reaktionen und Strategien dieser Freikirchen auf ihr Handeln während der NS-Zeit und die Analyse ihrer Schuldverarbeitungsprozesse.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Reaktionen der Freikirchen auf die NS-Zeit, die Formulierung und den Inhalt von Schuldbekenntnissen, die theologischen und gesellschaftlichen Kontexte der Schuldverarbeitung, einen vergleichenden Ansatz verschiedener Freikirchen und die langfristigen Auswirkungen der Schuldverarbeitungsprozesse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über die Lage und das Verhalten der Freikirchen im Dritten Reich, ein Kapitel zur Schuldverarbeitung nach der NS-Diktatur (mit detaillierten Unterkapiteln zu den einzelnen Freikirchen), ein Kapitel zum Vergleich der verschiedenen Erklärungen und Schuldbekenntnisse, und abschließend eine Auswertung und Schlussbetrachtung.
Wie werden die Schuldbekenntnisse der verschiedenen Freikirchen verglichen?
Das Kapitel „Die Erklärungen im Vergleich“ analysiert Aufbau, Sprache und theologische Argumentationen der Schuldbekenntnisse der untersuchten Freikirchen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden herausgestellt und in den historischen Kontext eingeordnet.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Analyse von offiziellen Erklärungen, Verlautbarungen, Zeitschriftenartikeln und weiteren Dokumenten der jeweiligen Freikirchen, um die Schuldverarbeitungsprozesse nachzuvollziehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schuldverarbeitung, Schuldbekenntnis, Freikirchen, Nationalsozialismus, Drittes Reich, Methodistenkirche, Siebenten-Tags-Adventisten, Baptisten, Nachkriegszeit, DDR, BRD, Theologie, Geschichte, Erinnerungskultur.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist übersichtlich strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, einer klaren Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und einer Liste der Schlüsselwörter. Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf und führen zu einer umfassenden Analyse der Thematik.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bietet einen Überblick. Detaillierte Informationen finden sich im vollständigen Text der Diplomarbeit.
- Quote paper
- Matthias Scheel (Author), 2007, Schuldverarbeitung und Schuldbekenntnisse der Freikirchen nach dem Dritten Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149212