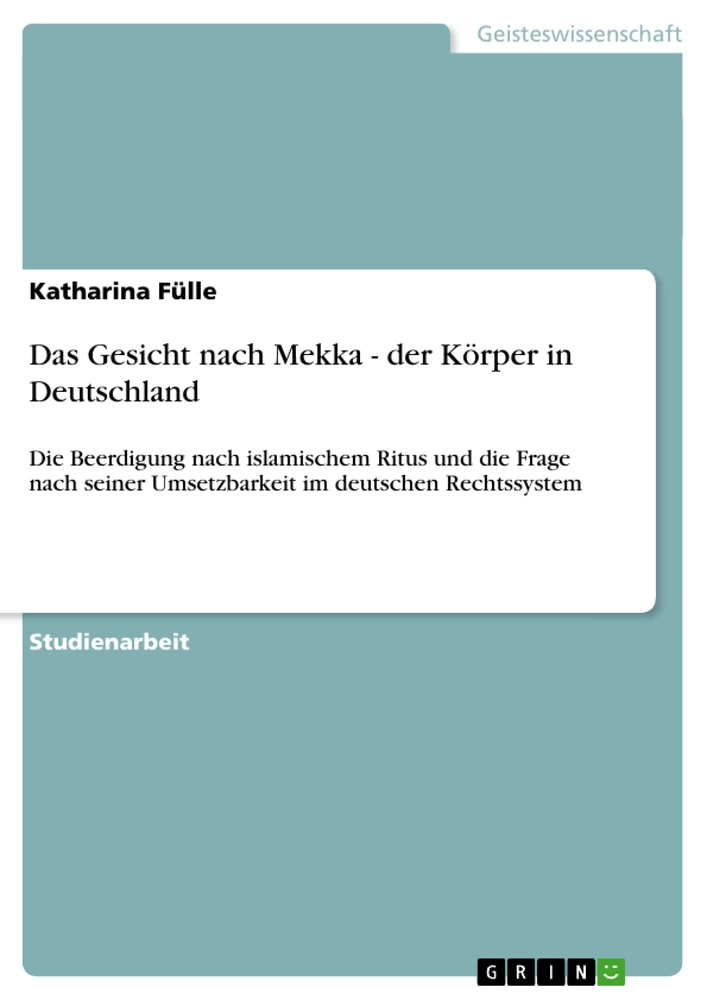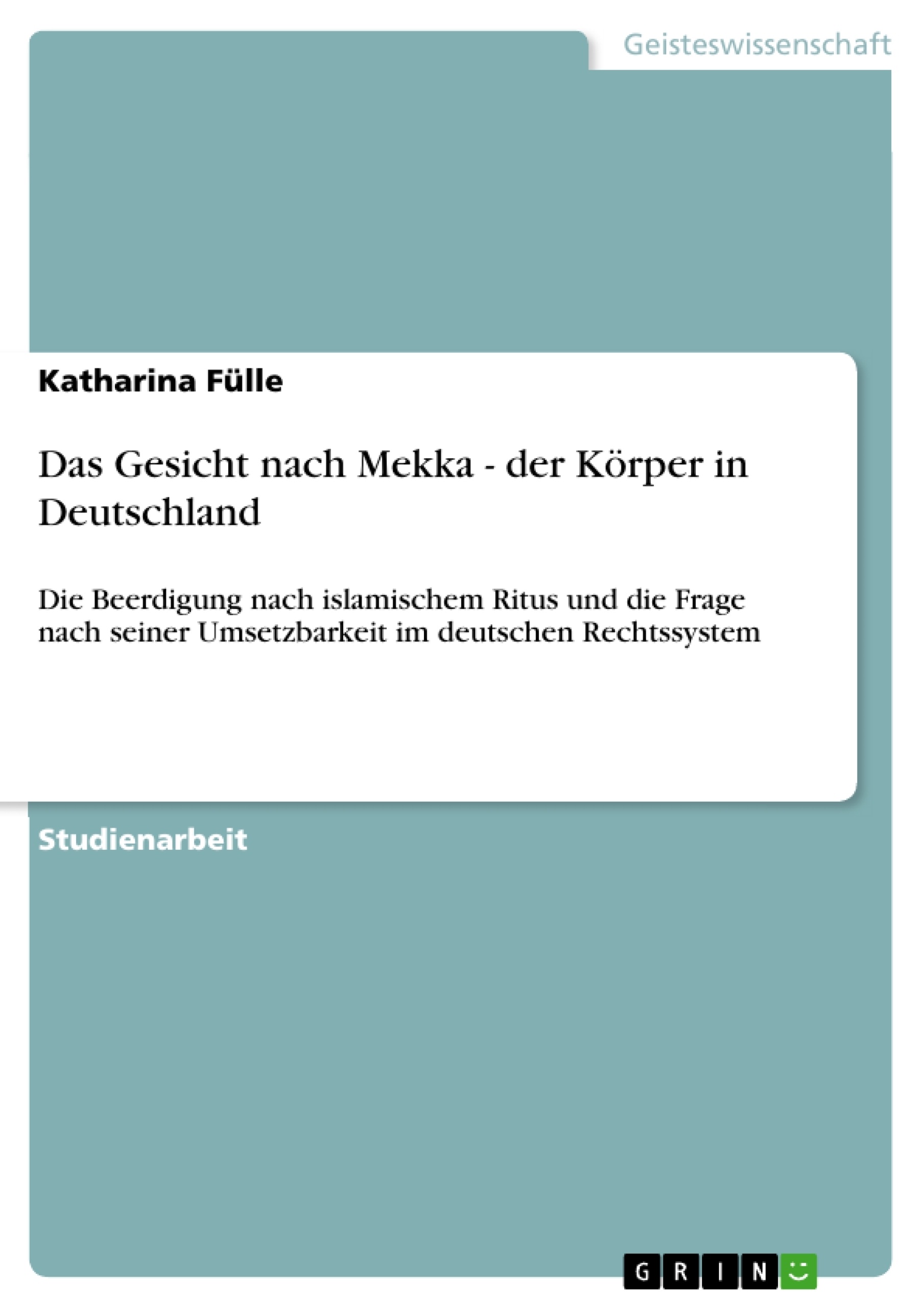Diese Arbeit will anhand vier ausgesuchter Aspekte des islamischen Bestattungsritus der Frage nach seiner Umsetzbarkeit in Deutschland nachgehen. Um in den vielschichtigen Themenbereich der islamischen Eschatologie, die damit einhergehenden Riten und ihre herausragende Bedeutung im muslimischen Glauben einzuführen, bedarf es einer umfangreichen Einleitung. Demnach macht die Beschreibung der
islamischen Glaubensgrundlagen etwa die Hälfte des Umfangs dieser Arbeit aus (Kapitel 2-3). Zu Beginn werden die anthropologischen Grundannahmen des Islams umrissen, die
die Basis und den Ausgangspunkt für die religiösen Einstellungen zu Tod und Bestattung
bilden. Im dritten Kapitel folgt eine allgemeine Darstellung der religiösen
Riten, die mit der Beerdigung einhergehen. Zu Gunsten der Übersichtlichkeit wurde
dieser Themenbereich noch einmal in zwei Kapitel unterteilt, wobei zuerst die gängigen
Riten zur Vorbereitung auf die Grablegung und in Kapitel 3.2 anschließend die
Beerdigungsriten an sich erläutert werden. Diese Vorausnahmen sind unerlässlich für
das vierte und letzte Kapitel des Hauptteils. Denn, um die Einschränkung der Ausübung
muslimischer Riten in Deutschland juristisch begründen zu können, ist zum
einen die Darstellung dieser Riten und des Weiteren deren Bedeutung sowie deren
eindeutige Zuordnung zum Islam von großem Gewicht. Das vierte Kapitel ist in vier
Unterpunkte geteilt, die die erwähnten, auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfenden Aspekte
präsentieren. Die Gebote der Totenwaschung (Kapitel 4.1), der Grablegungsfrist
(Kapitel 4.2), des Sargverzichts (Kapitel 4.3) und der ewigen Totenruhe (Kapitel 4.4)
wurden auf Grund ihrer Konformität innerhalb der islamischen Welt ausgewählt. Sie
gelten in nahezu allen Rechtsschulen und religiösen Ausrichtungen des Islam als
allgemein verbindlich.
Die Relevanz dieses Themas ergibt sich aus den zahlreichen nationalen wie internationalen
Diskussionen zur Integration von muslimischen Migranten verschiedener
Nationen in mehrheitlich nicht-muslimischen Ländern. Der Themenbereich Bestattung
und Tod muslimischer Bürger scheint vor allem für Deutschland von besonderer
Bedeutung zu sein. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Leben als übergeordneter Wert und die Unausweichlichkeit des Todes
- 3 Der islamische Beerdigungsritus
- 3.1 Der Dienst am Toten als religiöse Pflicht
- 3.2 Vorgaben zur Grablegung und Grabstätte
- 4 In fremder Erde – Beschränkung islamischer Beerdigungsriten durch das deutsche Recht
- 4.1 Gibt das Gebot der rituellen Waschung ein Recht auf Infrastruktur?
- 4.2 „Die Zeit befiehlt's, ihr sind wir Untertan“
- 4.3 Sargzwang als Schutz für Gesundheit und Umwelt
- 4.4 Ewig eigene Friedhöfe
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzbarkeit des islamischen Bestattungsritus in Deutschland anhand vier ausgewählter Aspekte. Sie beginnt mit einer Erläuterung der islamischen Glaubensgrundlagen bezüglich Tod und Bestattung, um den Kontext für die spätere juristische Betrachtung zu schaffen. Die Arbeit fokussiert auf die praktische Anwendung religiöser Riten im deutschen Rechtssystem.
- Islamische Anthropologie und Eschatologie
- Der islamische Beerdigungsritus ( rituelle Waschung, Grablegung)
- Juristische Herausforderungen der Umsetzung islamischer Bestattungsriten in Deutschland
- Konflikt zwischen islamischem Recht und deutschem Recht bezüglich Bestattung
- Integration muslimischer Migranten und die Bedeutung von islamisch konformen Friedhöfen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Umsetzbarkeit des islamischen Bestattungsritus in Deutschland anhand vier ausgewählter Aspekte. Sie erläutert den Aufbau der Arbeit und betont die Bedeutung der umfassenden Darstellung der islamischen Glaubensgrundlagen, die etwa die Hälfte des Umfangs ausmacht (Kapitel 2-3), um die spätere juristische Analyse fundiert zu gestalten. Der Fokus liegt auf der Darstellung der islamischen Riten und ihrer Bedeutung für die spätere Prüfung ihrer Einschränkungen im deutschen Rechtssystem.
2 Das Leben als übergeordneter Wert und die Unausweichlichkeit des Todes: Dieses Kapitel beleuchtet die anthropologischen Grundannahmen des Islams, die die Basis für die religiösen Einstellungen zu Tod und Bestattung bilden. Es erklärt, wie der Islam Leben und Tod als gottgegeben betrachtet und den Tod nicht als Folge von Sünde, sondern als Rückkehr zu Gott versteht. Der Tod ist zwar unausweichlich, aber sein Zeitpunkt und Ort sind allein von Gott bestimmt. Das Kapitel widerlegt außerdem die Vorstellung einer Wiedergeburt oder eines Weiterlebens des menschlichen Geistes in Tiergestalt, wie sie in einigen Regionen existiert, und beschreibt die allgemeine muslimische Auffassung vom Tod der Seele mit dem Körper und dem Verweilen im Grab bis zum Jüngsten Gericht. Die Betonung des Lebens als übergeordneten Wertes steht nicht im Gegensatz zur Unausweichlichkeit des Todes, sondern unterstreicht die Wertschätzung des von Gott anvertrauten Gutes Leib und Seele, die geschützt werden sollen.
3 Der islamische Beerdigungsritus: Dieses Kapitel beschreibt die religiösen Riten, die mit der islamischen Beerdigung einhergehen. Es gliedert sich in zwei Unterkapitel: Kapitel 3.1 behandelt die Riten zur Vorbereitung auf die Grablegung (z.B. rituelle Waschung), während Kapitel 3.2 die eigentlichen Beerdigungsriten erläutert. Die ausführliche Darstellung dieser Riten ist essentiell für das Verständnis der späteren Kapitel, in denen die Einschränkungen dieser Riten im deutschen Rechtssystem diskutiert werden. Die detaillierte Beschreibung der Rituale dient als Grundlage für die juristische Analyse der folgenden Kapitel.
4 In fremder Erde – Beschränkung islamischer Beerdigungsriten durch das deutsche Recht: Dieses Kapitel analysiert vier Aspekte des islamischen Bestattungsritus, die im deutschen Rechtssystem auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden: das Gebot der rituellen Waschung (Kapitel 4.1), die Grablegungsfrist (Kapitel 4.2), der Sargverzicht (Kapitel 4.3) und die ewige Totenruhe (Kapitel 4.4). Diese Aspekte wurden aufgrund ihrer weitgehenden Übereinstimmung in verschiedenen islamischen Rechtsschulen ausgewählt. Die Kapitel untersuchen die rechtlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich aus der Umsetzung dieser Riten in Deutschland ergeben. Es wird auf den Konflikt zwischen religiösen Geboten und gesetzlichen Bestimmungen eingegangen, z.B. dem Sargzwang aus gesundheitlichen und umweltschützenden Gründen.
Schlüsselwörter
Islamischer Bestattungsritus, Deutsches Recht, Integration, Muslimische Migranten, Rituelle Waschung, Grablegung, Sargverzicht, Ewiges Grabrecht, Eschatologie, Anthropologie, Glaubensgrundsätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umsetzbarkeit des islamischen Bestattungsritus in Deutschland
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Umsetzbarkeit des islamischen Bestattungsritus in Deutschland. Sie analysiert die praktischen Herausforderungen, die sich aus der Umsetzung religiöser Riten im deutschen Rechtssystem ergeben, und fokussiert auf den Konflikt zwischen islamischem und deutschem Recht bezüglich Bestattungen.
Welche Aspekte des islamischen Bestattungsritus werden untersucht?
Die Arbeit untersucht vier ausgewählte Aspekte: das Gebot der rituellen Waschung, die Grablegungsfrist, den Sargverzicht und die ewige Totenruhe. Diese Aspekte wurden aufgrund ihrer weitgehenden Übereinstimmung in verschiedenen islamischen Rechtsschulen ausgewählt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aufbau erläutert. Es folgen Kapitel, die die islamischen Glaubensgrundlagen bezüglich Tod und Bestattung (Anthropologie und Eschatologie) und den islamischen Beerdigungsritus im Detail beschreiben. Der Hauptteil analysiert dann die juristischen Herausforderungen der Umsetzung dieser Riten in Deutschland, wobei der Konflikt zwischen islamischem und deutschem Recht im Fokus steht. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Welche islamischen Glaubensgrundlagen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die anthropologischen Grundannahmen des Islams bezüglich Leben und Tod. Sie erklärt die islamische Sichtweise auf den Tod als Rückkehr zu Gott und widerlegt alternative Vorstellungen wie Wiedergeburt. Der übergeordnete Wert des Lebens und die Unausweichlichkeit des Todes werden in Beziehung gesetzt.
Wie wird der islamische Beerdigungsritus beschrieben?
Der islamische Beerdigungsritus wird detailliert beschrieben, einschließlich der rituellen Waschung und der Grablegungsriten. Diese ausführliche Darstellung dient als Grundlage für die spätere juristische Analyse.
Welche rechtlichen Herausforderungen werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert den Konflikt zwischen den religiösen Geboten des islamischen Bestattungsritus und den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland. Konkret werden die rechtlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen bezüglich der rituellen Waschung, der Grablegungsfrist, des Sargzwangs (aus gesundheitlichen und umweltschützenden Gründen) und des ewigen Grabrechts diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Islamischer Bestattungsritus, Deutsches Recht, Integration, Muslimische Migranten, Rituelle Waschung, Grablegung, Sargverzicht, Ewiges Grabrecht, Eschatologie, Anthropologie, Glaubensgrundsätze.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Umsetzbarkeit des islamischen Bestattungsritus in Deutschland zu untersuchen und die Herausforderungen für die Integration muslimischer Migranten in diesem Kontext aufzuzeigen.
Welche Kapitel sind enthalten?
Die Arbeit enthält folgende Kapitel: Einleitung, Das Leben als übergeordneter Wert und die Unausweichlichkeit des Todes, Der islamische Beerdigungsritus, In fremder Erde – Beschränkung islamischer Beerdigungsriten durch das deutsche Recht, und Schlussbetrachtung. Kapitel 3 und 4 sind jeweils weiter unterteilt in Unterkapitel.
- Arbeit zitieren
- Katharina Fülle (Autor:in), 2009, Das Gesicht nach Mekka - der Körper in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149246