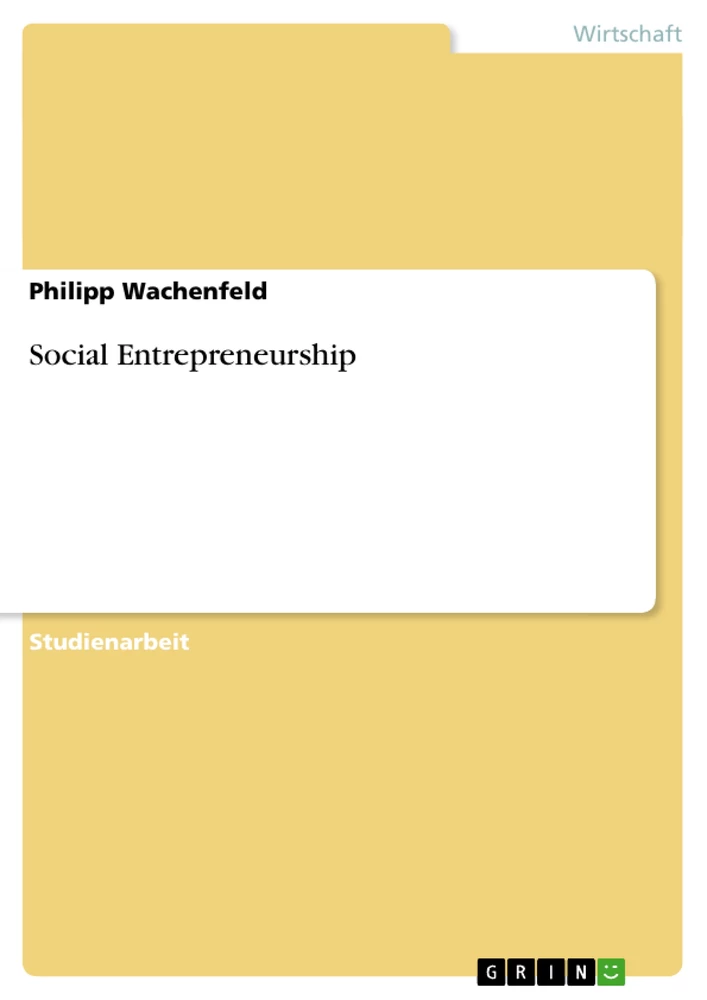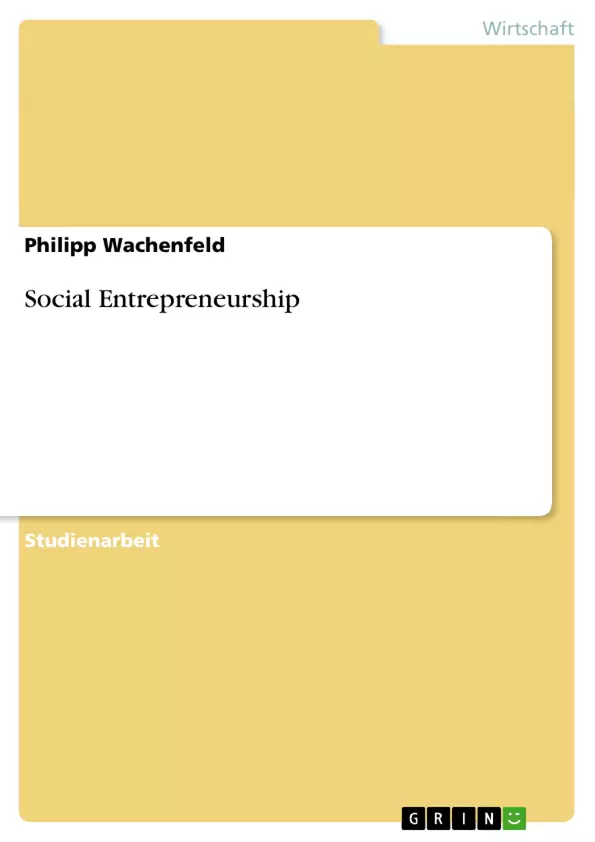Der Begriff Social Entrepreneurship gewinnt in jüngerer Zeit an Popularität. Er wird immer mehr in der Öffentlichkeit, den Medien und in der Wissenschaft verwendet. Auch die Verleihung des Friedensnobelpreises 2006 an Muhammad Yunus, ein „Paradebeispiel eines Social Entrepreneurs“ (Achleitner et al. 2007, S. 4), verhalf der Bekanntheit von Social Entrepreneurship zu einem weiteren Schub (Faltin 2008, S. 27; Martin/Osberg 2007, S. 30).
Dabei gibt es Social Entrepreneure, für die sich auf Deutsch der Begriff Sozialunternehmer etabliert hat, schon länger (Dees 2001, S.1). Als historische Beispiele nennen Faltin (2008, S. 26) und Achleitner (2007, S. 2) Henri Durant (Gründer des Roten Kreuzes) und Maria Montessori, die das nach ihr benannte Schulsystem entwarf.
Doch was genau ist eigentlich Social Entrepreneurship? Und wie kann man diesen Begriff abgrenzen zum „gewöhnlichen“ Unternehmertum? Sind die Unterschiede vielleicht doch kleiner als man auf den ersten Blick denkt? Was genau macht den Social Entrepreneur aus? Diese Fragen versucht der Autor mit der vorliegenden Seminararbeit zu beantworten. Faltin (2008, S. 38) stellt eine Konvergenzthese auf und sagt: „Der Unterschied zwischen den Social Entrepreneurs und den Business Entrepreneurs ist bei genauerer Betrachtung kleiner als er in der öffentlichen Diskussion gesehen wird.“
Zunächst wird dabei die historische Entwicklung des Unternehmerbegriffs aufgezeigt (Kapitel 2), ehe dann im speziellen auf Social Entrepreneurship eingegangen wird (Kapitel 3). Dies scheint notwendig, gehen doch die Vorstellungen, was man unter diesem „Phänomen“ versteht, aktuell weit auseinander. Martin/Osberg (2007, S. 30) sprechen in diesem Zusammenhang von einer großen Definitionsvielfalt und ergänzen bildlich: „As a result, social entrepreneurship has become so inclusive that it now has an immense tent into which all manner of socially beneficial activities fit.” Zum Schluss (Kapitel 4) werden die wichtigsten Aspekte der Arbeit noch einmal aufgegriffen und es wird ein Ausblick auf die mögliche weitere Entwicklung von Social Entrepreneurship gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis / Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Zur Entwicklung des Unternehmerbegriffs
- Social Entrepreneurship
- Wie kam der Begriff zu solch einer Bedeutung?
- Begriffsdefinition
- Muhammad Yunus und die Grameen Bank
- Business Entrepreneurship vs. Social Entrepreneurship
- Abgrenzungen zu anderen Begriffen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Begriff Social Entrepreneurship und dessen Abgrenzung zum traditionellen Unternehmertum. Ziel ist es, die Entwicklung des Unternehmerbegriffs aufzuzeigen und die Besonderheiten von Social Entrepreneurship zu beleuchten. Dabei wird die Bedeutung des Begriffs, seine Definition und die Rolle von Muhammad Yunus als Vorreiter des Social Entrepreneurship untersucht. Außerdem werden die Unterschiede zwischen Business Entrepreneurship und Social Entrepreneurship sowie Abgrenzungen zu anderen Begriffen wie z.B. Non-Profit-Organisationen und Sozialunternehmen betrachtet.
- Entwicklung des Unternehmerbegriffs
- Definition und Bedeutung von Social Entrepreneurship
- Rolle von Muhammad Yunus und der Grameen Bank
- Unterschiede zwischen Business Entrepreneurship und Social Entrepreneurship
- Abgrenzung zu anderen Begriffen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stellenwert von Social Entrepreneurship in der Öffentlichkeit, den Medien und der Wissenschaft beleuchtet. Anschließend wird die historische Entwicklung des Unternehmerbegriffs von Jean Baptiste Say über Joseph Schumpeter bis hin zu Frank Knight dargestellt. Dabei wird die Bedeutung des Entrepreneurs als Werte-Schöpfer und Innovator hervorgehoben.
Im dritten Kapitel wird Social Entrepreneurship im Detail betrachtet. Es wird die Entstehung des Begriffs, seine Definition und die Rolle von Muhammad Yunus und der Grameen Bank als Vorreiter des Social Entrepreneurship erläutert. Außerdem werden die Unterschiede zwischen Business Entrepreneurship und Social Entrepreneurship sowie Abgrenzungen zu anderen Begriffen wie z.B. Non-Profit-Organisationen und Sozialunternehmen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Social Entrepreneurship, Unternehmerbegriff, Muhammad Yunus, Grameen Bank, Business Entrepreneurship, Non-Profit-Organisationen, Sozialunternehmen, Innovation, Werte-Schöpfung, soziale Nachhaltigkeit, Entwicklung des Unternehmerbegriffs.
Häufig gestellte Fragen
Was genau ist Social Entrepreneurship?
Social Entrepreneurship (Sozialunternehmertum) bezeichnet unternehmerisches Handeln, das primär auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme und soziale Nachhaltigkeit abzielt statt auf reine Gewinnmaximierung.
Wer ist Muhammad Yunus und welche Rolle spielt er?
Muhammad Yunus ist der Gründer der Grameen Bank und Friedensnobelpreisträger. Er gilt als Paradebeispiel eines Social Entrepreneurs, der durch Mikrokredite Armut bekämpft.
Wie unterscheidet sich Social Entrepreneurship von traditionellen NGOs?
Während NGOs oft auf Spenden angewiesen sind, nutzen Social Entrepreneure geschäftliche Modelle, um ihre sozialen Ziele finanziell unabhängig und dauerhaft zu erreichen.
Ist der Unterschied zwischen Business und Social Entrepreneurs wirklich so groß?
Laut der Konvergenztheorie von Faltin ist der Unterschied kleiner als oft gedacht, da beide Innovationen nutzen und Werte schaffen – nur die Zielsetzung der Wertschöpfung variiert.
Gibt es historische Beispiele für Sozialunternehmer?
Ja, bekannte Beispiele sind Henri Dunant (Rotes Kreuz) und Maria Montessori, die innovative Systeme zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen schufen.
- Quote paper
- Philipp Wachenfeld (Author), 2010, Social Entrepreneurship, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149303