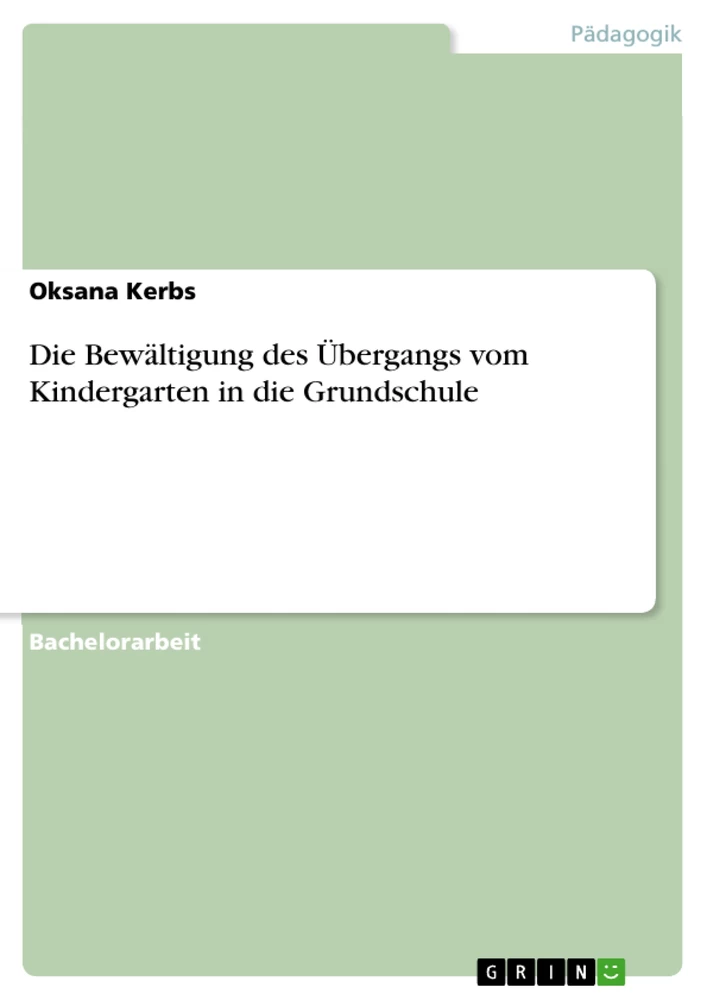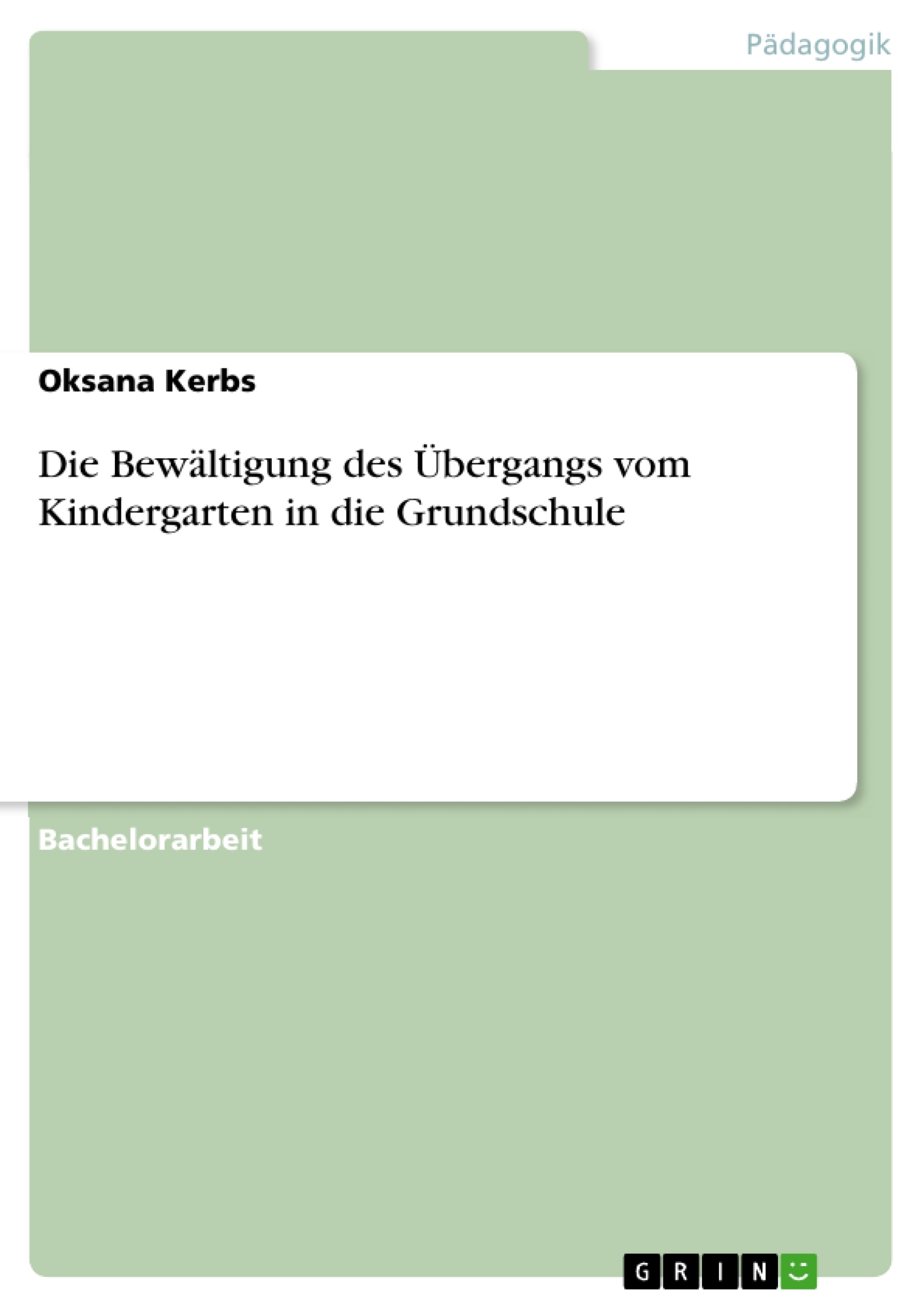Das deutsche Bildungssystem ist durch Übergänge zwischen Familie und Bildungseinrichtung bzw. zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen gekennzeichnet.Dazu gehört auch der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule,welcher in der vorliegenden Arbeit mittels allgemein psychologischer Erkenntnisse von Übergängen, synonym auch Transitionen, thematisiert werden soll.Der Übertritt vom Kindergarten in das formale Schulsystem stellt bereits seit Ende des 20. Jahrhunderts einen Schwerpunkt in der internationalen frühpädagogischen Forschung dar (vgl. BMBF 2007, S. 193). Den Startschuss für das öffentliche Interesse liefert vor allem die siebte Konferenz der European Early Childhood Education Research Association (EECERA) aus dem Jahre 1997 in München, auf der neue Anregungen für die Thematik von Übergängen und den damit verbundenen Diskontinuitäten im Leben des Kindes sowie für die Thematik der frühpädagogischen Qualität vermittelt werden (vgl. Griebel u. Niesel 2003, S. 136; vgl. Griebel u. Niesel 2004, S. 15). Ergebnis des Zusammenkommens ist die Forderung eines Qualitätskonzeptes im vorschulischen Bereich, welches „vor dem Hintergrund der sich veränderten Lebenswirklichkeit von Kindern die Bewältigung von Diskontinuitäten thematisiert und die grundlegenden Kompetenzen dazu fördert(Griebel u. Niesel 2003, S. 136; vgl. BMBF 2007, S. 192).Das rege Interesse der Öffentlichkeit an dieser Thematik kommt nicht von Ungefähr. Spätestens nach dem schlechten Abschneiden in inter- und intranationalen Schulleistungsstudien, wie beispielsweise den PISA-Studien oder den IGLUStudien,werden Forderungen nach Veränderungen und Reformen laut. Dabei stellt sich die Frage, wo besser damit angefangen werden soll, wenn nicht in der Elementar- und Primarbildung? Denn schließlich prägt die Basis den weiteren Bildungsverlauf entscheidend mit. Das erste Kapitel dieser Thesis beschreibt verschiedene Theoriestränge, welche für die Thematik des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule bedeutsam...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Theoretische Forschungsansätze zur Übergangsbewältigung
- Ökopsychologischer Ansatz
- Kontextuelle System-Modell
- Psychologischer Stressansatz
- Perspektive der Lebensspanne
- Modell der kritischen Lebensereignisse
- Transitionsmodell
- Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
- Übergang als Ko-konstruktiver Prozess
- Entwicklungsaufgaben für Kind und Eltern
- Entwicklungsaufgaben auf der individuellen Ebene
- Entwicklungsaufgaben auf der interaktionalen Ebene
- Entwicklungsaufgaben auf der kontextuellen Ebene
- Bewältigung
- Resilienz im Hinblick auf die Übergangsbewältigung
- Kontinuität im Hinblick auf die Übergangsbewältigung
- Diskontinuität im Hinblick auf die Übergangsbewältigung
- Bewältigter Übergang
- Schulfähigkeit
- Schulreife auf Basis der Reifungstheorie
- Schulfähigkeit auf Basis der Eigenschaftstheorie
- Schulfähigkeit auf Basis der Lerntheorie
- Schulfähigkeit auf Basis der Ökopsychologie
- Schulfähigkeit ko-konstruktive Aufgabe
- Vergleich der Institutionen Kindergarten und Grundschule
- Rechtliche Grundlagen
- Organisatorische Grundlagen
- Curriculare Grundlagen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Übergangsgestaltung
- Weiterer Ausbau des vorschulischen Bereichs
- Angleichung des Ausbildungsniveaus von Fach- und Lehrkräften
- Verbesserung einer Kooperation zwischen allen beteiligten Akteuren
- Neue Schuleingangsstufe
- Verbesserung der bildungsprogrammatischen, der strukturellen sowie der personellen Ebenen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis untersucht die Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben, die mit diesem Übergang verbunden sind, aus verschiedenen theoretischen Perspektiven zu beleuchten. Dabei werden wichtige Faktoren für eine gelingende Übergangsbewältigung analysiert und Maßnahmen zur Verbesserung der Gestaltung des Übergangs vorgeschlagen.
- Entwicklungsaufgaben von Kindern und Eltern im Übergangsprozess
- Relevanz von Resilienz und Kontinuität für die Übergangsbewältigung
- Verschiedene Konzepte von Schulfähigkeit und deren Bedeutung für den Übergang
- Vergleich der Institutionen Kindergarten und Grundschule
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zur Übergangsbewältigung, wie den ökopsychologischen Ansatz, das kontextuelle System-Modell und den psychologischen Stressansatz. Es werden außerdem die Perspektive der Lebensspanne, das Modell der kritischen Lebensereignisse und das Transitionsmodell vorgestellt.
Im zweiten Kapitel wird der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule als Ko-konstruktiver Prozess beschrieben. Es werden die Entwicklungsaufgaben von Kindern und Eltern im Übergangsprozess sowie die Bedeutung von Resilienz und Kontinuität für die Übergangsbewältigung behandelt. Außerdem werden verschiedene Konzepte von Schulfähigkeit und deren Bedeutung für den Übergang beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Vergleich der Institutionen Kindergarten und Grundschule. Es werden die rechtlichen, organisatorischen und curricularen Grundlagen der beiden Institutionen gegenübergestellt.
Das vierte Kapitel widmet sich den Maßnahmen zur Verbesserung der Gestaltung des Übergangs. Es werden Vorschläge zur Weiterentwicklung des vorschulischen Bereichs, zur Angleichung des Ausbildungsniveaus von Fach- und Lehrkräften, zur Verbesserung der Kooperation zwischen allen beteiligten Akteuren und zur Einführung einer neuen Schuleingangsstufe vorgestellt.
Schlüsselwörter
Übergangsbewältigung, Kindergarten, Grundschule, Schulfähigkeit, Entwicklungsaufgaben, Resilienz, Kontinuität, Kooperation, Transitionsmodell, Bildungsprogramm.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer "Transition" im Bildungswesen?
Transitionen sind bedeutende Übergänge im Leben eines Kindes, wie der Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule, die Anpassungsleistungen erfordern.
Was bedeutet Schulfähigkeit heute?
Schulfähigkeit wird nicht mehr nur als Reife des Kindes gesehen, sondern als ko-konstruktive Aufgabe zwischen Kind, Eltern, Kindergarten und Schule.
Welche Rolle spielt Resilienz beim Schulübergang?
Resilienz hilft Kindern, Diskontinuitäten und neue Anforderungen im Schulalltag erfolgreich zu bewältigen und gestärkt aus dem Übergang hervorzugehen.
Welche Entwicklungsaufgaben haben Eltern beim Übergang?
Eltern müssen sich auf die neue Rolle als "Schuleltern" einstellen, ihr Kind emotional unterstützen und die Kooperation mit der neuen Institution aufbauen.
Wie kann die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule verbessert werden?
Durch gegenseitige Besuche, gemeinsame Fortbildungen der Lehr- und Fachkräfte sowie abgestimmte Bildungsprogramme kann der Übergang fließender gestaltet werden.
- Citar trabajo
- Oksana Kerbs (Autor), 2009, Die Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149381