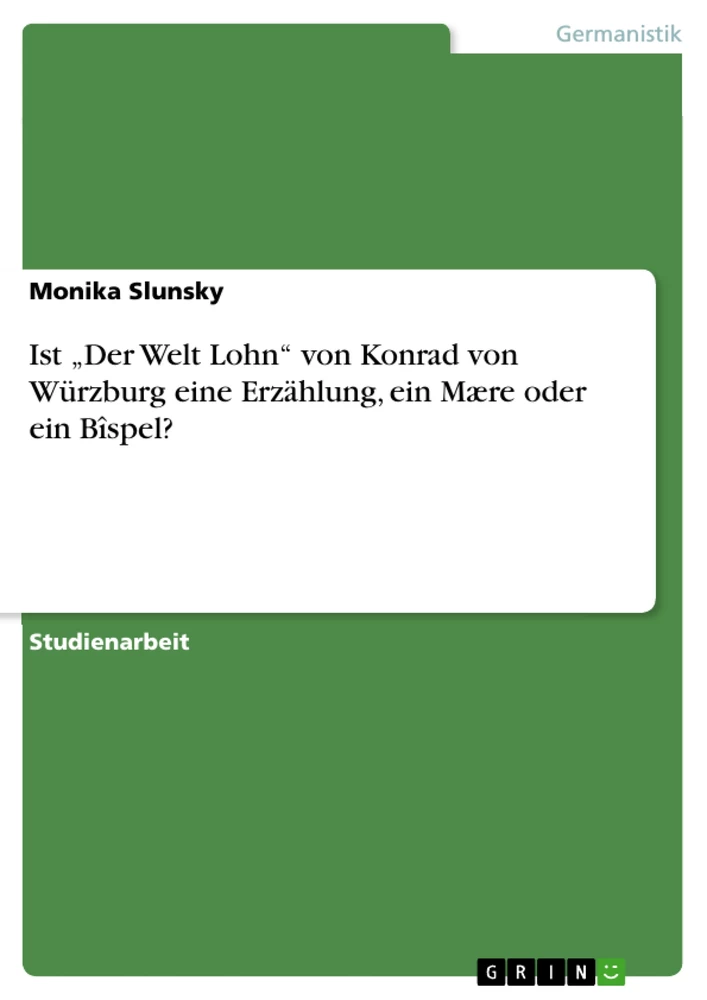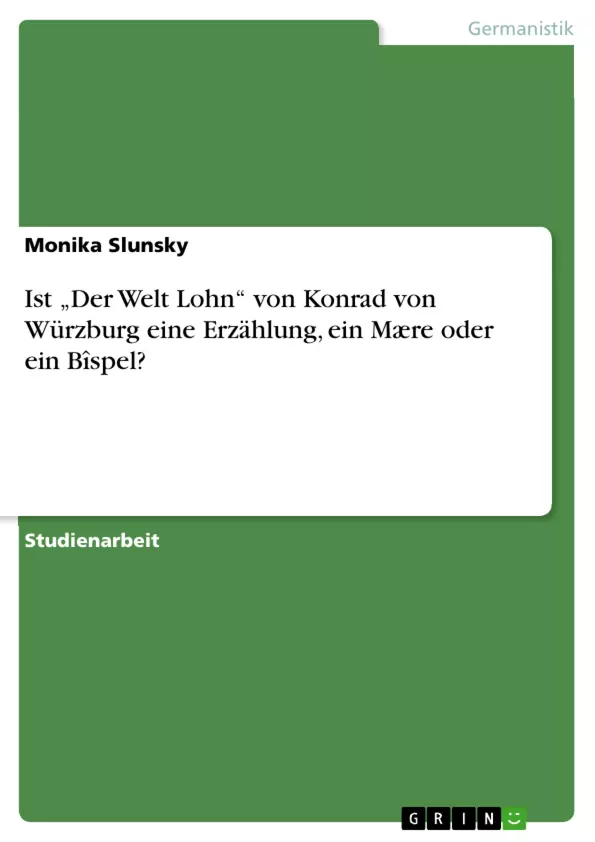Konrad von Würzburg, der zwischen 1220 und 1230 in Würzburg geboren wurde und am 31. August 1287 in Basel starb, ist der Dichter von Der Welt Lohn. Es gibt für dieses Werk (nach wie vor) keine exakte Datierung, die als gesichert gelten kann, sowie es keine Verortung eines damit in Zusammenhang stehenden Kreuzzugs gibt. Konrads Schaffensort war auf jeden Fall die Stadt Basel. Eine Widmung, die Aufschluss über das Entstehungsdatum gibt, fehlt. Nach einer stilkritischen Einordnung (ohne den Originaltext), bleiben nur spekulative Ergebnisse. Blecks Jahresangabe 1266 (oder 1275?) entspricht Vertretern der frühen Datierungszeit, im Gegensatz zur Spätdatierung von Meyer um 1280.
Eine primäre Editionsform der Einzelausgabe, mit dem möglichen Titel „Ditz bvchel heizet der werlt lon …“, ist nicht erhalten. Folgende neun Handschriften sind von der kurzen Erzählung tradiert: M – München, B – Berlin, S – Nürnberg,
D – Donaueschingen, C - Karlsruhe, G – Gotha, P – Heidelberg,
K – Cologny-Genève, W – Wien. Eine synoptische Darstellung der stark voneinander abweichenden Hss. bietet Bleck in seiner Monographie zu Der Welt Lohn.
Bleck entwickelte einen Archetyp von der Welt Lohn, der eine sichere Grundlage für weitere Untersuchungen bietet.
Für die Bestimmung der Gattung von Der Welt Lohn bringt die Eingliederung in die genannten Hss. durchaus Aufschluss. So befinden sich die Hss. M, B und W in einer Reihe von Kleindichtungen geistlichen Inhalts bzw. bei B sogar neben Bußpsalmen. Die restlichen sechs Hss. sind Teile von Märensammlungen, deren Repertoire allerdings von didaktisch-erbaulicher bis derb-erotischer Dichtung reicht, die womöglich der Kürze wegen ausgewählt wurden. Im Mittelalter galten Mären als „moderne Kurzerzählungen“, worunter heutzutage die Novelle verstanden wird.
Der Welt Lohn mit weniger als 300 Versen erweist sich somit als passend. Folglich bietet sich eine Definition von Der Welt Lohn als Märe mit geistlicher oder
erbaulich-didaktischer Tendenz an. Andererseits verlockt die Bezeichnung von
Der Welt Lohn als Bîspel, aufgrund der nahen Umgebung von Stricker-Bîspeln. Soviel sei einmal als erster Anreiz für eine Gattungseinordnung verraten.
Abgesehen davon, dass Konrads Autorschaft ohnehin für Der Welt Lohn als gesichert gilt , erkennt ein geschultes Auge bzw. Ohr, die streng durchgehaltene Reimbrechung. Mit dieser Technik hebt sich Konrad von seinen zeitgenössischen Dichterkollegen ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und erste Informationen zum Werk
- 2. Kommentierte Inhaltsangabe
- 2.1. Die Reimbrechung
- 2.2. Kreuzzugsthematik
- 3. Hauptanalyse
- 1.Teil
- 3.1 Problematische Forschungslage
- 3.2 Kleinepische Dichtungsformen im Mittelalter
- a) Maere
- b) Exempel (lateinisch)
- c) Bîspel
- d) Versnovelle
- e) Exkurs: Fabliau (französisch)
- 2. Teil
- 3.3. Gattung und (mögliche!) Quellen
- a) Lateinisches Exempel
- b) Walther von der Vogelweide
- c) Gottfried von Straßburg
- 3.3. Gattung und (mögliche!) Quellen
- 1.Teil
- 4. Ergebnis und Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gattung von Konrads von Würzburgs „Der Welt Lohn“. Ziel ist es, die Einordnung des Werkes in die mittelalterliche kleinepische Dichtung zu klären und die bedeutenden gattungsspezifischen Merkmale zu analysieren.
- Gattungsbestimmung von „Der Welt Lohn“ (Märe, Bîspel etc.)
- Analyse der formalen Aspekte (Reimbrechung, Struktur)
- Untersuchung des „Frô-Welt“-Motivs
- Bedeutung der Quellen und Einflüsse
- Konrads Schreibstil und seine Abgrenzung zu Zeitgenossen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und erste Informationen zum Werk: Die Einleitung stellt Konrad von Würzburg und sein Werk „Der Welt Lohn“ vor. Sie diskutiert die Schwierigkeiten bei der Datierung und Lokalisierung des Werkes sowie die überlieferten Handschriften und ihre Unterschiede. Die Einordnung des Werkes in Sammlungen geistlicher Kleindichtungen und Märensammlungen wird als Hinweis auf seine mögliche Gattung interpretiert, wobei die Kürze des Textes und seine didaktisch-erbauliche Tendenz für eine Einordnung als Märe sprechen. Die Nähe zu Stricker-Bîspeln legt jedoch auch eine Einordnung als Bîspel nahe.
2. Kommentierte Inhaltsangabe: Dieses Kapitel bietet eine kommentierte Inhaltsangabe von „Der Welt Lohn“, die bereits formale Aspekte im Hinblick auf die Gattungsbestimmung berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der Poetisierung des „Frô-Welt“-Motivs. Der Textbeginn wird nicht als Prolog, sondern als Auftakt interpretiert, gefolgt von der Einführung des Protagonisten Wirnt von Gravenberc, ein idealisierter, weltlich erfolgreicher Ritter, der sich ausschließlich auf weltliche Tugenden konzentriert. Das Zusammentreffen mit Frau Welt, die sich als Herrscherin über die Welt offenbart, bildet den Höhepunkt. Die Beschreibung ihrer Rückseite als grotesk-verfallener Körper zeigt die Konsequenzen weltlichen Strebens.
3. Hauptanalyse: Die Hauptanalyse vertieft die Untersuchung der gattungsrelevanten Aspekte. Sie beginnt mit einer Diskussion der problematischen Forschungslage und führt eine detaillierte Betrachtung der verschiedenen kleinenpischen Formen des Mittelalters (Maere, Exempel, Bîspel, Versnovelle, Fabliau) durch. Der zweite Teil der Analyse befasst sich mit der Gattung von „Der Welt Lohn“ und möglichen Quellen, wobei lateinische Exempel, Walther von der Vogelweide und Gottfried von Straßburg diskutiert werden. Die Analyse untersucht den Text im Detail, beleuchtet die allegorische Ebene und legt die Bedeutung der Darstellung der „Frau Welt“ dar.
Schlüsselwörter
Konrad von Würzburg, Der Welt Lohn, Märe, Bîspel, Kleinepik, Mittelalter, Frô-Welt-Motiv, Reimbrechung, Gattungspoetik, Allegorese, geistliche Dichtung, didaktische Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu Konrads von Würzburgs „Der Welt Lohn“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Konrad von Würzburgs „Der Welt Lohn“, konzentriert sich auf die Gattungszuordnung des Werks innerhalb der mittelalterlichen kleinenpischen Dichtung und untersucht bedeutende gattungsspezifische Merkmale.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gattungsbestimmung von „Der Welt Lohn“ (Märe, Bîspel etc.), die Analyse formaler Aspekte (Reimbrechung, Struktur), die Untersuchung des „Frô-Welt“-Motivs, die Bedeutung von Quellen und Einflüssen, und Konrads Schreibstil im Vergleich zu seinen Zeitgenossen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung und erste Informationen zum Werk; 2. Kommentierte Inhaltsangabe (inkl. Reimbrechung und Kreuzzugsthematik); 3. Hauptanalyse (inkl. problematischer Forschungslage, kleinerpischen Dichtungsformen des Mittelalters wie Maere, Exempel, Bîspel, Versnovelle und Fabliau, sowie möglichen Quellen wie lateinische Exempel, Walther von der Vogelweide und Gottfried von Straßburg); 4. Ergebnis und Nachwort.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung stellt Konrad von Würzburg und „Der Welt Lohn“ vor, diskutiert Datierungs- und Lokalisierungsschwierigkeiten, überlieferte Handschriften und deren Unterschiede, sowie die Einordnung des Werks in Sammlungen geistlicher Kleindichtungen und Märensammlungen. Die Kürze des Textes und seine didaktisch-erbauliche Tendenz sprechen für eine Einordnung als Märe, während die Nähe zu Stricker-Bîspeln auch eine Einordnung als Bîspel nahelegt.
Was beinhaltet die kommentierte Inhaltsangabe?
Die kommentierte Inhaltsangabe berücksichtigt formale Aspekte im Hinblick auf die Gattungsbestimmung und fokussiert die Poetisierung des „Frô-Welt“-Motivs. Sie interpretiert den Textbeginn als Auftakt, beschreibt die Einführung des Protagonisten Wirnt von Gravenberc und das Zusammentreffen mit Frau Welt als Höhepunkt, wobei die Beschreibung ihrer Rückseite die Konsequenzen weltlichen Strebens aufzeigt.
Wie ist die Hauptanalyse aufgebaut?
Die Hauptanalyse vertieft die Untersuchung gattungsrelevanter Aspekte, beginnt mit einer Diskussion der problematischen Forschungslage und betrachtet detailliert verschiedene kleinepische Formen des Mittelalters. Der zweite Teil analysiert die Gattung von „Der Welt Lohn“ und mögliche Quellen (lateinische Exempel, Walther von der Vogelweide, Gottfried von Straßburg), beleuchtet die allegorische Ebene und die Bedeutung der Darstellung der „Frau Welt“.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konrad von Würzburg, Der Welt Lohn, Märe, Bîspel, Kleinepik, Mittelalter, Frô-Welt-Motiv, Reimbrechung, Gattungspoetik, Allegorese, geistliche Dichtung, didaktische Literatur.
Welche Gattungen mittelalterlicher kleinerpischer Dichtung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Maere, Exempel (lateinisch), Bîspel, Versnovelle und Fabliau (französisch) im Kontext der Gattungsbestimmung von „Der Welt Lohn“.
Welche möglichen Quellen für „Der Welt Lohn“ werden untersucht?
Die Arbeit untersucht lateinische Exempel, Werke von Walther von der Vogelweide und Gottfried von Straßburg als mögliche Quellen für „Der Welt Lohn“.
- Arbeit zitieren
- Monika Slunsky (Autor:in), 2008, Ist „Der Welt Lohn“ von Konrad von Würzburg eine Erzählung, ein Mære oder ein Bîspel?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149643