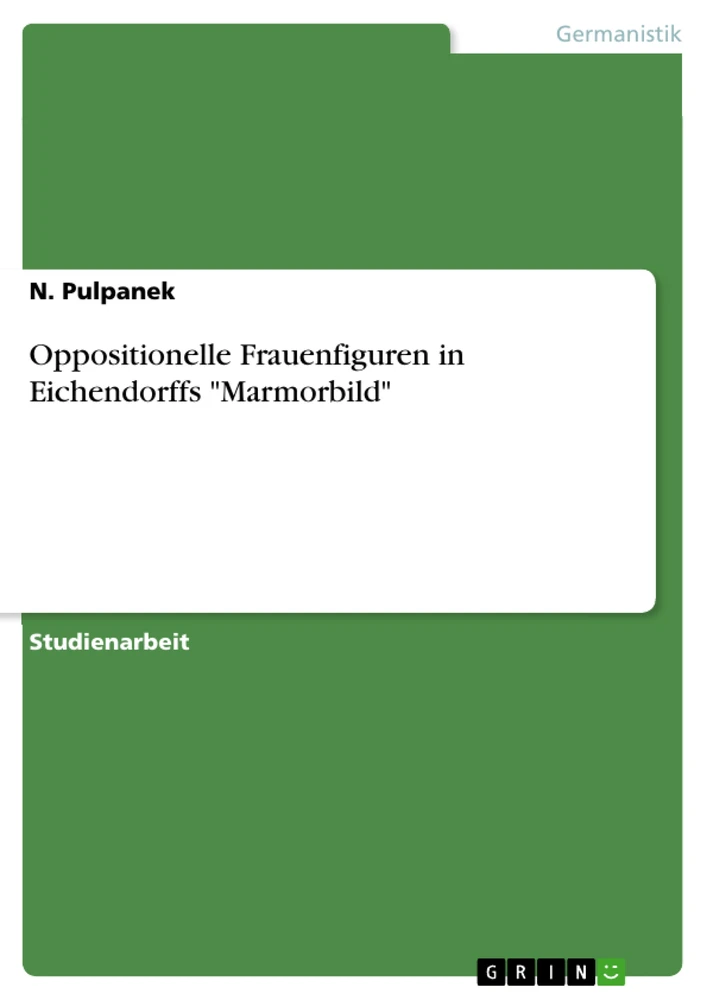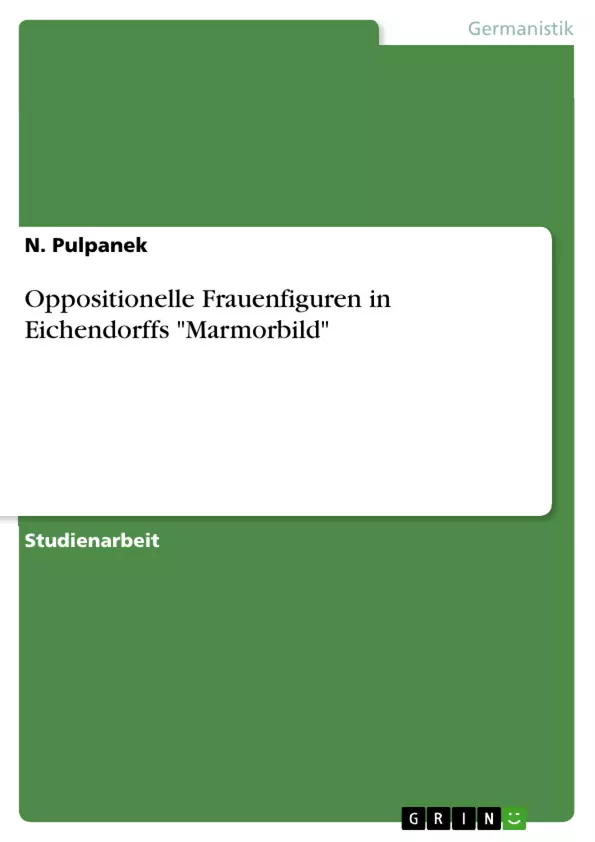Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, das Marmorbild hinsichtlich seiner Frauenfiguren und ihrer Bedeutung für die Entwicklung des jungen Dichters Florio zu analysieren. Der Argumentationsstrang der Arbeit richtet sich dabei nach der These, dass die beiden Frauenfiguren nicht nur in einem dualistischen Verhältnis zueinander, sondern vielmehr in einer Wechselbeziehung miteinander stehen. Dabei wird in einem ersten Schritt der mythische und motivische Hintergrund der Venusfigur erarbeitet, um dann in einem zweiten Schritt die zahlreichen venerischen Motive zu erläutern. Durch die Erkenntnisse dieser Erarbeitung lässt sich der Bereich der Venus als einen von der christlichen Welt getrennten Raum verstehen.
In einem zweiten Schritt wird die Figur der Bianka anhand ihrer Motive und Darstellung untersucht. Daraus entwickelt sich ein Bereich, der christlich geprägt und damit in einem oppositionellen Verhältnis zum heidnischen Bereich der Venus steht. Dieser Dualismus bildet die Ausgangslage dafür, die Figuren anschließend gegenüberzustellen und ihren Einfluss auf die Entwicklung des Jünglings Florio zu einem reifen Mann zu untersuchen. In einem Fazit werden die gesammelten Erkenntnisse abschließend zusammengefasst, um die Ausgangsthese entweder zu bestätigen oder zu falsifizieren. Die Textvariante, auf die sich diese Arbeit stützt, stammt aus der Gesamtausgabe „Joseph von Eichendorff, Sämtliche Erzählungen“, herausgegeben von Hartwig Schultz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die charakteristische Darstellung der Frauenfiguren
- Venus, „das Bild aller Jugendträume“
- Bianka, „die reizende Kleine mit dem Blumenkranze.“
- Die Bedeutung der beiden Frauenfiguren für die Entwicklung Florios
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Frauenfiguren "Venus" und "Bianka" in Eichendorffs Novelle "Das Marmorbild" und analysiert ihren Einfluss auf die Entwicklung des Protagonisten Florio. Sie analysiert die Figuren in ihrer Beziehung zueinander und in Bezug auf die ihnen zugrunde liegenden Mythen und Motive.
- Die Darstellung der Frauenfiguren im Kontext der antiken und christlichen Traditionen
- Der Gegensatz zwischen heidnischer und christlicher Liebe
- Die Rolle der Frauenfiguren in der Entwicklung des Protagonisten Florio
- Die Beziehung zwischen den beiden Frauenfiguren und ihr Einfluss aufeinander
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik und die Forschungsfrage. Es stellt die Figuren "Venus" und "Bianka" als Repräsentanten heidnischer und christlicher Liebe vor und erklärt den dualistischen Konflikt, der sich im Marmorbild widerspiegelt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Venusfigur und untersucht ihren mythischen Hintergrund sowie die mit ihr verbundenen Motive. Es betrachtet die Venus als eine Verkörperung des heidnischen, transzendenten Bereichs, der sich von der christlichen Welt abgrenzt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Figur der Bianka. Es beleuchtet ihre Motive und Darstellung und stellt sie als Repräsentantin des christlichen, erdgebundenen Bereichs dar.
Schlüsselwörter
Eichendorff, Marmorbild, Venus, Bianka, heidnische Liebe, christliche Liebe, Dualismus, mythische Motive, Frauenfiguren, Protagonist, Entwicklung, Analyse, literarische Traditionen.
- Arbeit zitieren
- N. Pulpanek (Autor:in), 2019, Oppositionelle Frauenfiguren in Eichendorffs "Marmorbild", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1496850