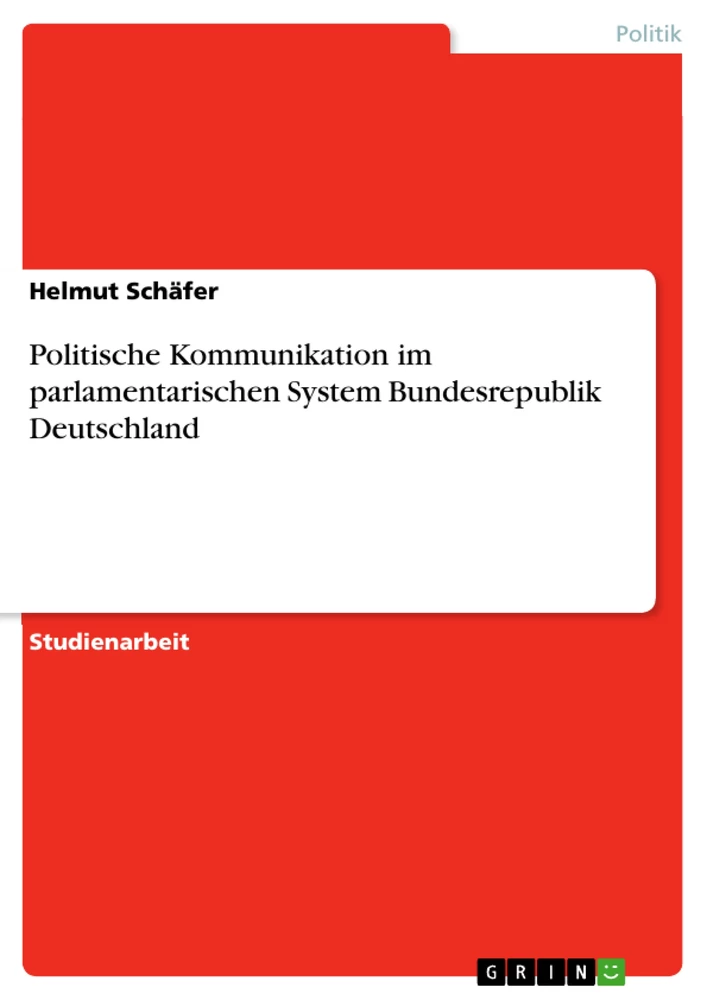Die vorliegende Arbeit soll einen einführenden Überblick auf das weite Feld der politischen Kommunikation bieten.
Nach dem hinführenden Teil im zweiten Kapitel werden dann die Akteurskonstellationen des politischen Kommunikationsprozesses im parlamentarischen System der Bundesrepublik Deutschland dargestellt. Eine detailierte (auch empirische) Untersuchung von Teilbereichen wird jedoch nicht geleistet, da diese den Umfang sprengen würde.
Es wird also zu analysieren sein, welche Berührungspunkte das parlamentarische (oder allgemein: politische) System und das Kommunikationssystem haben, wer die jeweiligen Akteure und Institutionen sind, und welche Wechselwirkungen zwischen ihnen bestehen. Außerdem wird untersucht, worin die Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen. Ferner sind die aktuellen Entwicklungen und die damit verbundenen Probleme zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Vorbemerkung
- Dimensionen, Prozesse und Strategien politischer Kommunikation
- Begriffsklärung
- Kommunikationsmodell
- Entwicklungsgeschichte
- Grundfunktionen
- Entwicklungstendenzen
- Akteure und Institutionen
- Parlament
- Regierung und Opposition
- Parteien
- Journalisten
- Lobbyisten und Interessenverbände
- Bürger
- Probleme und Ausblick
- Entwicklung zur Neue-Medien-Gesellschaft
- Vermittelbarkeit von politischen Prozessen, Entscheidungen und Handlungen
- Abschließende Stellungnahme
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, einen einführenden Überblick über die politische Kommunikation im parlamentarischen System der Bundesrepublik Deutschland zu geben. Sie untersucht die Akteure, Institutionen und Prozesse, die an der politischen Kommunikation beteiligt sind, sowie die Wechselwirkungen zwischen ihnen. Die Arbeit befasst sich auch mit den aktuellen Entwicklungen und den damit verbundenen Problemen.
- Begriffsklärung und Definition von politischer Kommunikation
- Analyse der Akteure und Institutionen im politischen Kommunikationsprozess
- Untersuchung der Prozesse und Strategien der politischen Kommunikation
- Bewertung der Herausforderungen und Chancen der politischen Kommunikation in der digitalen Gesellschaft
- Diskussion der Rolle der Medien im politischen Kommunikationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine einleitende Vorbemerkung, die den Fokus der Arbeit auf die politische Kommunikation im parlamentarischen System der Bundesrepublik Deutschland legt. Es werden die zentralen Fragestellungen der Arbeit vorgestellt und die Grenzen des Untersuchungsgegenstandes definiert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Dimensionen, Prozessen und Strategien der politischen Kommunikation. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze zur Analyse der politischen Kommunikation vorgestellt, die Entwicklung der politischen Kommunikation im historischen Kontext beleuchtet und die Grundfunktionen des politischen Kommunikationssystems erläutert.
Das dritte Kapitel analysiert die Akteure und Institutionen im politischen Kommunikationsprozess. Es werden die Rolle des Parlaments, der Regierung, der Opposition, der Parteien, der Journalisten, der Lobbyisten und Interessenverbände sowie der Bürger im politischen Kommunikationsprozess untersucht.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Problemen und Herausforderungen der politischen Kommunikation in der digitalen Gesellschaft. Es werden die Auswirkungen der Entwicklung zur Neue-Medien-Gesellschaft auf die politische Kommunikation diskutiert und die Vermittelbarkeit von politischen Prozessen, Entscheidungen und Handlungen in der digitalen Welt beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen politische Kommunikation, parlamentarisches System, Bundesrepublik Deutschland, Akteure, Institutionen, Prozesse, Strategien, Medien, Neue-Medien-Gesellschaft, Vermittelbarkeit, politische Entscheidungen, politische Prozesse, politische Handlungen.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Hauptakteure der politischen Kommunikation in Deutschland?
Dazu gehören das Parlament, Regierung und Opposition, politische Parteien, Journalisten, Lobbyisten sowie die Bürger.
Wie beeinflussen neue Medien die politische Kommunikation?
Die Entwicklung zur „Neue-Medien-Gesellschaft“ verändert die Vermittelbarkeit politischer Prozesse und schafft neue Kanäle für den direkten Austausch mit Bürgern.
Welche Rolle spielen Journalisten im politischen Prozess?
Journalisten fungieren als Mediatoren und Gatekeeper, die politische Informationen filtern, aufbereiten und an die Öffentlichkeit vermitteln.
Was ist der Unterschied zwischen politischem System und Kommunikationssystem?
Die Arbeit analysiert die Berührungspunkte und Wechselwirkungen zwischen dem parlamentarischen Entscheidungssystem und dem System der öffentlichen Meinungsbildung.
Welche Strategien nutzen Parteien in der Kommunikation?
Parteien setzen gezielte Strategien ein, um ihre Positionen wählbar zu machen und Themen in der öffentlichen Agenda zu besetzen.
Was sind die Grundfunktionen politischer Kommunikation?
Dazu zählen Information, Artikulation von Interessen, Legitimation von Herrschaft und die Mobilisierung der Wählerschaft.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Helmut Schäfer (Author), 1999, Politische Kommunikation im parlamentarischen System Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149748