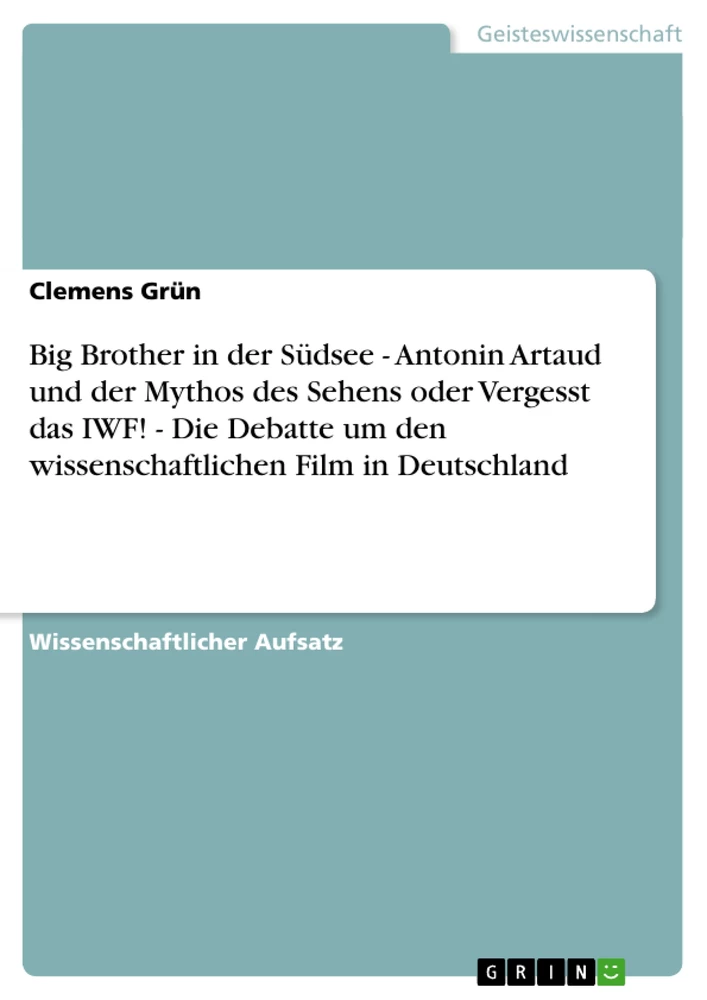Der ethnographische Film in Deutschland steckte lange in einem „doppelten Rechtfertigungsdilemma“: Die Forschung bestritt „Wissenschaftlichkeit“, die Filmwelt sprach ihm nennenswerte filmische Qualitäten ab. Das klassische Konzept des Göttinger Instituts für Wissenschaftlichen Film (IWF) stellte an den wissenschaftlichen Film dieselben Anforderungen wie an einen wissenschaftlichen Text. Eine eigenständige wissenschaftliche Qualität wurde dem filmischen Medium abgesprochen: Er war im besten Fall Beiwerk, das den wissenschaftlichen Text illustrieren und dessen Beweiskraft erhöhen soll.
Dabei wurde übersehen, das die besondere Qualität filmischer Bilder und filmischen Erzählens gerade nicht in ihrer empirisch überprüfbaren „Objektivität“, sondern in ihrer Fähigkeit liegt, emotional zu berühren - und damit einen Teil der Wirklichkeit zu repräsentieren, den Wissenschaftler aus ihrer Betrachtung gerne auszuklammern behaupten. Emotionen sind individuell und nicht objektivierbar. Filme entziehen sich einer eindeutigen, verbalisierbaren und verifizierbaren Interpretation.
Das vorliegende wissenschaftliche Essay zeichnet die lange Zeit von Verhaltensforschers und Museumsethnologen dominierte Debatte um den wissenschaftlichen Film in Deutschland nach. Es widmet sich den Grenzbereichen zwischen Wissenschaft und Kunst und den Potentialen des Mediums Film für die wissenschaftliche Lehre, bis hin zur Frage: Wie ethnographisch ist Hollywood?
Der eigentliche Film, das wusste schon Hitchcock, entsteht im Kopf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Kleine Geschichte des Sehens
- 2. Der ethnographische Film in Deutschland
- 2.1. Die Göttinger Schule
- 2.2. Gegenbewegungen
- 2.2.1. Thesen Schlumpf
- 2.2.2. Reaktionen auf Kritik durch das IWF
- 3. Diskurs: Kunst und Wissenschaft
- 4. Lösungsvorschläge und Ausblick
- 4.1. Schlussbemerkung: Wortpoeten – Bildpoeten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und Entwicklung des ethnographischen Films in Deutschland, insbesondere im Kontext der Göttinger Schule. Sie analysiert die kontroversen Debatten um die "Wissenschaftlichkeit" des Mediums und die unterschiedlichen Ansätze zur filmischen Darstellung fremder Kulturen. Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen künstlerischer Gestaltung und wissenschaftlicher Objektivität im ethnographischen Film.
- Die Geschichte des ethnographischen Blicks und die Entwicklung von Mythen über "fremde" Kulturen.
- Die Göttinger Schule und ihre Methodik: der Ansatz einer objektiven, wissenschaftlichen Filmproduktion.
- Kritik an der Göttinger Schule und alternative Ansätze: die Bedeutung von Subjektivität, Gestaltung und emotionaler Wirkung im Film.
- Der Diskurs zwischen Kunst und Wissenschaft im ethnographischen Film.
- Lösungsansätze und Perspektiven für eine zeitgemäße visuelle Anthropologie.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des "Sehens" fremder Kulturen, beginnend mit den frühen, oft mythisch aufgeladenen Beschreibungen von Seefahrern bis hin zur Fotografie und dem Film. Sie verdeutlicht, wie europäische Sehnsüchte und Vorurteile die Wahrnehmung fremder Kulturen prägten und wie diese Vorstellungen bis heute die mediale Repräsentation beeinflussen. Der Abschnitt thematisiert das Misstrauen zwischen wissenschaftlicher Objektivität und der narrativen Kraft des filmischen Mediums und betont die Notwendigkeit, das Verhältnis von Wissenschaft und Film kritisch zu hinterfragen, anstatt das Medium Film selbst in Frage zu stellen. Die zentrale These ist, dass alle Filme, ob fiktional oder dokumentarisch, Geschichten erzählen und Botschaften vermitteln, weshalb die Authentizität eines Materials nicht allein von seiner Klassifizierung abhängt.
2. Der ethnographische Film in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen und das "doppelte Rechtfertigungsdilemma" des ethnographischen Films in Deutschland. Es beschreibt das gespannte Verhältnis zwischen Ethnologen und Filmemachern und die lange Zeit vorherrschende Orientierung an streng wissenschaftlichen Kriterien, die die emotionale und künstlerische Dimension des Films vernachlässigten. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, wissenschaftliche Objektivität mit der Kraft filmischen Erzählens zu vereinbaren. Es kritisiert den reduktionistischen Ansatz der Göttinger Schule, der die Möglichkeiten des Mediums auf die Illustration materieller Kultur beschränkte und den Film zu einem "visuellen Archiv" degradierte, welches emotional distanziert und objektiviert blieb. Das Kapitel zeigt auf, wie dieser Ansatz den emotionalen Gehalt des Filmes ignorierte und zur Entstehung von stereotypen und kulturalistischen Darstellungen beitrug.
2.1. Die Göttinger Schule: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert den Ansatz der Göttinger Schule, der den ethnographischen Film an den strengen Kriterien wissenschaftlicher Texte orientierte. Es werden die methodischen Prinzipien, wie z.B. die Vermeidung von Kamerabewegungen, die Betonung von technischen Abläufen und das Bestreben nach "objektiver" Darstellung, erläutert. Die "Encyclopaedia Cinematographica" wird als zentrales Beispiel des Göttinger Ansatzes präsentiert, und es wird aufgezeigt, wie die methodische Strenge die Möglichkeiten des Mediums stark einschränkte und zu oberflächlichen und wenig einfühlsamen Darstellungen führte. Die Kapitel befasst sich auch mit den erkenntnistheoretischen Grundlagen des Ansatzes, der im Neopositivismus und Kritischen Rationalismus verankert war.
2.2. Gegenbewegungen: Dieser Abschnitt behandelt die Kritik an der Göttinger Schule und den daraus resultierenden Gegenbewegungen. Die Kritikpunkte umfassen die oberflächliche Darstellung der Kultur, die Objektivierung fremder Menschen und den Mangel an ethischen Kriterien. Die Thesen von Hans-Ulrich Schlumpf werden als ein zentrales Beispiel für die Kritik an der Göttinger Schule dargestellt und im Detail erläutert. Schlumpf betont den fiktiven Charakter des Films und die unvermeidliche Subjektivität der filmischen Gestaltung. Er kritisiert die Vorstellung einer "objektiven Kamera" und zeigt die Bedeutung der Filmsprache für die Vermittlung von Wissen auf. Darüber hinaus beschreibt dieser Abschnitt die Reaktionen des IWF auf die Kritik und die allmählichen Veränderungen im Ansatz des ethnographischen Films.
3. Diskurs: Kunst und Wissenschaft: Dieses Kapitel untersucht das Spannungsfeld zwischen Kunst und Wissenschaft im Kontext des ethnographischen Films. Es diskutiert die traditionelle Gegenüberstellung von Kunst und Wissenschaft, die die Göttinger Schule übernahm, und stellt demgegenüber die Positionen von Ethnologen dar, die die Verbindung von Kunst und Wissenschaft im Film betonten. Der Abschnitt betont die Bedeutung von Emotionalität, Subjektivität und Interpretation im Film und sieht den Film als "Diskurs über das Wahrgenommene". Er zeigt auf, wie der Film durch seine Fähigkeit, Zeit und Rhythmus darzustellen, sowie emotionale und psychologische Einsichten zu vermitteln, die Möglichkeiten ethnologischer Forschung erweitert.
4. Lösungsvorschläge und Ausblick: Das Kapitel präsentiert Lösungsansätze für die Herausforderungen des ethnographischen Films. Es wird der Begriff der "Ethnograficness" diskutiert und die Unterscheidung zwischen intentionaler und nicht-intentionaler Ethnographie vorgestellt. Es werden verschiedene Ansätze zur Klassifizierung ethnographischer Filme erläutert, und die Entwicklung des indigenen Films als ein Beispiel für neue, dezentrale Formen visueller Anthropologie hervorgehoben. Das Kapitel betont die Bedeutung, die spezifischen Stärken des Mediums Film zu nutzen und an den veränderten Bedingungen des Fachs und den Möglichkeiten der Vermittlung ethnologischer Inhalte an ein breites Publikum zu orientieren.
Schlüsselwörter
Ethnographischer Film, Göttinger Schule, IWF, Visuelle Anthropologie, Objektivität, Subjektivität, Filmsprache, Kunst, Wissenschaft, Kritik, Gegenbewegungen, Methoden, Ethnograficness, Indigener Film, Mythen, Wahrnehmung, Repräsentation, Kultur, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum ethnographischen Film in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den ethnographischen Film in Deutschland. Er behandelt dessen Geschichte, die Entwicklung verschiedener Ansätze (insbesondere die Göttinger Schule und Gegenbewegungen), die Debatte um die Verbindung von Kunst und Wissenschaft im Medium Film sowie Lösungsansätze und Zukunftsperspektiven für die visuelle Anthropologie.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Geschichte des ethnographischen Blicks, die Methodik der Göttinger Schule und deren Kritik, der Diskurs zwischen Kunst und Wissenschaft im ethnographischen Film, die Bedeutung von Objektivität und Subjektivität in der filmischen Darstellung fremder Kulturen und die Entwicklung neuer Ansätze in der visuellen Anthropologie, inklusive des indigenen Films. Der Text beleuchtet auch die Rolle von Mythen und Vorurteilen in der Wahrnehmung und Repräsentation fremder Kulturen.
Was ist die Göttinger Schule?
Die Göttinger Schule steht für einen Ansatz im ethnographischen Film, der stark an wissenschaftlichen Kriterien orientiert war. Er zeichnete sich durch eine vermeintlich objektive Darstellung, die Vermeidung von Kamerabewegungen und die Betonung technischer Aspekte aus. Der Text kritisiert diesen Ansatz wegen seiner Oberflächlichkeit und seines Mangels an emotionaler Tiefe, der zu stereotypen und kulturalistischen Darstellungen führte. Die "Encyclopaedia Cinematographica" wird als zentrales Beispiel genannt.
Welche Kritik wurde an der Göttinger Schule geübt?
Die Kritik an der Göttinger Schule konzentrierte sich auf die oberflächliche Darstellung von Kulturen, die Objektivierung der abgebildeten Menschen und den Mangel an ethischen Kriterien. Hans-Ulrich Schlumpf wird als wichtiger Kritiker genannt, der den fiktiven Charakter des Films und die unvermeidliche Subjektivität der filmischen Gestaltung betonte. Die Reaktionen des IWF (Internationalen Wissenschaftsfilms) auf diese Kritik und die daraus resultierenden Veränderungen im Ansatz des ethnographischen Films werden ebenfalls behandelt.
Wie wird das Spannungsfeld zwischen Kunst und Wissenschaft im ethnographischen Film dargestellt?
Der Text analysiert das Spannungsfeld zwischen Kunst und Wissenschaft als zentrales Thema. Er diskutiert die traditionelle Gegenüberstellung beider Bereiche, wie sie von der Göttinger Schule vertreten wurde, und kontrastiert sie mit Ansätzen, die die Verbindung von Kunst und Wissenschaft betonen. Die Bedeutung von Emotionalität, Subjektivität und Interpretation im Film wird hervorgehoben, und der Film wird als "Diskurs über das Wahrgenommene" verstanden.
Welche Lösungsansätze und Zukunftsperspektiven werden vorgestellt?
Der Text präsentiert Lösungsansätze für die Herausforderungen des ethnographischen Films. Der Begriff der "Ethnograficness" wird diskutiert, verschiedene Ansätze zur Klassifizierung ethnographischer Filme erläutert und die Entwicklung des indigenen Films als Beispiel für neue, dezentrale Formen visueller Anthropologie hervorgehoben. Es wird betont, die spezifischen Stärken des Mediums Film zu nutzen und sich an den veränderten Bedingungen des Fachs und den Möglichkeiten der Vermittlung ethnologischer Inhalte an ein breites Publikum zu orientieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Ethnographischer Film, Göttinger Schule, IWF, Visuelle Anthropologie, Objektivität, Subjektivität, Filmsprache, Kunst, Wissenschaft, Kritik, Gegenbewegungen, Methoden, Ethnograficness, Indigener Film, Mythen, Wahrnehmung, Repräsentation, Kultur, Identität.
- Citation du texte
- Clemens Grün (Auteur), 2003, Big Brother in der Südsee - Antonin Artaud und der Mythos des Sehens oder Vergesst das IWF! - Die Debatte um den wissenschaftlichen Film in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14981