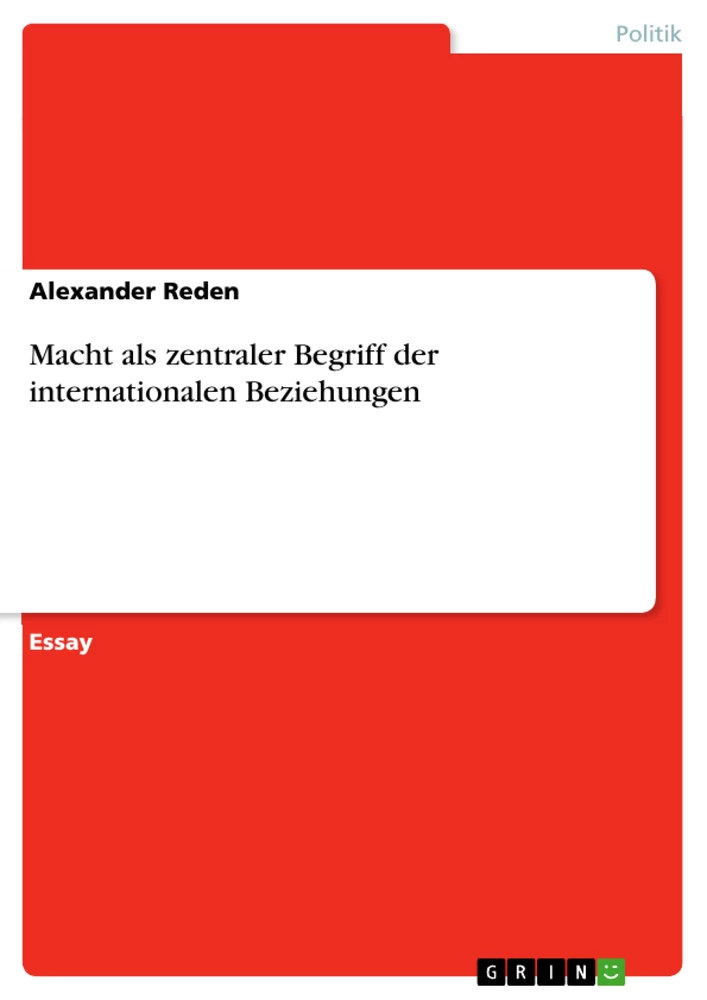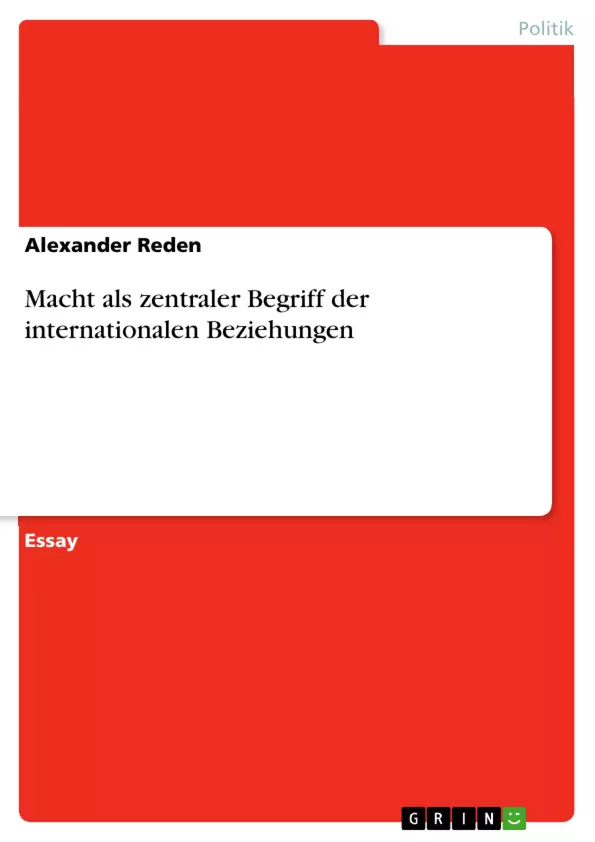In diesem Essay soll eine Beantwortung der Frage statt finden, ob Macht der zentrale Begriff in internationalen Beziehungen sei? Es ist grundlegend die Art beziehungsweise die Form der Macht zu definieren. Da der Machtbegriff sehr vielschichtig ist, will ich mich in der Beantwortung der Frage an Max Webers und Michael Manns Definitionen von Macht halten um eine adäquate Plattform zur Bearbeitung zu haben. Weiterhin sind die 2 Hauptströmungen Realismus und Neorealismus zu beachten. Der klassische Realismus ist durch Hans J. Morgenthau in dem Werk „Politics Among Nations“ begründet worden. Der Vertreter des Neorealismus ist Kenneth N. Waltz mit seinen Ausführungen in dem Werk „Theory of International Politics“.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in den Machtbegriff
- Definitionen von Macht nach Max Weber und Michael Mann
- Macht in internationalen Beziehungen
- Machtverteilung und Machtgleichgewicht
- Hegemoniale und nicht-hegemoniale Systeme
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Frage, ob Macht der zentrale Begriff in internationalen Beziehungen ist. Er analysiert den Machtbegriff anhand der Definitionen von Max Weber und Michael Mann und untersucht die Rolle von Macht in internationalen Beziehungen im Kontext des Realismus und Neorealismus. Der Essay beleuchtet die Machtverteilung und das Machtgleichgewicht in internationalen Beziehungen, sowie die Unterschiede zwischen hegemonialen und nicht-hegemonialen Systemen.
- Definition des Machtbegriffs nach Max Weber und Michael Mann
- Macht in internationalen Beziehungen und das Sicherheitsdilemma
- Machtverteilung und Machtgleichgewicht im internationalen System
- Hegemoniale und nicht-hegemoniale Systeme
- Die Rolle von Macht in der internationalen Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Einführung in den Machtbegriff und beleuchtet die Definitionen von Macht nach Max Weber und Michael Mann. Weber definiert Macht als die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, während Mann vier verschiedene Machtquellen unterscheidet: Ideologische, Ökonomische, Militärische und Politische Macht. Im Kontext der internationalen Beziehungen wird Macht als Handlungsmacht verstanden, die Akteure in der Lage versetzt, ihren Willen anderen Akteuren aufzuzwingen. Der Essay beleuchtet das Sicherheitsdilemma, das durch die anarchische Ordnung des internationalen Systems entsteht und Staaten dazu zwingt, ihre Macht zu maximieren, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Im zweiten Kapitel wird die Machtverteilung und das Machtgleichgewicht im internationalen System analysiert. Waltz betrachtet Staaten als gleichartig und argumentiert, dass die Machtverteilung durch die Anzahl der Großmächte bestimmt wird. Der Essay erläutert, wie Großmächte entstehen und wie das Machtgleichgewicht durch die Funktionsweise des Sicherheitsdilemmas entsteht. Staaten versuchen, Machtzuwächse anderer Staaten durch Gleichgewichtspolitik zu verhindern, indem sie ihre eigene Macht stärken oder Bündnisse mit anderen Staaten eingehen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit hegemonialen und nicht-hegemonialen Systemen. Ein Hegemon ist ein Staat, der über größere Machtressourcen verfügt als alle anderen Staaten zusammen. Hegemoniale Systeme können positive Einflüsse auf das internationale System haben, da Macht zentralisiert und monopolisiert wird, was Machtstreben und Machtkonkurrenz zwischen Staaten reduziert. Der Essay untersucht die Unterschiede zwischen unipolaren, bipolaren und multipolaren Systemen und zeigt, wie die Machtverteilung die Stabilität des internationalen Systems beeinflusst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Machtbegriff, internationale Beziehungen, Realismus, Neorealismus, Machtverteilung, Machtgleichgewicht, Sicherheitsdilemma, Hegemonie, unipolares System, bipolares System, multipolares System, Staaten, Akteure, internationale Politik.
Häufig gestellte Fragen
Ist Macht der zentrale Begriff in den internationalen Beziehungen?
Der Essay untersucht diese Frage im Kontext von Realismus und Neorealismus und analysiert Macht als grundlegende Handlungsmacht von Staaten.
Wie definiert Max Weber den Begriff Macht?
Weber definiert Macht als die Chance, den eigenen Willen innerhalb einer sozialen Beziehung auch gegen Widerstreben durchzusetzen.
Welche vier Machtquellen unterscheidet Michael Mann?
Michael Mann unterscheidet zwischen ideologischer, ökonomischer, militärischer und politischer Macht.
Was ist das Sicherheitsdilemma?
Es beschreibt eine Situation, in der die Aufrüstung eines Staates zur Erhöhung seiner Sicherheit von anderen Staaten als Bedrohung wahrgenommen wird, was zu einem Wettrüsten führt.
Was unterscheidet unipolare von bipolaren Systemen?
In einem unipolaren System dominiert ein Hegemon, während in einem bipolaren System zwei Großmächte das Machtgleichgewicht bestimmen.
- Arbeit zitieren
- Alexander Reden (Autor:in), 2009, Macht als zentraler Begriff der internationalen Beziehungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149883