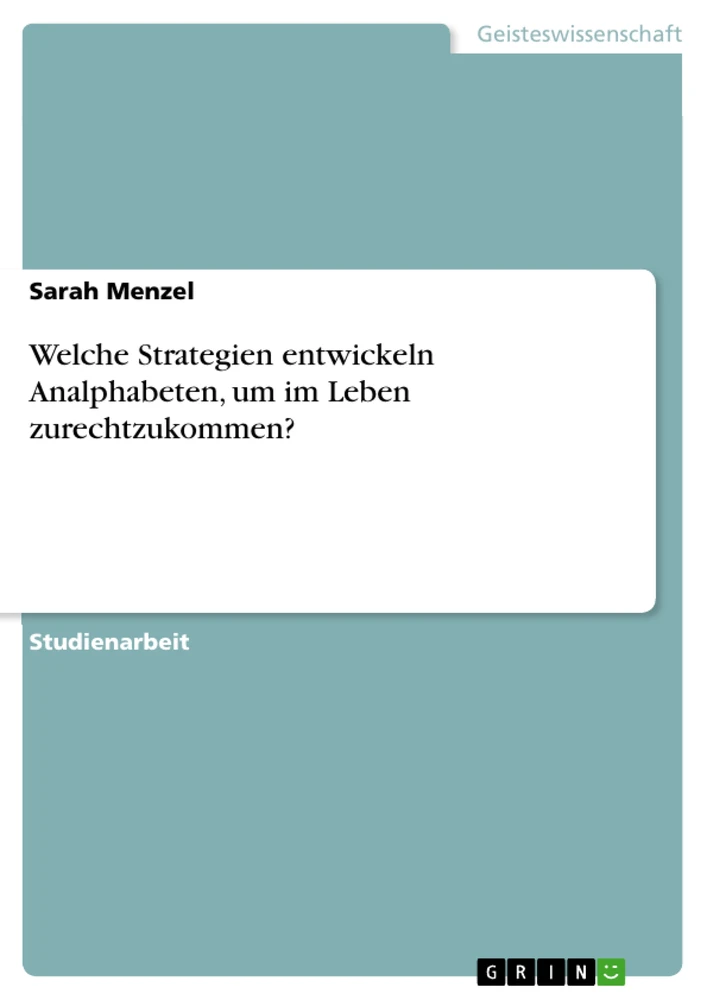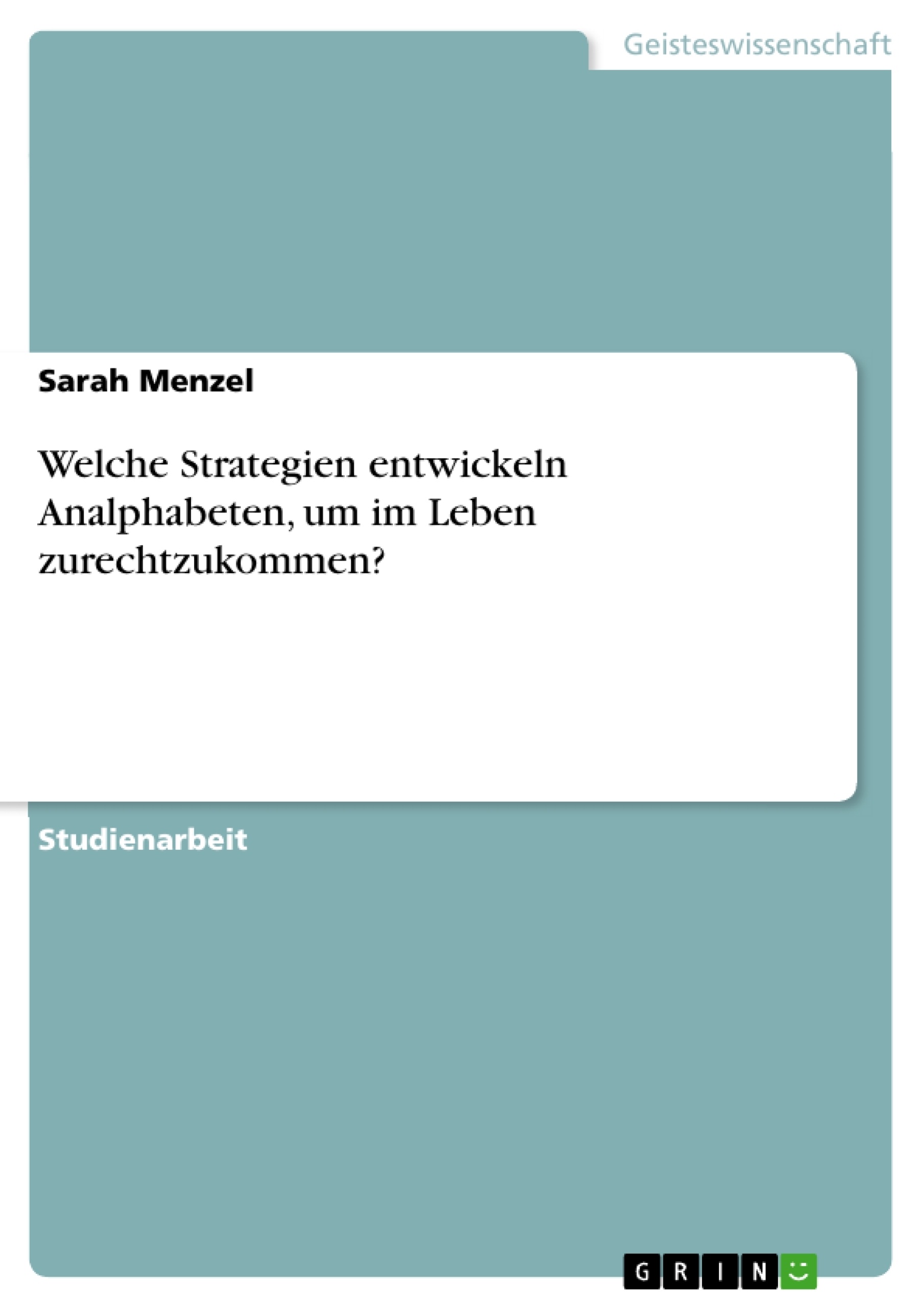Ziel dieser Seminararbeit ist es, das Themengebiet „Analphabetismus“ zu analysieren und vorhandenes unter Einziehung bestehender wissenschaftlicher Studien, Fachliteratur und Publikationen zu untermauern. Es stellt sich hierbei die Frage, welche Faktoren dazu beitragen, dass das Thema nicht öffentlich thematisiert werden kann und weiterhin ein „Tabuthema“ bleibt. Die LEO-Studie der Universität Hamburg aus dem Jahre 2018 gibt detaillierte Informationen über die Anzahl der Personen mit geringen literalen Kompetenzen.
In einem Land mit sehr groß flächigem, gut strukturiertem Schulsystem und vielfältigen Bildungsangeboten, wie Deutschland, verlassen viele Menschen die Schule immer noch mit geringen literalen Kompetenzen? Und dies, obwohl Deutschland als ein modernes, fortgeschrittenes, industrialisiertes und soziales Land mit vielen Möglichkeiten und enormen Entwicklungspotenzialen gesehen wird. Laut des aktuellen Haushaltsberichtes des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) beträgt das Budget für Bildung im Jahr 2020, 18,3 Milliarden Euro. Zusätzlich werden fünf Milliarden Euro für den DigitalPakt Schule vom Bund bereitgestellt, um die Schulen an das digitale Zeitalter anzugleichen. Bei den enormen Ausgaben, die durch Steuergelder finanziert werden, müssen weitere Millionen aufgewandt werden, um Analphabeten zu sozialisieren und in Arbeit und Bildung zu integrieren, wie z. B. mit dem Hamburger Modell (Rehabilitation). Trotz gigantischer Unterstützungen für das Bildungssystem verlassen junge Erwachsene die Schule mit geringer Alphabetisierung. Hier stellt sich die berechtigte Frage: „Warum junge Menschen Strategien entwickeln müssen, um in der Gesellschaft teilhaben zu können, und welches Organ bzw. welche Organisationsmitglieder haben dafür die Verantwortung zu tragen. Mit dieser Seminararbeit wird untersucht, ob für diese Fragen fundierte Antworten existieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Bedeutung von Analphabetismus und funktionalem Analphabetismus
- 2.1.1 Zeitebene: Primärer und sekundärer Analphabetismus
- 2.1.2 Kenntnisebene: Totaler und funktionaler Analphabetismus
- 2.1.3 Alpha-Level 1 – 4 die Definitionen der einzelnen Stufen
- 2.2 Besondere Herausforderungen für funktionale Analphabeten im Alltag und Berufsleben
- 3 Methodik
- 3.1 Qualitative Forschung
- 3.2 Untersuchungsdesign und Vorgehen
- 3.3 Interview
- 3.4 Stichprobenbeschreibung
- 3.4.1 Die Institutsleiterin – Interview A (Lehrende)
- 3.4.2 Der Teilnehmer – Interview B
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Kategorien zu Interview A
- 4.2 Kategorien zu Interview B
- 4.3 Kategoriensystem
- 5. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Analphabetismus und untersucht, welche Strategien Analphabeten entwickeln, um im Leben zurechtzukommen. Die Arbeit analysiert das Thema anhand bestehender wissenschaftlicher Studien, Fachliteratur und Publikationen und beleuchtet die Faktoren, die dazu beitragen, dass Analphabetismus ein Tabuthema bleibt. Die Arbeit befasst sich außerdem mit der Frage, warum Menschen trotz eines gut strukturierten Bildungssystems in Deutschland mit geringen literalen Kompetenzen die Schule verlassen.
- Definitionen von Analphabetismus und funktionalem Analphabetismus
- Herausforderungen für funktionale Analphabeten im Alltag und Berufsleben
- Qualitative Forschung und Interviews als Methode zur Untersuchung
- Analyse von Strategien, die Analphabeten entwickeln, um im Leben zurechtzukommen
- Faktoren, die zur Stigmatisierung des Themas Analphabetismus beitragen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema Analphabetismus ein und stellt die Forschungsfrage der Seminararbeit dar. Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Analphabetismus als Tabuthema und verweist auf die LEO-Studie der Universität Hamburg, die detaillierte Informationen über die Anzahl der Personen mit geringen literalen Kompetenzen liefert.
2. Theoretischer Hintergrund
Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Kategorien der Klassifizierung von Analphabetismus, die in Primär- und Sekundär-Analphabetismus sowie in Total- und Funktionalen Analphabetismus unterteilt werden. Es werden wichtige Studien, Forschungen, Fachliteraturen und Hypothesen der Theorie präsentiert.
3. Methodik
Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Seminararbeit. Es erläutert die Verwendung der qualitativen Forschung und das gewählte Untersuchungsdesign. Der Abschnitt beleuchtet die Interviewmethode und die Stichprobenbeschreibung, wobei die Interviews mit der Institutsleiterin (Interview A) und einem Teilnehmer (Interview B) vorgestellt werden.
4. Ergebnisse
Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews. Es werden die Kategorien zu Interview A und Interview B sowie das entwickelte Kategoriensystem vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den zentralen Themen Analphabetismus und funktionaler Analphabetismus. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind: qualitative Forschung, Interview, Strategien, Lebensbewältigung, Tabuthema, Bildungssystem, und gesellschaftliche Teilhabe. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, denen Analphabeten im Alltag und Berufsleben begegnen, und untersucht die Faktoren, die zur Stigmatisierung des Themas Analphabetismus beitragen.
- Quote paper
- Sarah Menzel (Author), 2020, Welche Strategien entwickeln Analphabeten, um im Leben zurechtzukommen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1499453