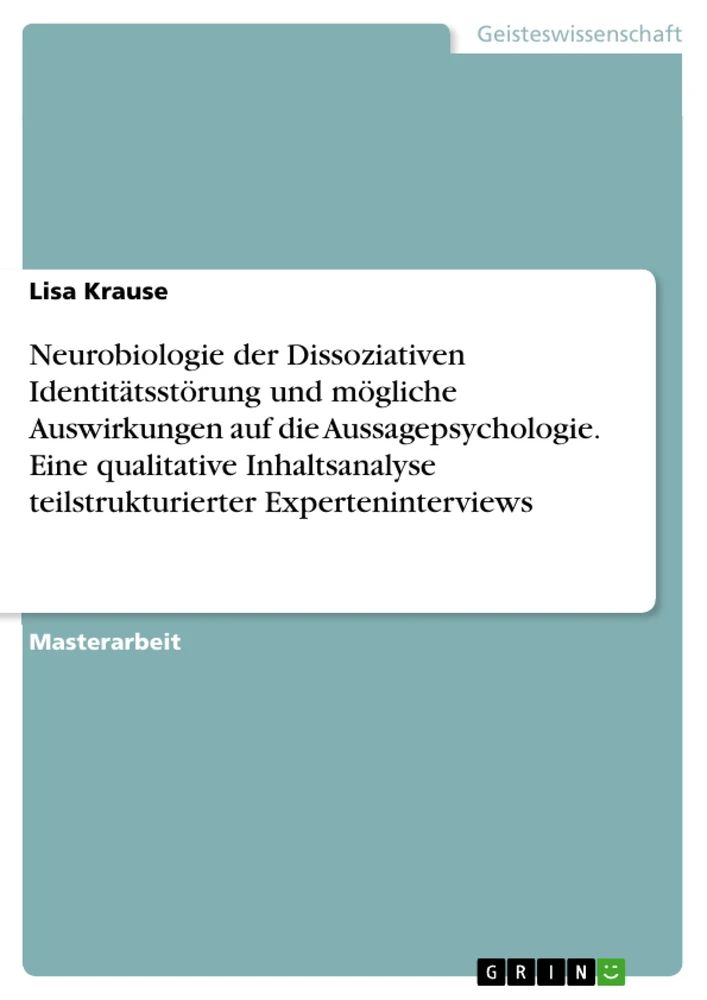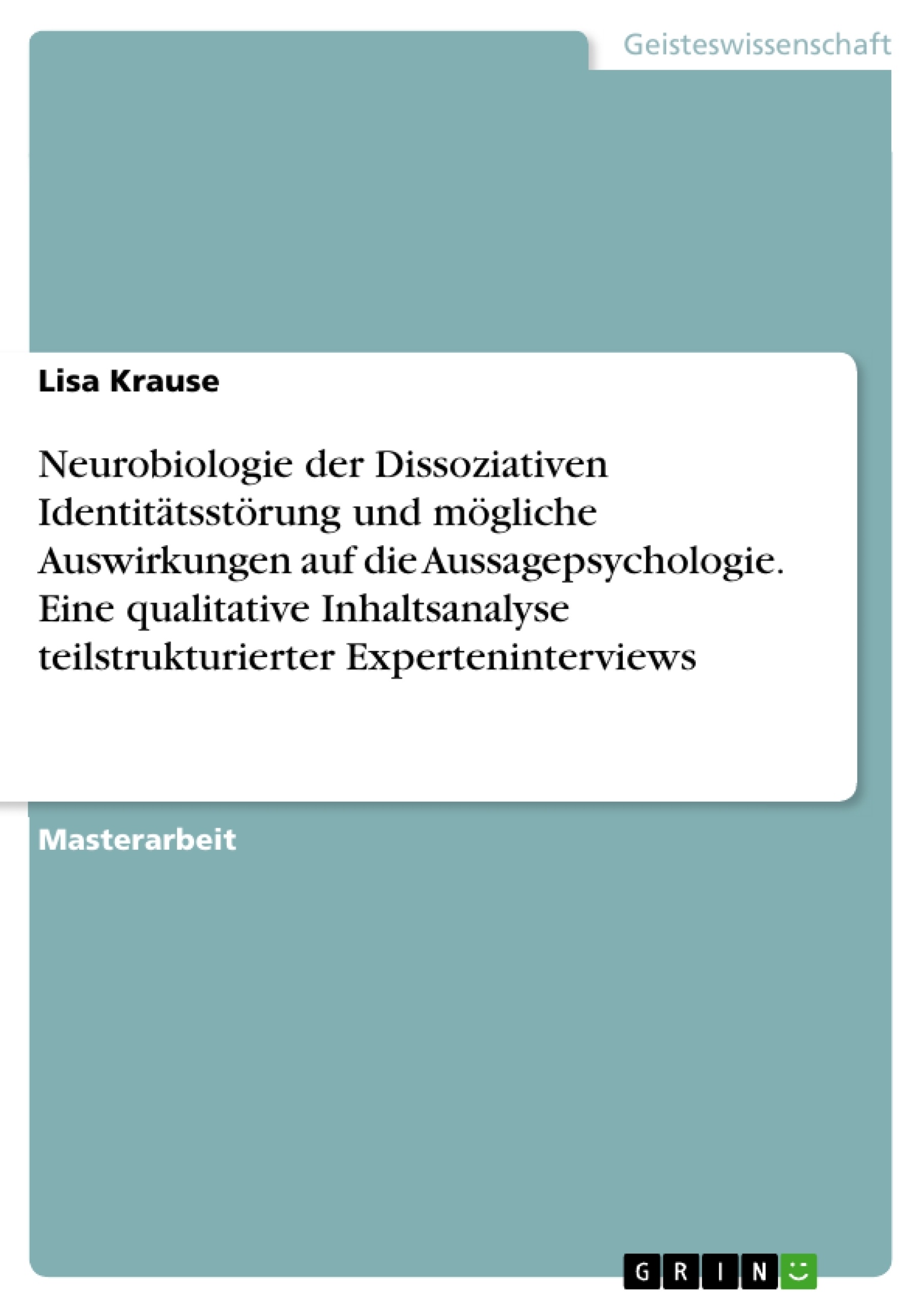Die Forschungsfrage dieser Masterarbeit erörtert, inwieweit der eindeutige neurowissenschaftliche Nachweis der Dissoziativen Identitätsstörung in der weiteren Folge eine Relevanz für die Aussagepsychologie und damit für die Rechtsprechung haben kann. Könnte die Glaubhaftigkeitsbegutachtung neben der Befragung vor allem auch durch eine neurowissenschaftliche Untersuchung eine höhere Validität erhalten? Damit soll der Versuch unternommen werden, die Klinische und die Forensische Psychologie durch das Einbeziehen der Neurowissenschaft einander anzunähern und damit den Opfern sexualisierter Gewalt den straf- und sozialrechtlichen Weg zu ermöglichen, ohne befürchten zu müssen, dass damit deren Trauma verschlimmert wird.
Einschränkend sei hier erwähnt, dass sich diese Masterarbeit auf die Dissoziative Identitätsstörung nach organisierter sexualisierter Gewalt fokussiert. Aufgrund der aktuellen Diskussion um den Vorwurf der fehlenden empirischen Evidenz für rituelle satanistische Gewalt-strukturen und Mind Control Techniken wird, trotz entsprechender Stellungnahmen des Betroffenenrats und der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs diese Thematik bewusst und explizit aus-genommen. Zudem sind diese strittigen Punkte für die Forschungsfrage nicht dezisiv. Doch zeigt die aktuelle Diskussion einmal mehr die Bedeutung dieses auch gesellschaftlich wichtigen Themas.
Das Verständnis der Dissoziativen Identitätsstörung ist erst in jüngster Vergangenheit mit den Fortschritten der neurowissenschaftlichen Forschung und einer verbesserten Aussagekraft bildgebender Verfahren gewachsen. So zeigen Studien, dass die einzelnen Persönlichkeitszustände einer Dissoziativen Identitätsstörung neurobiologisch völlig unterschiedliche Aktivitätsmuster aufweisen, die sich zudem eindeutig von denen von Simulanten unterscheiden. In die Aussagepsychologie haben die Erkenntnisse jüngster Studien zur Neurobiologie der Dissoziativen Identitätsstörung noch nicht den entsprechenden Eingang gefunden. Vonseiten der Justiz wird daher an den seit fast 25 Jahre bestehenden Standards festgehalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Dissoziative Identitätsstörung
- 2.1 Definition
- 2.2 Prävalenz
- 2.3 Trauma und Traumafolgestörung
- 2.4 Pathogenese
- 2.4.1 Entstehung der DIS
- 2.4.2 Theorie der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit
- 2.4.3 Wechsel der Persönlichkeitszustände
- 2.5 Diagnostik
- 2.6 Komorbiditäten
- 2.7 Therapie
- 2.8 Trauma-Modell versus Nicht-traumabasiertes-Modell
- 3 Neurobiologie der Dissoziativen Identitätsstörung
- 3.1 Neurobiologische Erkenntnisse
- 3.1.1 Strukturelle Auffälligkeiten
- 3.1.2 Funktionelle Auffälligkeiten
- 3.1.3 Genetische Auffälligkeiten
- 3.1.4 Biomarker
- 3.2 Kritik
- 3.1 Neurobiologische Erkenntnisse
- 4 Aussagepsychologische Glaubhaftigkeitsbegutachtung
- 4.1 Einführung in die Aussagepsychologie
- 4.2 Glaubhaftigkeitsbegutachtung
- 4.3 Aussagebegutachtung bei Personen mit Dissoziativer Identitätsstörung
- 5 Forschungsfrage und Erkenntnisinteresse
- 6 Methodik
- 6.1 Methodik des leitfadengestützten Experteninterviews
- 6.1.1 Leitfadenentwicklung
- 6.1.2 Expertenauswahl
- 6.2 Interviewdurchführung
- 6.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 6.1 Methodik des leitfadengestützten Experteninterviews
- 7 Ergebnisse
- 7.1 Kategorienüberblick
- 7.2 Darstellung der Hauptkategorien
- 8 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den aktuellen Forschungsstand zur Neurobiologie der Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) und deren Relevanz für die Aussagepsychologie. Ziel ist es, die Erkenntnisse der Neurobiologie in den Kontext der Glaubhaftigkeitsbegutachtung von Aussagen von Personen mit DIS einzuordnen.
- Neurobiologische Grundlagen der DIS
- Methoden der Aussagepsychologischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung
- Herausforderungen bei der Begutachtung von Personen mit DIS
- Potenzial neurobiologischer und epigenetischer Diagnostik
- Zusammenhang zwischen DIS und Suggestibilität
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik und Forschungsfrage. Kapitel 2 (Dissoziative Identitätsstörung): Definition, Prävalenz, Traumabezug, Pathogenese, Diagnostik, Komorbiditäten und Therapieansätze der DIS werden umfassend dargestellt. Kapitel 3 (Neurobiologie der Dissoziativen Identitätsstörung): Präsentation aktueller neurobiologischer Erkenntnisse zu strukturellen, funktionellen und genetischen Auffälligkeiten bei DIS. Kapitel 4 (Aussagepsychologische Glaubhaftigkeitsbegutachtung): Einführung in die Aussagepsychologie und die Methoden der Glaubhaftigkeitsbegutachtung, mit Fokus auf die Besonderheiten bei Personen mit DIS. Kapitel 5 (Forschungsfrage und Erkenntnisinteresse): Formulierung der Forschungsfrage und des Erkenntnisinteresses der Arbeit. Kapitel 6 (Methodik): Beschreibung der Methodik des leitfadengestützten Experteninterviews und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Kapitel 7 (Ergebnisse): Überblick über die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der Experteninterviews.
Schlüsselwörter
Dissoziative Identitätsstörung (DIS), Neurobiologie, Aussagepsychologie, Glaubhaftigkeitsbegutachtung, Trauma, Experteninterviews, Qualitative Inhaltsanalyse, Neurobiologische Diagnostik, Epigenetische Diagnostik, Suggestibilität.
- Arbeit zitieren
- Lisa Krause (Autor:in), 2023, Neurobiologie der Dissoziativen Identitätsstörung und mögliche Auswirkungen auf die Aussagepsychologie. Eine qualitative Inhaltsanalyse teilstrukturierter Experteninterviews, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1499623