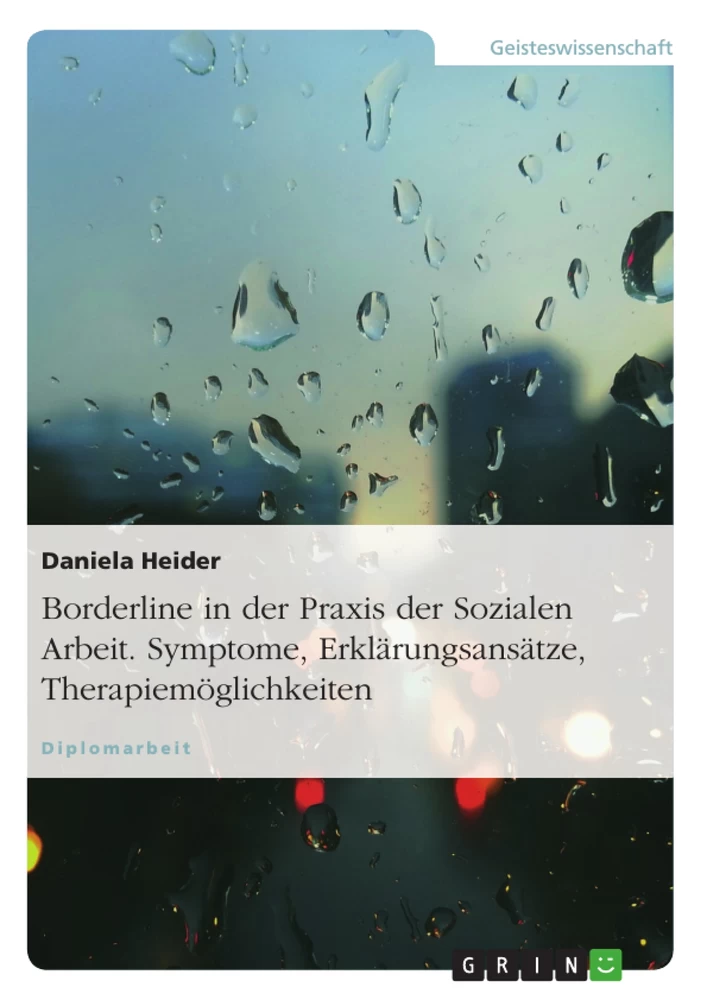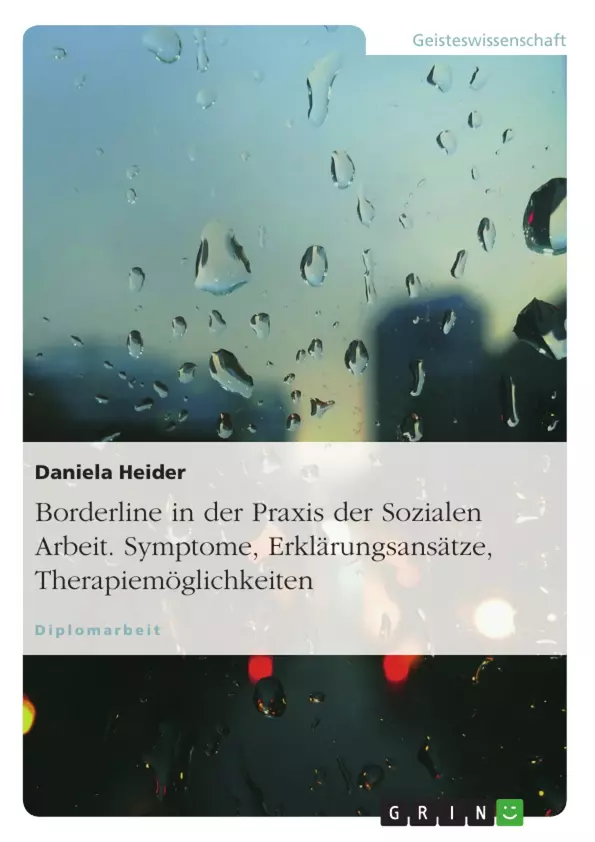Die Erklärung der verschiedenen verwendeten Begriffe zum Thema "Borderline" steht am Anfang meiner Diplomarbeit, um in Kurzform einen Einstieg zu schaffen. Des Weiteren werde ich typische Arbeitsfelder skizzieren, in denen Sozialarbeiter mit Borderlinern in Kontakt kommen können.
In Punkt 2 gehe ich erst allgemein auf Persönlichkeitsstörungen und schließlich auf die Diagnosekriterien für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung nach dem DSM IV ein. An dieser Stelle erläutere ich anhand eines praktischen Beispiels die typischen Symptome, weil sie meist das erste sind, was ins Auge fällt, wenn man mit Klienten arbeitet, die von der Borderline- Störung betroffen sind. Anschließend widme ich mich der Frage der Auswirkung einer Diagnosestellung sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf der Ebene der Beziehung zwischen Betreuer und Klient.
Eine wichtige Grundlage des Verständnisses für die Betroffenen ist es, die unterschiedlichen Erklärungsansätze für Borderline-Störungen zu kennen. In Punkt 3 fasse ich einige davon zusammen.
Punkt 4 geht auf die Angehörigen und das weitere Umfeld von Borderline-Klienten ein, was nicht einfach ist, da es hierzu kaum Literatur gibt. Außerdem besteht im Raum Stuttgart nach meiner Kenntnis keine Selbsthilfegruppe für Angehörige, weshalb ich bei meiner Recherche vollständig auf das Internet angewiesen war. Zum Umfeld von Borderline-Klienten zähle ich nicht nur die Angehörigen, sondern auch den Therapeuten oder Betreuer des Betroffenen; deshalb stelle ich ein Interview mit dem Mitarbeiter eines Sozialpsychiatrischen Dienstes vor, um einen Einblick in den Arbeitsalltag zu geben.
Daraus ergibt sich eine Verbindung zu Punkt 5, den unterschiedlichen Therapieansätzen. Natürlich kann ich die Prozesse der verschiedenen Therapien nicht vollständig in meiner Arbeit darstellen, aber ich möchte einzelne Methoden kurz anführen.
Meinen Praxisteil erläutere ich unter Punkt 6. Dieser Punkt umfasst die Beschreibung der Betreuung von zwei Klientinnen, die deutliche Borderline-Züge aufwiesen und mit denen ich jeweils ein halbes Jahr gearbeitet habe. Mit diesen persönlichen Erfahrungen, die ich in der Arbeit mit Borderlinern gemacht habe, schließe ich meine Diplomarbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Einführung in das Thema Borderline und soziale Arbeit
- 1.1 Erklärung der Begriffe
- 1.2 Historischer Überblick
- 1.3 Kontakt zu Borderlinern in Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit
- 2. Diagnostik
- 2.1 Allgemeine Definition der Persönlichkeitsstörung
- 2.2 Die Klassifikation der Borderline-Störung
- 2.3 Erläuterung der Symptome und Verhaltensmuster
- 2.3.1 Denk- und Verhaltensmuster
- 2.3.2 Zwänge
- 2.3.3 Ängste und Phobien
- 2.3.4 Sucht
- 2.3.5 Mini-Psychose
- 2.3.6 Dissoziation
- 2.3.7 Selbstverletzendes Verhalten
- 2.3.8 Aggression
- 2.3.9 Depression
- 2.3.10 Suizidalität
- 2.3.11 Exkurs: Interview mit einer Betroffenen
- 2.4 Stempel oder Störung? Zur gesellschaftlichen Problematik des Krankheitsbegriffes
- 2.5 Auswirkungen der Diagnose auf die Beziehung zwischen Betreuer und Klient
- 3. Wichtige Erklärungsansätze und Modelle der Borderline-Störung
- 3.1 Der Beitrag neurobiologischer Faktoren zur Entwicklung einer Borderline-Störung
- 3.1.1 Impulsive Aggression und serotonerges System
- 3.1.2 Affektive Instabilität und cholinerges System
- 3.2 Sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze
- 3.2.1 Deprivation, Misshandlung und Missbrauch
- 3.2.2 Die strukturelle Seite der traumatischen Gewalterfahrungen
- 3.2.3 Die Familienorganisation
- 3.3 Kernbergs psychoanalytisches Erklärungsmodell
- 3.3.1 Libidotheorie und psychosexuelle Entwicklung
- 3.3.2 Die Entstehung einer Borderline-Persönlichkeitsorganisation
- 3.3.3 Die Funktionen der typischen Borderline-Strukturen
- 3.4 Systemische Theorien
- 3.4.1 Erzeugung und Sinn der Symptome
- 3.4.2 Die Borderline-Familienstrukturen und ihre Funktion
- 3.5 Die biosoziale Theorie der dialektisch-behavioralen Therapie
- 3.5.1 Emotionale Fehlregulation
- 3.5.2 Invalidierende Umgebungen
- 3.5.3 Die Wechselwirkungen
- 3.6 Zusammenfassende Bewertung der verschiedenen Ansätze
- 3.6.1 Vergleich und persönliche Einschätzung
- 3.6.2 Interessante Aspekte für die Soziale Arbeit
- 3.1 Der Beitrag neurobiologischer Faktoren zur Entwicklung einer Borderline-Störung
- 4. Die Auswirkungen des Borderline-Syndroms auf das Umfeld der Betroffenen
- 4.1 Die Notwendigkeit der Angehörigenarbeit
- 4.2 Informationen über Betroffene und Angehörige finden, aber wie?
- 4.3 Die Auswirkungen der Borderline-Störung auf die Partnerschaft
- 4.3.1 Co-Problematik bei Partnern von Borderlinern
- 4.3.2 Interview mit einer Partnerin
- 4.4 Weglaufen gilt nicht! Die Bedeutung der Borderline-Störung für die Familienangehörigen
- 4.4.1 Böse Eltern oder leidende Eltern?
- 4.4.2 Interview mit einer Mutter
- 4.4.3 Von Helden und Sündenböcken- Die Kinder aus Borderline-Familien
- 4.5 "Borderliner spalten das Team!"" Auswirkungen auf die professionelle Beziehung
- 4.6 Sieben Fragen an einen Mitarbeiter eines sozialpsychiatrischen Dienstes
- 5. Therapeutische Möglichkeiten
- 5.1 Die medikamentöse Therapie der Borderline-Störung
- 5.1.1 Antipsychotika
- 5.1.2 Antidepressiva
- 5.2 Die psychoanalytische Therapie der Borderline-Störungen
- 5.3 Dialektisch-behaviorale Therapie
- 5.4 Systemische Therapie
- 5.5 Zusammenfassende Bewertung der verschiedenen Ansätze
- 5.5.1 Vergleich und persönliche Einschätzung
- 5.5.2 Interessante Aspekte für die Soziale Arbeit
- 5.6 Anlaufstellen
- 5.6.1 Kliniken
- 5.6.2 Hilfe aus dem Internet
- 5.1 Die medikamentöse Therapie der Borderline-Störung
- 6. Beispiele aus der Praxis
- 6.1 Gespräche mit Frau W.
- 6.2 Gespräche mit Frau S.
- 6.3 Mein Erleben der Kontakte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit zielt darauf ab, das Borderline-Syndrom aus der Perspektive der Sozialen Arbeit zu beleuchten und ein besseres Verständnis für die Herausforderungen im Umgang mit Betroffenen zu vermitteln. Die Arbeit basiert auf den Erfahrungen der Autorin im Praxissemester und integriert verschiedene theoretische Ansätze.
- Symptome und Diagnostik des Borderline-Syndroms
- Biologische und sozialwissenschaftliche Erklärungsmodelle
- Auswirkungen des Borderline-Syndroms auf das Umfeld der Betroffenen (Familie, Partner, professionelle Helfer)
- Therapeutische Möglichkeiten und Ansätze
- Praktische Beispiele aus der Sozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit entstand aus den Erfahrungen der Autorin mit einem Klienten mit borderline-typischem Verhalten in einem Suchtberatungskontext. Die anfängliche Verwirrung über das unvorhersehbare Verhalten führte zur Beschäftigung mit dem Thema und der Erstellung dieser Arbeit. Die Arbeit soll ein tiefergehendes Verständnis des Borderline-Syndroms für Sozialarbeiter vermitteln.
1. Einführung in das Thema Borderline und soziale Arbeit: Dieses Kapitel liefert eine grundlegende Einführung in die Thematik und beleuchtet den Kontakt zu Borderlinern in verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Es werden grundlegende Begriffe definiert und ein historischer Überblick über das Verständnis der Störung gegeben. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Themas für die Praxis der Sozialen Arbeit.
2. Diagnostik: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Diagnostik der Borderline-Störung. Es werden die allgemeine Definition der Persönlichkeitsstörung, die Klassifikation und die verschiedenen Symptome und Verhaltensmuster (Denk- und Verhaltensmuster, Zwänge, Ängste, Suchtverhalten, Selbstverletzung, Aggression, Depression, Suizidalität etc.) erläutert. Die gesellschaftliche Problematik des Krankheitsbegriffs und die Auswirkungen der Diagnose auf die Beziehung zwischen Betreuer und Klient werden ebenfalls behandelt. Interviews mit Betroffenen und Angehörigen bereichern den Einblick in die Thematik.
3. Wichtige Erklärungsansätze und Modelle der Borderline-Störung: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung der Borderline-Störung, darunter neurobiologische Faktoren (z.B. die Rolle des serotonergen und cholinergen Systems), sozialwissenschaftliche Perspektiven (Deprivation, Misshandlung, traumatische Erfahrungen, Familienstrukturen), Kernbergs psychoanalytisches Modell, systemische Theorien und die biosoziale Theorie der dialektisch-behavioralen Therapie (DBT). Jeder Ansatz wird detailliert beschrieben und kritisch bewertet, wobei der Fokus auf den relevanten Aspekten für die Soziale Arbeit liegt.
4. Die Auswirkungen des Borderline-Syndroms auf das Umfeld der Betroffenen: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Borderline-Störung auf das Umfeld der Betroffenen. Es werden die Notwendigkeit der Angehörigenarbeit, die Schwierigkeiten beim Informationserwerb und die Herausforderungen in Partnerschaften und Familien diskutiert. Interviews mit Angehörigen geben Einblicke in die persönlichen Erfahrungen. Der Einfluss auf die professionelle Beziehung in der Sozialarbeit wird ebenfalls thematisiert.
5. Therapeutische Möglichkeiten: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene therapeutische Ansätze zur Behandlung der Borderline-Störung, darunter medikamentöse Therapien (Antipsychotika, Antidepressiva), psychoanalytische Therapie, dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) und systemische Therapie. Die Ansätze werden verglichen und im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit bewertet. Zusätzlich werden Anlaufstellen und Hilfsmöglichkeiten aufgelistet.
Schlüsselwörter
Borderline-Syndrom, Persönlichkeitsstörung, Diagnostik, Symptome, Verhaltensmuster, Erklärungsansätze, Neurobiologie, Sozialwissenschaft, Psychoanalyse, Systemische Therapie, Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT), Soziale Arbeit, Angehörigenarbeit, Therapie, Sucht, Selbstverletzung, Suizidalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Borderline-Syndrom aus Sicht der Sozialen Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich umfassend mit dem Borderline-Syndrom aus der Perspektive der Sozialen Arbeit. Sie bietet einen Überblick über die Symptomatik, Diagnostik, verschiedene Erklärungsmodelle (neurobiologische, sozialwissenschaftliche, psychoanalytische, systemische, DBT), die Auswirkungen auf das Umfeld der Betroffenen (Familie, Partner, professionelle Helfer) und therapeutische Möglichkeiten. Praktische Beispiele aus der Sozialarbeit ergänzen die theoretischen Ausführungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Einführung in das Borderline-Syndrom und seine Relevanz für die Soziale Arbeit; detaillierte Diagnostik inklusive Symptombeschreibung; verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung der Störung; Auswirkungen auf Angehörige, Partner und das professionelle Umfeld; Übersicht über therapeutische Verfahren (medikamentös, psychoanalytisch, DBT, systemisch); und schließlich Praxisbeispiele aus der Arbeit der Autorin.
Welche Erklärungsmodelle für das Borderline-Syndrom werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert eine Vielzahl von Erklärungsmodellen, darunter neurobiologische Ansätze (Fokus auf serotonerges und cholinerges System), sozialwissenschaftliche Perspektiven (Deprivation, Misshandlung, Trauma, Familiendynamik), Kernbergs psychoanalytisches Modell, systemische Theorien und die biosoziale Theorie der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT). Die Modelle werden verglichen und kritisch bewertet.
Wie werden die Auswirkungen des Borderline-Syndroms auf das Umfeld beschrieben?
Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen auf Partner, Familie und professionelle Helfer. Es wird die Notwendigkeit der Angehörigenarbeit hervorgehoben und die Herausforderungen in diesen Beziehungen detailliert dargestellt. Interviews mit Betroffenen und Angehörigen liefern persönliche Einblicke in die Situation.
Welche therapeutischen Möglichkeiten werden diskutiert?
Die Arbeit beschreibt verschiedene therapeutische Ansätze, darunter medikamentöse Therapien (Antipsychotika, Antidepressiva), psychoanalytische Therapie, Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) und systemische Therapie. Die verschiedenen Ansätze werden verglichen und im Hinblick auf ihre Relevanz für die Soziale Arbeit bewertet. Zusätzlich werden Anlaufstellen und Hilfsmöglichkeiten genannt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Einführung in das Thema Borderline und Soziale Arbeit, Diagnostik, Erklärungsansätze und Modelle, Auswirkungen auf das Umfeld, Therapeutische Möglichkeiten und Praxisbeispiele. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel genauer beschrieben.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe sind Sozialarbeiter*innen und alle, die sich professionell mit dem Borderline-Syndrom auseinandersetzen. Die Arbeit soll ein besseres Verständnis für die Herausforderungen im Umgang mit Betroffenen vermitteln und die praktische Arbeit unterstützen.
Gibt es Praxisbeispiele in der Arbeit?
Ja, die Arbeit enthält Praxisbeispiele aus dem Praxissemester der Autorin, welche die theoretischen Ausführungen illustrieren und veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Borderline-Syndrom, Persönlichkeitsstörung, Diagnostik, Symptome, Verhaltensmuster, Erklärungsansätze, Neurobiologie, Sozialwissenschaft, Psychoanalyse, Systemische Therapie, Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT), Soziale Arbeit, Angehörigenarbeit, Therapie, Sucht, Selbstverletzung, Suizidalität.
Wo finde ich weitere Informationen zum Borderline-Syndrom?
Die Arbeit nennt im Kapitel zu den therapeutischen Möglichkeiten verschiedene Anlaufstellen und Hilfsmöglichkeiten, sowohl klinische Einrichtungen als auch Internetressourcen.
- Quote paper
- Daniela Heider (Author), 2003, Borderline in der Praxis der Sozialen Arbeit. Symptome, Erklärungsansätze, Therapiemöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14999