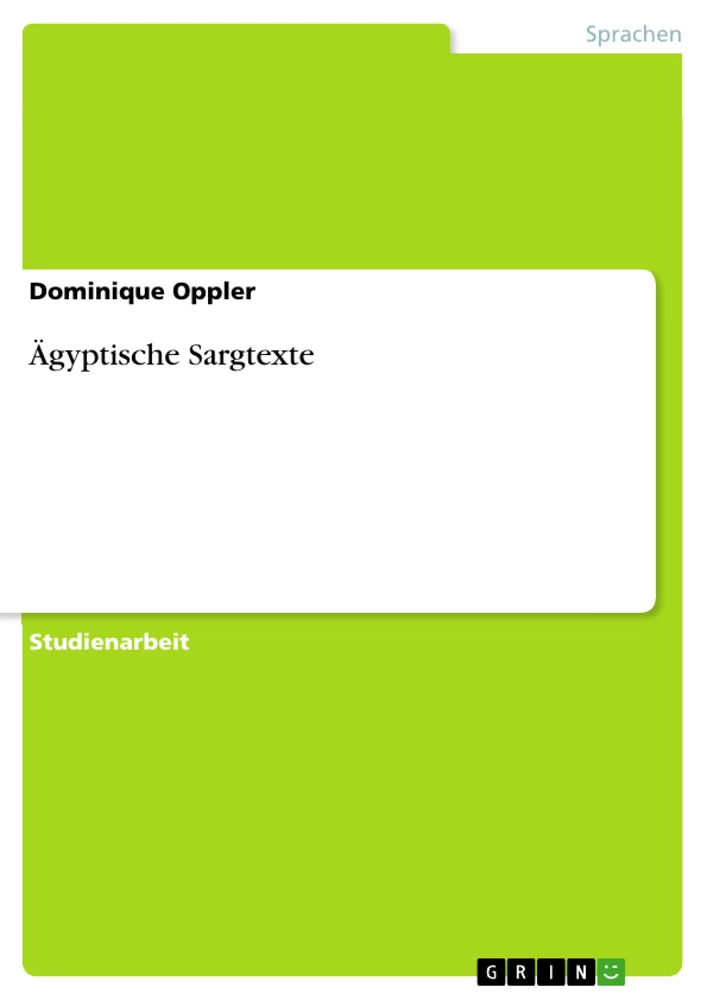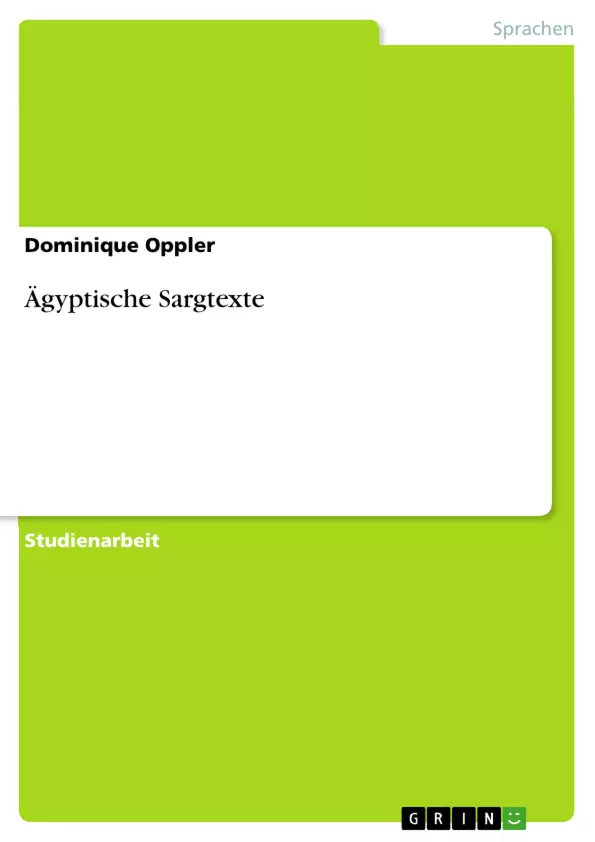In der ersten Zwischenperiode, 2100 v. Chr., waren die hohen Funktionäre des Königreiches zu lokalen Oberhäuptern avanciert, und hatten eine hoch organisierte Feudalherrschaft mit Erbrecht eingerichtet. Gleich den Pharaonen, hielten sie einen luxuriösen Hofstaat, samt Handwerkern, Priestern und Ärzten.
In dieser Zeit entwickelten sich in den Provinzen Nekropolen dieser neuen Aristokratie, mit dekorierten und beschrifteten Mastaben und Felsengräber. Diese neue Elite ließ sich in einfachen Holzsärgen bestatten, und die Grabkammern boten nicht mehr so viel Platz, um Grabtexte, wie Pyramidentexte, an den Wänden anzubringen. Daher ging man zur Sitte über, die Holzsärge selbst zu beschriften, an den Aussen-, und vor allem an den Innenseiten.
Zu diesen Texten gehörten, nebst den Pyramidentexten, welche im alten Reich ausschliesslich den Königen vorbehalten waren, auch komplett neue Textformen.
Die neuen Nekropolen lagen hauptsächlich bei Heliopolis, der alten Hauptstadt Memphis (Sakkarah, Dahschur), El-Lischt und Herakleopolis, Assiut, Beni Hassan, el-Bershk, Theben, bei Kôm el-Hisn bis Assuan, beim ersten Katarakt.
Die Texte stammten aus der ersten Zwischenzeit um 2160 v. Chr., und erhielten sich bis zur 13. Dynastie um 1700 v. Chr., was der Zeit des „Mittleren Reiches“ entsprach. Die bedeutendste Entwicklung erfolgte in der 12. Dynastie. Einige der Texte entstammten dem Ende des alten Reiches, Papyri von unbekannter Herkunft, die heute für die Forschung von speziellem Interesse sind, da sie massgeblich den Schreibern und Malern der Sarkophage als Vorlage dienten.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Särge
- Inhaber der Särge
- Die Texte, Textstruktur, Textaufbau
- Textinhalte
- Textgestaltung
- Versuch einer Textstruktur nach Barguet
- 1. Teil: Einleitende Texte
- 2. Teil: Die Bestimmung, das Los des Toten
- 3. Teil: Die Gefahren der anderen Welt und ihre Ausweichmöglichkeiten
- 4. Teil: Andere Texte
- 5. Teil: Das Buch der zwei Wege
- 6. Teil: Das Buch der zwei Wege (2. Textteil)
- Rituelle Sprechhandlungen
- Schlussbetrachtung
- Sprüche
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Sargtexten des Mittleren Reiches in Ägypten. Ziel ist es, die Entstehung, Struktur, Inhalte und Gestaltung dieser Texte zu analysieren und in den Kontext der altägyptischen Jenseitsvorstellungen einzuordnen.
- Entstehung und Entwicklung der Sargtexte im Vergleich zu anderen Jenseitsbüchern
- Die Funktion und Bedeutung der Sargtexte im Bestattungsritual
- Die Struktur und Inhalte der Sargtexte, insbesondere die verschiedenen Textteile und ihre Themen
- Die Gestaltung der Sargtexte, einschließlich der verwendeten Schrift, Symbole und Bilder
- Die Rolle der Sargtexte im Kontext der altägyptischen Jenseitsvorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung bietet einen Überblick über die verschiedenen altägyptischen Jenseitsbücher, einschließlich der Pyramidentexte, Totenbücher und Unterweltsbücher. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung der Sargtexte im Mittleren Reich und die Gründe für ihre Entwicklung.
Das Kapitel über die Särge beschreibt die Bauweise und Gestaltung der Särge, die als Grabstätten für die Verstorbenen dienten. Es werden die verschiedenen Dekorationen und Symbole auf den Särgen erläutert, die eine wichtige Rolle im Bestattungsritual spielten.
Das Kapitel über die Inhaber der Särge befasst sich mit den sozialen und gesellschaftlichen Hintergründen der Verstorbenen, die in den Särgen bestattet wurden. Es werden die verschiedenen sozialen Schichten und Berufsgruppen beleuchtet, die in den Sargtexten erwähnt werden.
Das Kapitel über die Texte, Textstruktur und Textaufbau analysiert die Struktur und den Aufbau der Sargtexte. Es werden die verschiedenen Textteile und ihre Themenbereiche vorgestellt und die verwendeten Schreibweisen und Symbole erläutert.
Das Kapitel über die Textinhalte befasst sich mit den verschiedenen Themen und Inhalten der Sargtexte. Es werden die wichtigsten Themenbereiche, wie z.B. die Reise des Verstorbenen in die Unterwelt, die Begegnung mit den Totenrichtern und die Wiedergeburt, vorgestellt.
Das Kapitel über die Textgestaltung analysiert die Gestaltung der Sargtexte, einschließlich der verwendeten Schrift, Symbole und Bilder. Es werden die verschiedenen Gestaltungselemente und ihre Bedeutung im Kontext der altägyptischen Jenseitsvorstellungen erläutert.
Das Kapitel über den Versuch einer Textstruktur nach Barguet stellt eine mögliche Gliederung der Sargtexte nach dem Ägyptologen Paul Barguet vor. Es werden die verschiedenen Textteile und ihre Themenbereiche in einem strukturierten Rahmen dargestellt.
Das Kapitel über die rituellen Sprechhandlungen befasst sich mit der Rolle der Sargtexte im Bestattungsritual. Es werden die verschiedenen rituellen Handlungen und Sprechweisen erläutert, die mit den Sargtexten verbunden waren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Sargtexte, das Mittlere Reich, altägyptische Jenseitsvorstellungen, Bestattungsritual, Pyramidentexte, Totenbuch, Unterweltsbücher, Textstruktur, Textinhalte, Textgestaltung, Rituelle Sprechhandlungen, Götter, Göttinnen, Symbole, Bilder, Schrift, Hieratische Schrift, Hieroglyphen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind ägyptische Sargtexte?
Sargtexte sind religiöse Sprüche und Jenseitsvorstellungen, die im Mittleren Reich (ca. 2100–1700 v. Chr.) vor allem auf die Innenseiten von Holzsärgen geschrieben wurden.
Wie unterscheiden sie sich von den Pyramidentexten?
Pyramidentexte des Alten Reiches waren ausschließlich dem König vorbehalten. Die Sargtexte machten diese religiösen Privilegien auch für hohe Beamte und die neue Aristokratie zugänglich.
Warum wurden die Texte auf Särge geschrieben?
Da die Grabkammern der Beamten oft kleiner waren als königliche Pyramiden, boten die Wände nicht genug Platz. Der Sarg selbst wurde so zum Träger der magischen Schutztexte für die Reise ins Jenseits.
Was ist das „Buch der zwei Wege“?
Es ist ein spezieller Teil der Sargtexte, der als eine Art illustrierte Landkarte der Unterwelt gilt und dem Verstorbenen helfen sollte, Gefahren zu umgehen und das Ziel zu erreichen.
Welche Themen werden in den Texten behandelt?
Die Texte behandeln die Verwandlung des Toten, den Schutz vor Dämonen, die Rechtfertigung vor dem Totengericht und die Sicherung der Nahrungsversorgung im Jenseits.
In welcher Schrift wurden die Sargtexte verfasst?
Sie wurden meist in einer kursiven Form der Hieroglyphen oder in Hieratisch geschrieben, oft ergänzt durch symbolische Zeichnungen.
- Quote paper
- Dominique Oppler (Author), 2010, Ägyptische Sargtexte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150004