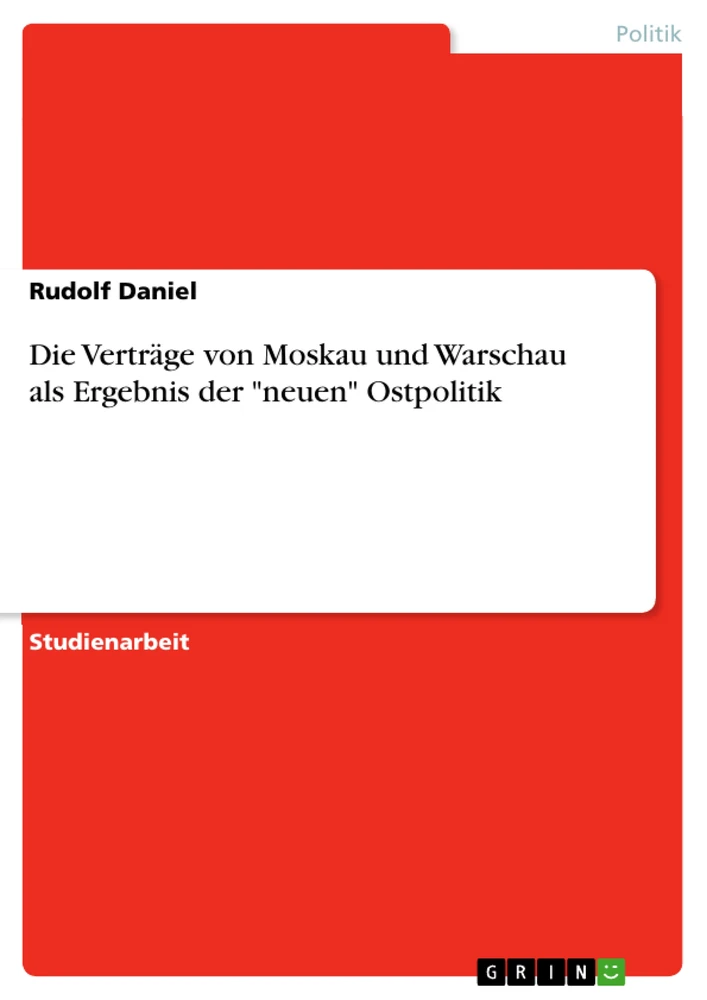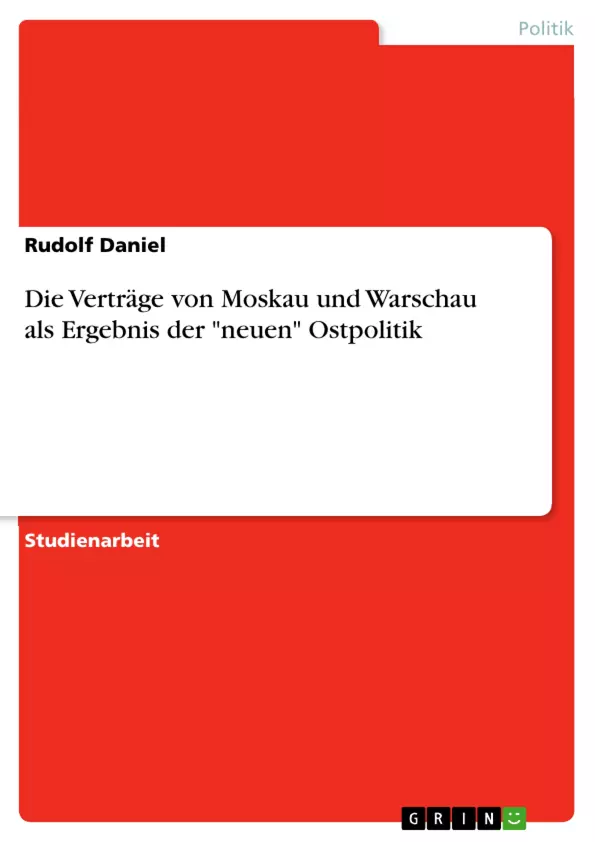Ein zentrales Anliegen zur Zeit des Neubeginns der deutschen Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg bestand in „der Sicherung des Gemeinwesens vor der militärischen und ideologischen Gefährdung aus dem Osten“ (Peckert 1990: 9), wozu der Deutschlandvertrag aus dem Jahre 1952 und der Beitritt zur NATO 1955 wesentliche Beträge leisteten. Zudem wurde damit eine Grundlage für eine eigene Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland geschaffen, so dass bereits unter der Regierung Adenauer im Jahre 1955 seitens der Bundesrepublik Deutschland erstmals diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufgenommen werden konnten und mit dieser drei Jahre später ein Wirtschafts- und Repatriierungsabkommen abgeschlossen wurde. Brandt strebte mit der Umsetzung der „Neuen“ Ostpolitik zu Beginn der siebziger Jahre eine langfristige Annäherung und eine Normalisierung der Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten an, wobei sich diese Politik nicht nur nahtlos in den internationalen Prozess der Entspannungspolitik einfügte, sondern selbst als dynamischer Faktor die Entspannung vorantrieb.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie die außenpolitische Planung und Zielsetzung der Regierung Brandt in der „Neuen“ Ostpolitik und insbesondere in den Verträgen von Moskau und Warschau mit Hilfe diplomatischen Geschicks eine konkrete Umsetzung erfuhr. Zunächst sollen einige Grundlagen der Diplomatie erläutert werden, wobei ein Schwerpunkt auf die diplomatischen Besonderheiten der „Neuen“ Ostpolitik gesetzt wird. Des Weiteren gilt es, die geschichtlichen Hintergründe sowie die Zielsetzungen von Brandts Ostpolitik genauer zu beleuchten. Eine in diesem Kontext erfolgende Analyse des Einflusses bedeutender Entscheidungsträger widmet sich vor allem auch Egon Bahr und seiner Rolle bei der Konzeption der Ostpolitik. Die Verträge von Warschau und Moskau werden anschließend jeweils bezüglich ihrer Vertragsverhandlungen und - damit verbunden – der zu leistenden, diplomatischen Vorarbeit, ihrer ausgearbeiteten vertraglichen Bestimmungen sowie der aus ihnen für die jeweiligen Vertragsparteien resultierenden Konsequenzen untersucht. Im abschließenden Fazit werden schließlich die wichtigsten Ergebnisse dieser Analyse zusammengefasst und die Bedeutung des „Neuen“ Ostpolitik für die Wiedervereinigung beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Diplomatie
- Definition des Diplomatie-Begriffs
- Diplomatische Besonderheiten der „Neuen“ Ostpolitik
- Die „Neue“ Ostpolitik der Regierung Brandt
- Geschichtliche Hintergründe
- Entscheidungsträger der Ostpolitik
- Grundlegende Ziele
- Die Verträge von Moskau und Warschau
- Der Moskauer Vertrag
- Die Vertragsverhandlungen
- Inhaltliche Bestimmungen des Vertrages
- Folgen des Vertrages
- Der Warschauer Vertrag
- Die Vertragsverhandlungen
- Inhaltliche Bestimmungen des Vertrages
- Folgen des Vertrages
- Der Moskauer Vertrag
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung der „Neuen“ Ostpolitik der Regierung Brandt, insbesondere im Kontext der Verträge von Moskau und Warschau. Dabei wird der Fokus auf das diplomatische Geschick gelegt, welches zur konkreten Umsetzung der außenpolitischen Planung und Zielsetzung der Regierung Brandt beitrug.
- Diplomatische Grundlagen der „Neuen“ Ostpolitik
- Geschichtliche Hintergründe und Ziele der Ostpolitik
- Einfluss bedeutender Entscheidungsträger, insbesondere Egon Bahrs
- Analyse der Vertragsverhandlungen, -bestimmungen und -folgen der Verträge von Moskau und Warschau
- Bedeutung der „Neuen“ Ostpolitik für die Wiedervereinigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung beleuchtet den Beginn der deutschen Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg und die Bedeutung des Deutschlandvertrages von 1952 sowie des NATO-Beitritts von 1955. Sie verdeutlicht die Entstehung der Ostpolitik der Bundesrepublik und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion unter Adenauer. Darüber hinaus wird die „Neue“ Ostpolitik Brandts als Instrument zur Annäherung und Normalisierung der Beziehungen zu osteuropäischen Staaten vorgestellt, die den internationalen Prozess der Entspannungspolitik vorantrieb.
Grundlagen der Diplomatie
Definition des Diplomatie-Begriffs
Dieser Abschnitt definiert den Begriff der Diplomatie und erläutert seine Bedeutung für die Handhabung internationaler Beziehungen. Es wird hervorgehoben, dass Diplomatie ein wirkungsmächtiges Instrument der Außenpolitik ist, das bei Verhandlungen und Absprachen zum Einsatz kommt und sich über Jahrhunderte bewährt hat. Die „Neue Diplomatie des 20. und 21. Jahrhunderts“ wird als offene Diplomatie beschrieben, die Transparenz der Außenpolitik betont.
Diplomatische Besonderheiten der „Neuen“ Ostpolitik
Dieser Teil analysiert die Richtlinienkompetenz des Kanzlers in der Außenpolitik und die besondere Bedeutung des Auswärtigen Amtes unter Brandt. Er beleuchtet die Rolle sozialer Fähigkeiten von Diplomaten und das Konzept von „backchannels“ bei der Umsetzung außenpolitischer Intelligenz. Egon Bahrs Rolle als herausragender Diplomat und sein Netzwerk zu wichtigen Akteuren, wie beispielsweise Henry Kissinger, wird näher untersucht.
Die „Neue“ Ostpolitik der Regierung Brandt
Geschichtliche Hintergründe
Dieser Abschnitt behandelt die historischen Hintergründe der „Neuen“ Ostpolitik, indem er den Kontext der deutsch-sowjetischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg und die bereits bestehenden Beziehungen unter Adenauer beleuchtet. Der Fokus liegt auf den Beweggründen und den Zielen Brandts, die eine langfristige Annäherung und Normalisierung der Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten anstrebten.
Entscheidungsträger der Ostpolitik
Dieser Abschnitt widmet sich den Entscheidungsträgern der Ostpolitik, wobei Egon Bahr und seine Rolle bei der Konzeption der Ostpolitik im Vordergrund stehen. Es wird die besondere Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen Brandt und Bahr in der Umsetzung der Ostpolitik hervorgehoben.
Grundlegende Ziele
Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Ziele der „Neuen“ Ostpolitik Brandts, welche sich auf die Annäherung und Normalisierung der Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten fokussierten. Die Bedeutung der Ostpolitik als dynamischer Faktor für die Entspannungspolitik wird ebenfalls beleuchtet.
Die Verträge von Moskau und Warschau
Der Moskauer Vertrag
Die Vertragsverhandlungen
Dieser Abschnitt analysiert die Vertragsverhandlungen des Moskauer Vertrages, die ein komplexes diplomatische Unterfangen darstellten. Es wird die Rolle der inoffiziellen Beziehungen und der „backchannels“ zwischen deutschen und sowjetischen Entscheidungsträgern im Kontext der Verhandlungen hervorgehoben.
Inhaltliche Bestimmungen des Vertrages
Dieser Teil untersucht die inhaltlichen Bestimmungen des Moskauer Vertrages, welche die Grundlage für die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion legten. Es werden die wichtigsten Inhalte des Vertrages zusammengefasst, die sich beispielsweise auf die Anerkennung der bestehenden Grenzen und die Verzicht auf den Einsatz von Gewalt beziehen.
Folgen des Vertrages
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Folgen des Moskauer Vertrages, die sich sowohl auf die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion als auch auf die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur auswirkten. Es werden die positiven Aspekte der Normalisierung der Beziehungen sowie die potentiellen Risiken im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit beleuchtet.
Der Warschauer Vertrag
Die Vertragsverhandlungen
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Vertragsverhandlungen des Warschauer Vertrages, die eine komplexe diplomatische Aufgabe darstellten. Es wird die Rolle der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen im Kontext der Verhandlungen hervorgehoben.
Inhaltliche Bestimmungen des Vertrages
Dieser Teil behandelt die inhaltlichen Bestimmungen des Warschauer Vertrages, die die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als endgültige Westgrenze Polens und die Verzicht auf Gewalt im deutsch-polnischen Verhältnis beinhalteten. Es werden die wichtigsten Punkte des Vertrages zusammengefasst, die sich auf die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen auswirkten.
Folgen des Vertrages
Dieser Abschnitt analysiert die Folgen des Warschauer Vertrages für die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen. Es werden die positiven Auswirkungen der Normalisierung der Beziehungen sowie die Herausforderungen im Kontext der historischen Aufarbeitung und der Erinnerungskultur beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit konzentriert sich auf die „Neue“ Ostpolitik der Regierung Brandt, insbesondere auf die Verträge von Moskau und Warschau. Sie analysiert die diplomatischen Grundlagen und Besonderheiten der Ostpolitik, die geschichtlichen Hintergründe und Ziele der Ostpolitik sowie den Einfluss bedeutender Entscheidungsträger wie Egon Bahr. Zudem wird die Bedeutung des „Neuen“ Ostpolitik für die Wiedervereinigung beleuchtet. Die Arbeit beschäftigt sich mit den Vertragsverhandlungen, -bestimmungen und -folgen der Verträge von Moskau und Warschau. Zu den zentralen Themen gehören: Diplomatie, „Neue“ Ostpolitik, Verhandlungen, Verträge, Moskau, Warschau, Egon Bahr, Wiedervereinigung.
- Quote paper
- Rudolf Daniel (Author), 2009, Die Verträge von Moskau und Warschau als Ergebnis der "neuen" Ostpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150053