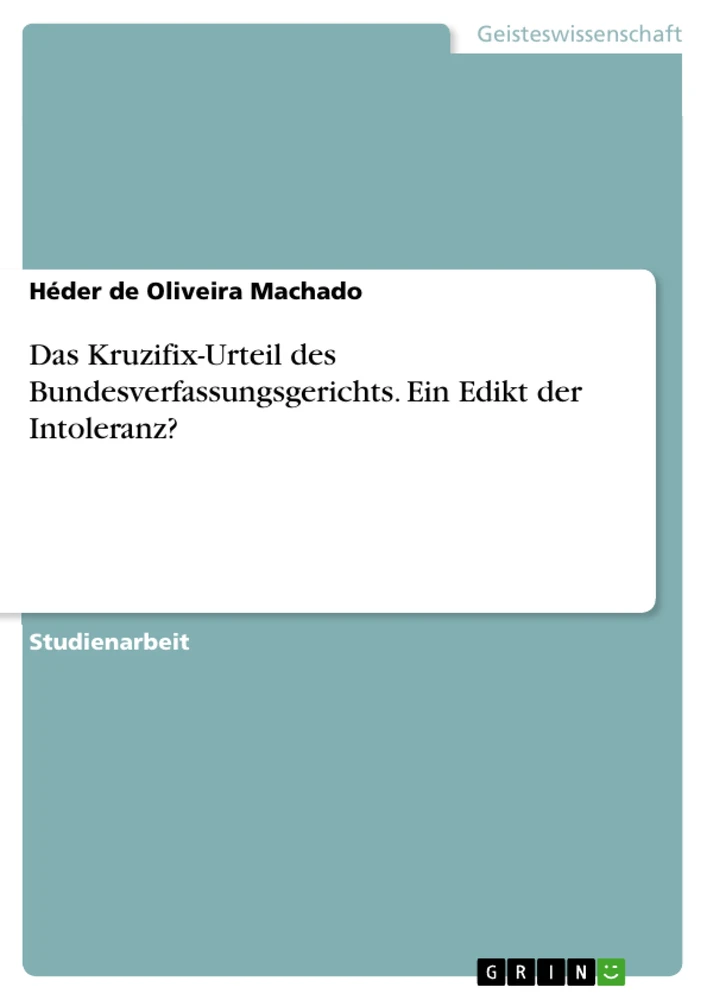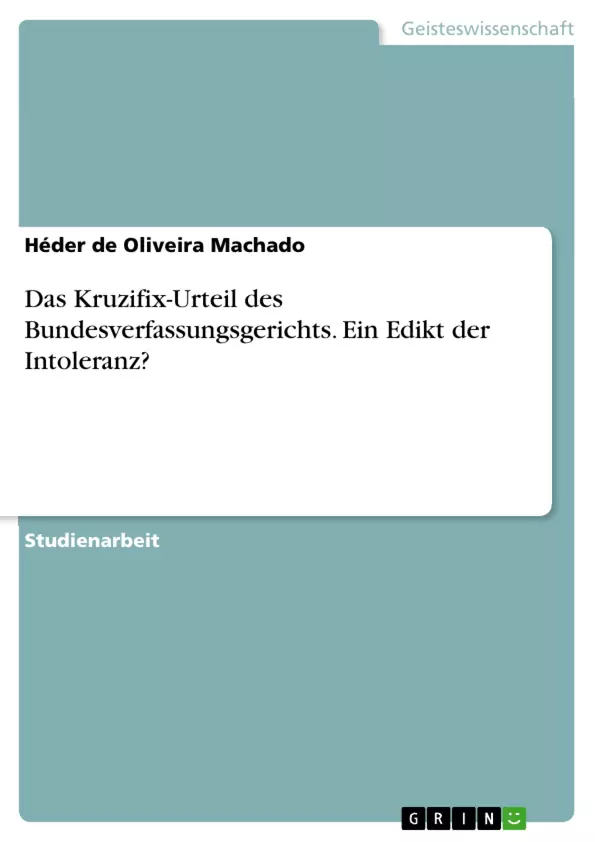Diese Hausarbeit untersucht das Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. August 1995 und dessen Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft. Im Fokus steht die Frage, ob das Urteil als ein Zeichen der Intoleranz gegenüber den kulturellen und historischen Wurzeln Bayerns, die stark vom Christentum geprägt sind, interpretiert werden kann. Die Arbeit beleuchtet die juristische Grundlage des Urteils, insbesondere die Bedeutung der Glaubens- und Gewissensfreiheit gemäß Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes, und analysiert die symbolische Bedeutung des Kreuzes in den verschiedenen gerichtlichen Instanzen. Darüber hinaus werden die vielfältigen gesellschaftlichen Reaktionen, insbesondere von religiösen Gruppen, politischen Akteuren und der breiten Bevölkerung, detailliert betrachtet. Abschließend wird die heutige Gesetzeslage in Bayern im Kontext der fortlaufenden Debatte um religiöse Symbole im öffentlichen Raum untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachverhalt
- Der Rechtsstreit
- Die Glaubens- und Gewissensfreiheit des Art. 4, Absatz 1 GG
- Die negative Glaubensfreiheit
- Der symbolische Gehalt des Kreuzes
- Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg
- Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs München
- Das Kruzifix-Urteil
- Die Reaktionen auf das Kruzifix-Urteil
- Reaktionen religiöser Gruppen
- Reaktionen der christlichen Kirchen
- Reaktionen religiöser Minderheiten
- Das Urteil in politischen Kreisen
- Die Reaktionen in der Bevölkerung
- Vergleiche zur Nazizeit als Form der Reaktion
- Reaktionen religiöser Gruppen
- Heutige Gesetzeslage in Bayern
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995, welches eine Vorschrift der bayerischen Volksschulordnung für nicht verfassungskonform erklärte, die den Anbringung eines Kreuzes in jedem Klassenzimmer vorschrieb. Das Ziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, ob sich das Bundesverfassungsgericht durch diese Entscheidung intolerant gegenüber dem kulturell und geschichtlich vom Christentum geprägten Bayern zeigte.
- Die Auslegung der Symbolik des Kreuzes durch die Verwaltungsgerichte und das Bundesverfassungsgericht
- Die Reaktionen auf das Urteil in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland
- Das Spannungsfeld zwischen Toleranz, pluralistischer Gesellschaft, Glaubensfreiheit und dem neutralen Rechtsstaat
- Die Bedeutung der negativen Glaubensfreiheit im Kontext des Urteils
- Die Bedeutung des Urteils für das Verhältnis zwischen Staat und Religion in einer pluralistischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische Entwicklung des Kreuzes als Symbol des Christentums dar und führt den Leser in die Thematik des Kruzifix-Urteils ein. Das zweite Kapitel beschreibt den Sachverhalt und den Rechtsstreit, der zum Kruzifix-Urteil führte. Es beleuchtet den Klagegrund der Familie S. und die damit verbundene Einschränkung ihrer Glaubensfreiheit. Weiterhin wird das Grundrecht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit des Art. 4, Absatz 1 GG näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Toleranz, Pluralismus, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit, Säkularisierung, Symbolismus, Kruzifix, Bundesverfassungsgericht, Rechtsschutz, Staatsneutralität, Weltanschauung, Verfassung, Grundgesetz, negative Glaubensfreiheit.
- Arbeit zitieren
- Héder de Oliveira Machado (Autor:in), 2006, Das Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ein Edikt der Intoleranz?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1500783