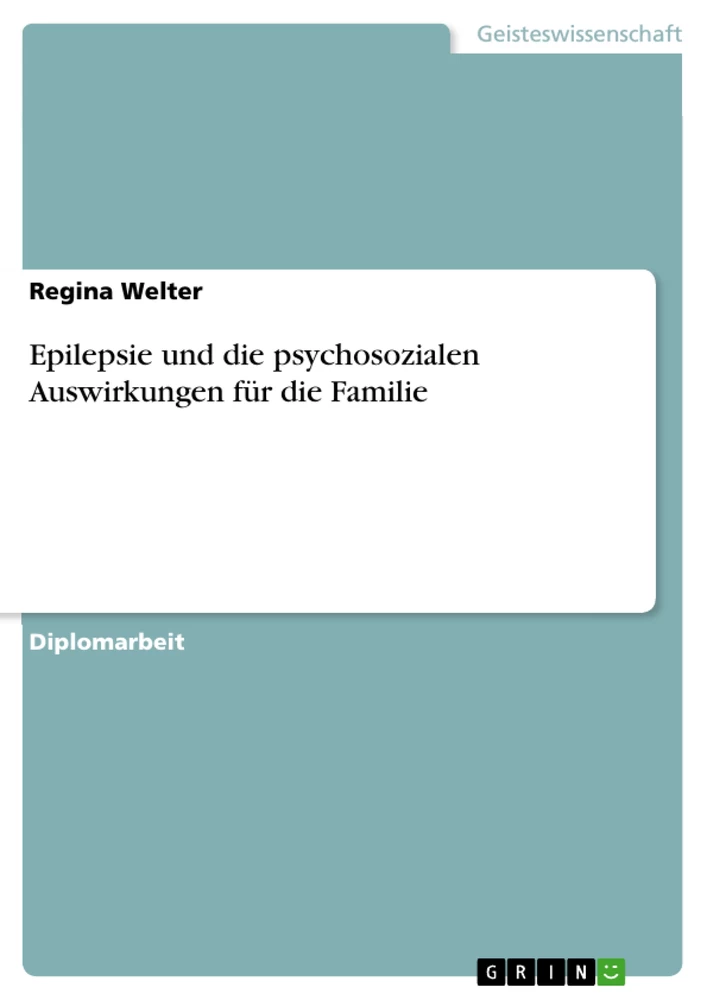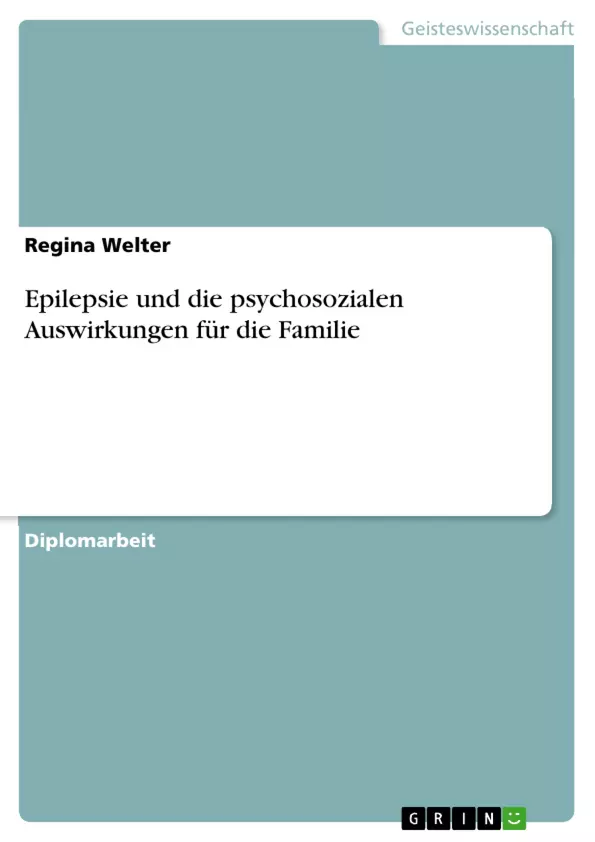In vielen literarischen Werken findet die Thematik Epilepsie Verwendung. In dem Buch „Der Idiot“ von Fjodor M. Dostojewskij verarbeitet der Schriftsteller seine eigene Erkrankung und die damit verbundenen Reaktionen der Umwelt, wie bspw.: „Verhält er sich wenigstens ruhig, wenn er seine Anfälle bekommt? ...“ (vgl. Dostojewskij 1965: 70). In dem Buch „Rote Sonne, Schwarzes Land“ von Barbara Wood, die Autorin war zehn Jahre als Chirurgie-Assistentin tätig, leidet ebenfalls eine Romanfigur an Epilepsie und deren Folgen (vgl. Wood 1989: 240 f, 306 f).
Während meines Vorpraktikums in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung lernte ich einen Betroffenen kennen, der den ganzen Vormittag auf Reize, die von außen kamen nicht reagierte, da er sehr starke Antiepileptika nehmen musste und diese seine Sinne beeinträchtigten. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin während meiner Studienzeit erlebte ich in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung das erste Mal einen Grand-mal-Status mit. Die Hilflosigkeit mancher Teilnehmer machte mir das Ausmaß eines Anfalls und die Betroffenheit der Umstehenden bewusst.
Die Frage, die mich beim Schreiben besonders leiten wird ist, in wieweit das soziale Umfeld das Denken, Fühlen und Handeln in einer Familie mit einem an einer Epilepsie erkrankten Familienmitglied beeinflussen kann. Eine Begriffsbestimmung von „Epilepsie“ leitet diese Arbeit ein. Das Nervensystem, die Aufgabenverteilung im Gehirn und die Funktion der Nervenzellen werden anschließend betrachtet. Einer Beschreibung der Erkrankung, die die Entstehung, das Anfallsgeschehen, die Diagnostik und die unterschiedlichen Formen der Behandlung beinhaltet, folgt eine kurze geschichtliche Aufzeichnung. Mit einer Erläuterung des Begriffs „psychosozial“ wird die Arbeit fortgesetzt. Nachdem die Situation der Familie bei Erkrankung eines Kindes oder bei Erkrankung eines Erwachsenen ausführlich beleuchtet wird, soll ein Bild vom Verhalten der sozialen Umwelt gegenüber dem Erkrankten und seiner Familie erstellt werden. Ausgehend von dieser Sicht werden mögliche Reaktionen der betroffenen Familie aufgezeigt. Ein besonderes Augenmerk gilt der Frage: „Erzähle ich dem Umfeld von meiner Epilepsie?“. Abschließend erfolgt eine Darstellung eventuell auftretender psychischer und physischer Probleme für den Menschen mit Epilepsie. Mit Hilfe meiner theoretischen Ausarbeitung werde ich einen Fragenkatalog entwickeln, dessen Antworten mir zur Unterstützung meines Geschriebenen dienen sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffsbestimmung Epilepsie
- 2. Das Nervensystem
- 3. Aufgabenverteilung im Gehirn
- 4. Funktion der Nervenzellen
- 5. Die wichtigsten Anfallsformen
- 5.1 fokale Anfälle
- 5.1.1 einfache fokale Anfälle
- 5.1.2 komplexe fokale Anfälle
- 5.2 generalisierte Anfälle
- 5.1 fokale Anfälle
- 6. Epilepsieformen
- 6.1 Fokale Epilepsien
- 6.2 Generalisierte Epilepsien
- 6.3 Epilepsien ohne Zuordnung zu „fokal“ oder „generalisiert“
- 6.4 Besondere Epilepsieformen und Syndrome
- 7. Diagnostik
- 8. Behandlung
- 9. Folgen epileptischer Anfälle und Epilepsien für die Betroffenen
- 10. Umgang mit der Epilepsie – von der Antike bis in unsere Zeit
- 11. Begriffsklärung psychosozial
- 12. Situation der Familie
- 12.1 bei Erkrankung eines Kindes
- 12.2 bei Erkrankung der Mutter/des Vaters
- 13. Verhalten der sozialen Umwelt
- 14. Reaktion der Familie
- 15. Folgen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die psychosozialen Auswirkungen von Epilepsie auf Familien. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Herausforderungen und Belastungen für betroffene Familien zu zeichnen, sowohl im Falle der Erkrankung eines Kindes als auch eines Elternteils. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Erkrankung, von den medizinischen Grundlagen bis hin zu den sozialen und emotionalen Konsequenzen.
- Medizinische Grundlagen der Epilepsie
- Psychosoziale Belastung der Familienmitglieder
- Herausforderungen in der Erziehung und Bildung
- Soziale Integration und gesellschaftliche Wahrnehmung
- Unterstützungssysteme und Hilfsangebote
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriffsbestimmung Epilepsie: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition von Epilepsie und legt die Grundlage für das Verständnis der Erkrankung. Es klärt essentielle Begriffe und differenziert zwischen verschiedenen Anfallsformen, was für die spätere Analyse der psychosozialen Auswirkungen unerlässlich ist. Die klare Definition legt den Fokus auf die neurologische Perspektive als Ausgangspunkt für die Betrachtung der sozialen und familiären Folgen.
2. Das Nervensystem: Dieses Kapitel beschreibt die anatomischen und physiologischen Grundlagen des Nervensystems, um ein tieferes Verständnis der Funktionsweise des Gehirns und der Entstehung epileptischer Anfälle zu ermöglichen. Die detaillierte Darstellung dient als essentielle Grundlage zur Einordnung der späteren Kapitel, welche sich mit den psychosozialen Aspekten auseinandersetzen. Ein tiefgehendes Wissen über das Nervensystem ist erforderlich um die komplexen Zusammenhänge zwischen neurologischer Erkrankung und psychosozialen Folgen nachvollziehen zu können.
3. Aufgabenverteilung im Gehirn: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen Funktionen der Gehirnareale und deren Interaktionen. Das Verständnis der komplexen Aufgabenverteilung ist essenziell, um die vielfältigen Auswirkungen epileptischer Aktivität in verschiedenen Hirnregionen auf die Betroffenen und deren Familien zu verstehen. Es schafft die Verbindung zwischen der neurologischen Lokalisation von Anfällen und den daraus resultierenden kognitiven, emotionalen und Verhaltensproblemen.
4. Funktion der Nervenzellen: Hier wird die Funktionsweise von Nervenzellen und deren Kommunikation im Detail erläutert. Das Verständnis der neuronalen Prozesse ist grundlegend für das Verständnis der Pathophysiologie der Epilepsie. Dieses Kapitel bildet die Brücke zwischen der zellulären Ebene und den makroskopischen Auswirkungen der Erkrankung auf das Gehirn und den gesamten Organismus.
5. Die wichtigsten Anfallsformen: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Anfallsformen, sowohl fokale als auch generalisierte. Die differenzierte Darstellung verschiedener Anfalls-Typen ist wichtig, um die Bandbreite der möglichen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Familien zu verstehen. Die genaue Beschreibung der Anfalls-Symptome ermöglicht die spätere Analyse der damit verbundenen psychosozialen Herausforderungen.
6. Epilepsieformen: Dieses Kapitel klassifiziert die verschiedenen Epilepsieformen, darunter fokale, generalisierte und besondere Formen. Die umfassende Darstellung der verschiedenen Epilepsie-Typen ist wichtig, um die Heterogenität der Erkrankung und die damit verbundenen Variationen in den psychosozialen Auswirkungen zu verstehen. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Formen schafft eine Grundlage für die weitere Analyse der individuellen Herausforderungen betroffener Familien.
7. Diagnostik: Die Beschreibung diagnostischer Verfahren ermöglicht es, den Prozess der Feststellung von Epilepsie zu verstehen. Das Wissen über die diagnostischen Methoden ist entscheidend um die Qualität der Behandlung und die damit verbundene Lebensqualität zu beurteilen. Die Komplexität der Diagnostik wird erläutert um die Herausforderungen für betroffene Personen und Familien zu beleuchten.
8. Behandlung: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Behandlungsmethoden, von der Akutbehandlung bis hin zu operativen Eingriffen und ergänzenden Therapien. Die detaillierte Darstellung verschiedener Therapieansätze ist wesentlich, um den Einfluss der Behandlung auf die psychosoziale Situation der Familien zu bewerten. Der Erfolg der Behandlung und die damit verbundene Reduzierung der Anfallshäufigkeit wirken sich direkt auf die psychosoziale Situation der betroffenen Personen und ihrer Familien aus.
9. Folgen epileptischer Anfälle und Epilepsien für die Betroffenen: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen von Epilepsie auf das Leben der Betroffenen. Die beschriebenen Folgen bilden die Grundlage für das Verständnis der psychosozialen Herausforderungen. Die direkten Auswirkungen der Erkrankung auf das tägliche Leben werden präzise beschrieben.
10. Umgang mit der Epilepsie – von der Antike bis in unsere Zeit: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über den Umgang mit Epilepsie. Der historische Kontext ermöglicht ein besseres Verständnis der gesellschaftlichen Wahrnehmung und der damit verbundenen Stigmatisierung. Der Wandel in der Wahrnehmung der Erkrankung über die Zeit wird detailliert dargestellt.
11. Begriffsklärung psychosozial: Dieses Kapitel klärt den Begriff "psychosozial" und legt die Grundlage für die Analyse der psychosozialen Auswirkungen der Epilepsie. Die präzise Definition des Begriffs ist essenziell für die weitere Analyse der gesamten Arbeit.
12. Situation der Familie: Dieses Kapitel beschreibt die Situation von Familien mit einem Kind oder Elternteil mit Epilepsie. Die detaillierte Darstellung der familiären Herausforderungen zeigt die komplexen Interaktionen und Belastungen innerhalb der Familie. Die detaillierten Beispiele veranschaulichen die vielschichtigen Probleme und Herausforderungen.
13. Verhalten der sozialen Umwelt: Dieses Kapitel untersucht das Verhalten der sozialen Umwelt gegenüber Betroffenen und ihren Familien. Die beschriebenen Reaktionen und Verhaltensweisen verdeutlichen die gesellschaftlichen Herausforderungen und Stigmatisierungen.
14. Reaktion der Familie: Dieses Kapitel analysiert die Reaktionen der Familie auf die Erkrankung. Die verschiedenen Reaktionen und Bewältigungsstrategien werden im Detail dargestellt.
Schlüsselwörter
Epilepsie, psychosoziale Auswirkungen, Familie, Anfallsformen, Diagnostik, Behandlung, Antiepileptika, Lebensqualität, soziale Integration, Stigmatisierung, Kindheit, Elternschaft, Belastung, Hilfsangebote.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychosoziale Auswirkungen von Epilepsie auf Familien
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht umfassend die psychosozialen Auswirkungen von Epilepsie auf Familien. Sie beinhaltet eine detaillierte Darstellung der medizinischen Grundlagen der Epilepsie, gefolgt von einer eingehenden Analyse der Herausforderungen und Belastungen für Familien, deren Kind oder Elternteil an Epilepsie erkrankt ist. Die Arbeit beleuchtet medizinische Aspekte wie Anfallsformen, Diagnostik und Behandlung, setzt diese aber in den Kontext der sozialen und emotionalen Konsequenzen für Betroffene und deren Angehörige.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die medizinischen Grundlagen der Epilepsie (Nervensystem, Gehirnfunktionen, Nervenzellfunktion, Anfallsformen, Epilepsieformen, Diagnostik und Behandlung), sowie die psychosozialen Aspekte (Belastung der Familienmitglieder, Herausforderungen in Erziehung und Bildung, soziale Integration, gesellschaftliche Wahrnehmung, Unterstützungssysteme, historische Entwicklung des Umgangs mit Epilepsie, familiäre Reaktionen und das Verhalten der sozialen Umwelt).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in 15 Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Begriffsbestimmung der Epilepsie und einer Erläuterung des Nervensystems. Es folgen Kapitel zu den Aufgaben des Gehirns, der Nervenzellfunktion, den Anfallsformen und Epilepsieformen. Die Diagnostik und Behandlung der Epilepsie werden ausführlich beschrieben. Die zweite Hälfte konzentriert sich auf die psychosozialen Folgen der Erkrankung für Betroffene und ihre Familien, einschließlich der historischen Entwicklung des Umgangs mit der Krankheit, der familiären Situation, dem Verhalten der sozialen Umwelt und den daraus resultierenden Folgen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Herausforderungen und Belastungen für Familien zu zeichnen, die von der Epilepsie eines Kindes oder eines Elternteils betroffen sind. Sie möchte die verschiedenen Aspekte der Erkrankung beleuchten, um ein tieferes Verständnis für die komplexen Wechselwirkungen zwischen medizinischen, sozialen und emotionalen Faktoren zu schaffen.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Jedes Kapitel wird in der Arbeit einzeln zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen liefern einen Überblick über den Inhalt und die Bedeutung der einzelnen Kapitel im Kontext der gesamten Arbeit. Sie heben die wichtigsten Erkenntnisse und den Beitrag jedes Kapitels zum Gesamtverständnis der psychosozialen Auswirkungen von Epilepsie hervor.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Epilepsie, psychosoziale Auswirkungen, Familie, Anfallsformen, Diagnostik, Behandlung, Antiepileptika, Lebensqualität, soziale Integration, Stigmatisierung, Kindheit, Elternschaft, Belastung, Hilfsangebote.
Welche Arten von Epilepsie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Arten von Epilepsie, darunter fokale und generalisierte Anfälle sowie besondere Epilepsieformen und Syndrome. Die Klassifizierung der Epilepsieformen dient als Grundlage für die Analyse der individuellen Herausforderungen und Auswirkungen auf die Familien.
Wie wird die Behandlung von Epilepsie in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Behandlungsmethoden, einschließlich der Akutbehandlung, operativer Eingriffe und ergänzender Therapien. Der Fokus liegt auf der Bewertung des Einflusses der Behandlung auf die psychosoziale Situation der Familien.
Wie wird die gesellschaftliche Wahrnehmung von Epilepsie betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die gesellschaftliche Wahrnehmung von Epilepsie im historischen Kontext und analysiert die damit verbundenen Stigmatisierungen und Herausforderungen für Betroffene und ihre Familien. Sie untersucht das Verhalten der sozialen Umwelt und die Reaktionen der Familie auf die Erkrankung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zu den komplexen Wechselwirkungen zwischen den medizinischen Aspekten der Epilepsie und ihren psychosozialen Auswirkungen auf Familien. Sie unterstreicht die Notwendigkeit von Unterstützungssystemen und Hilfsangeboten für betroffene Familien.
- Quote paper
- Dipl-SozialPäd (FH) Regina Welter (Author), 2007, Epilepsie und die psychosozialen Auswirkungen für die Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150097