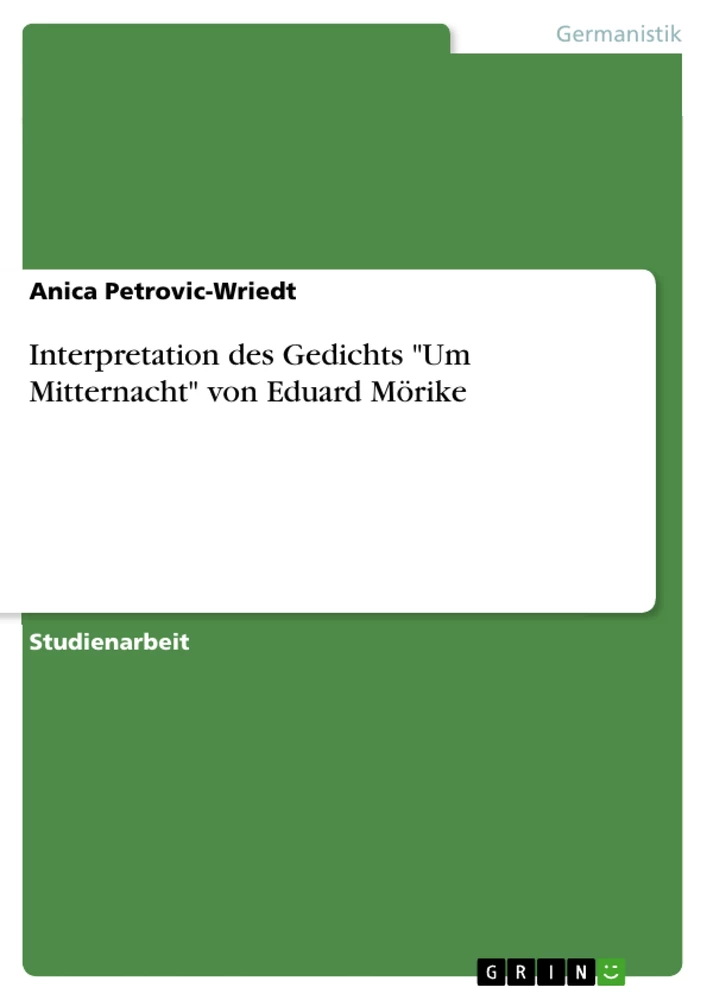In dieser Arbeit wird das Gedicht „Um Mitternacht“ von Eduard Mörike (1804 – 1875) interpretiert. Das Gedicht entstand 1827 und fällt daher in die Zeit der Spätromantik, des Biedermeier und auch in die Zeit des beginnenden Symbolismus.
Bereits der optische Eindruck des Gedichtes ist ungewöhnlich, da es sich in der Aufteilung der zwei Strophen nicht um die konventionelle Schreibweise, sondern um eine abweichende, in der bestimmte Verse eingerückt sind, handelt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Untersuchung des Inhalts
- 1. Struktur: äußerer Aufbau
- a. Strophenaufbau
- b. Gedichtsform
- c. Reim
- d. Rhythmus und Versmaß
- 2. Titel
- 3. Inhaltlicher Aufbau
- 4. Lyrisches Ich und Gegenstand der Betrachtung
- 5. Zentrale Aussage
- 1. Struktur: äußerer Aufbau
- III. Bildlichkeit
- IV. außertextliche Bezüge
- 1. Biographisches
- 2. zeitliche Einordnung
- 3. Anknüpfungspunkte und Vorbilder Mörikes
- V. Mythologischer Hintergrund
- VI. Der astronomisch-geophysikalische Vorgang
- VII. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Eduard Mörikes Gedicht "Um Mitternacht" (1827), welches in die Spätromantik, das Biedermeier und den beginnenden Symbolismus fällt. Die Analyse fokussiert auf die Form und den Inhalt des Gedichts, um dessen zentrale Aussage zu ergründen. Es wird untersucht, wie formale Elemente wie Strophenaufbau, Reim und Rhythmus die Bedeutung des Gedichts beeinflussen.
- Formale Gestaltungselemente und ihre Wirkung auf den Inhalt
- Die Darstellung von Zeit und Natur in dem Gedicht
- Das lyrische Ich und seine Perspektive
- Die mehrdeutige Interpretation des Titels "Um Mitternacht"
- Bezüge zu literarischen und historischen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt das Gedicht "Um Mitternacht" von Eduard Mörike vor und benennt den zeitgeschichtlichen Kontext (Spätromantik, Biedermeier, beginnender Symbolismus). Sie erwähnt den ungewöhnlichen optischen Aufbau des Gedichts und deutet bereits auf zentrale Aspekte wie die friedvolle Naturbeschreibung und die Bedeutung des Zeitfaktors hin. Die Einleitung bereitet den Leser auf die detaillierte Analyse des Gedichts vor, die in den folgenden Kapiteln erfolgen wird.
II. Untersuchung des Inhalts: Dieses Kapitel analysiert die Struktur des Gedichts, beginnend mit dem äußeren Aufbau. Es beschreibt den Strophenaufbau als zweistrophiges Gedicht mit jeweils acht Versen, wobei die zweite Hälfte jeder Strophe eingerückt ist und einen refrainartig wirkenden Charakter aufweist. Die Gedichtsform wird als wellenartig oder zackenartig beschrieben, wobei die Symmetrie der beiden Strophen hervorgehoben wird. Der Paarreim wird als klassisch bezeichnet, mit einer Variation in den Zeilen sieben und acht bzw. fünfzehn und sechzehn. Der freie Rhythmus wird im Detail erläutert, wobei der Wechsel zwischen vierhebigem und fünfhebigem Jambus und dem "hüpfenden Dreitakt" als stilistisches Mittel zur Darstellung des langsamen Verlaufs der Nacht und des schnellen Gemurmels der Quellen interpretiert wird.
III. Bildlichkeit: [An dieser Stelle müsste eine Zusammenfassung des Kapitels "Bildlichkeit" eingefügt werden. Da der bereitgestellte Text dieses Kapitel nicht enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
IV. außertextliche Bezüge: [An dieser Stelle müsste eine Zusammenfassung des Kapitels "außertextliche Bezüge" eingefügt werden. Da der bereitgestellte Text dieses Kapitel nicht vollständig enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden. Die vorhandenen Informationen zu biografischem Kontext, zeitlicher Einordnung und Vorbildern müssten durch den fehlenden Text vervollständigt werden.]
V. Mythologischer Hintergrund: [An dieser Stelle müsste eine Zusammenfassung des Kapitels "Mythologischer Hintergrund" eingefügt werden. Da der bereitgestellte Text dieses Kapitel nicht enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
VI. Der astronomisch-geophysikalische Vorgang: [An dieser Stelle müsste eine Zusammenfassung des Kapitels "Der astronomisch-geophysikalische Vorgang" eingefügt werden. Da der bereitgestellte Text dieses Kapitel nicht enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
Schlüsselwörter
Eduard Mörike, Um Mitternacht, Lyrikanalyse, Spätromantik, Biedermeier, Symbolismus, Strophenaufbau, Reim, Rhythmus, Zeit, Natur, lyrisches Ich, Gedichtinterpretation, Form und Inhalt.
Häufig gestellte Fragen zur Lyrikanalyse von Eduard Mörikes "Um Mitternacht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Gedicht "Um Mitternacht" von Eduard Mörike (1827), welches der Spätromantik, dem Biedermeier und dem beginnenden Symbolismus zugeordnet wird. Der Fokus liegt auf der Analyse von Form und Inhalt des Gedichts, um dessen zentrale Aussage zu ergründen und den Einfluss formaler Elemente wie Strophenaufbau, Reim und Rhythmus auf die Bedeutung zu untersuchen.
Welche Aspekte werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse umfasst folgende Aspekte: formale Gestaltungselemente und ihre Wirkung auf den Inhalt, die Darstellung von Zeit und Natur im Gedicht, das lyrische Ich und seine Perspektive, die mehrdeutige Interpretation des Titels "Um Mitternacht" sowie Bezüge zu literarischen und historischen Kontexten. Die Analyse beinhaltet eine detaillierte Untersuchung des äußeren Aufbaus (Strophenaufbau, Reimschema, Rhythmus und Metrum), des inhaltlichen Aufbaus, der Bildlichkeit, außertextlicher Bezüge (biografisch, zeitgeschichtlich, literarische Vorbilder), des mythologischen Hintergrunds und des astronomisch-geophysikalischen Vorgangs im Gedicht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die das Gedicht und seinen Kontext vorstellt; ein Kapitel zur Inhaltsuntersuchung (Struktur, Titel, inhaltlicher Aufbau, lyrisches Ich, zentrale Aussage); Kapitel zu Bildlichkeit, außertextlichen Bezügen (biografische, zeitliche und literarische), zum mythologischen Hintergrund und zum astronomisch-geophysikalischen Vorgang; sowie eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Liste der Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird im Text angeboten?
Die Zusammenfassung der Einleitung beschreibt das Gedicht und seinen Kontext (Spätromantik, Biedermeier, beginnender Symbolismus). Die Zusammenfassung des Kapitels "Untersuchung des Inhalts" beschreibt den äußeren Aufbau (zweistrophiges Gedicht mit je acht Versen, eingerückte zweite Hälfte, Paarreim mit Variationen, freier Rhythmus). Die Kapitel "Bildlichkeit", "außertextliche Bezüge", "Mythologischer Hintergrund" und "Der astronomisch-geophysikalische Vorgang" werden lediglich mit Platzhaltern versehen, da der bereitgestellte Text keine Informationen zu diesen Kapiteln enthält.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Eduard Mörike, Um Mitternacht, Lyrikanalyse, Spätromantik, Biedermeier, Symbolismus, Strophenaufbau, Reim, Rhythmus, Zeit, Natur, lyrisches Ich, Gedichtinterpretation, Form und Inhalt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die zentrale Aussage von Mörikes Gedicht "Um Mitternacht" durch eine detaillierte Analyse von Form und Inhalt zu ergründen. Dabei wird der Einfluss formaler Elemente auf die Bedeutung des Gedichts untersucht.
- Citar trabajo
- Anica Petrovic-Wriedt (Autor), 2006, Interpretation des Gedichts "Um Mitternacht" von Eduard Mörike, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150140