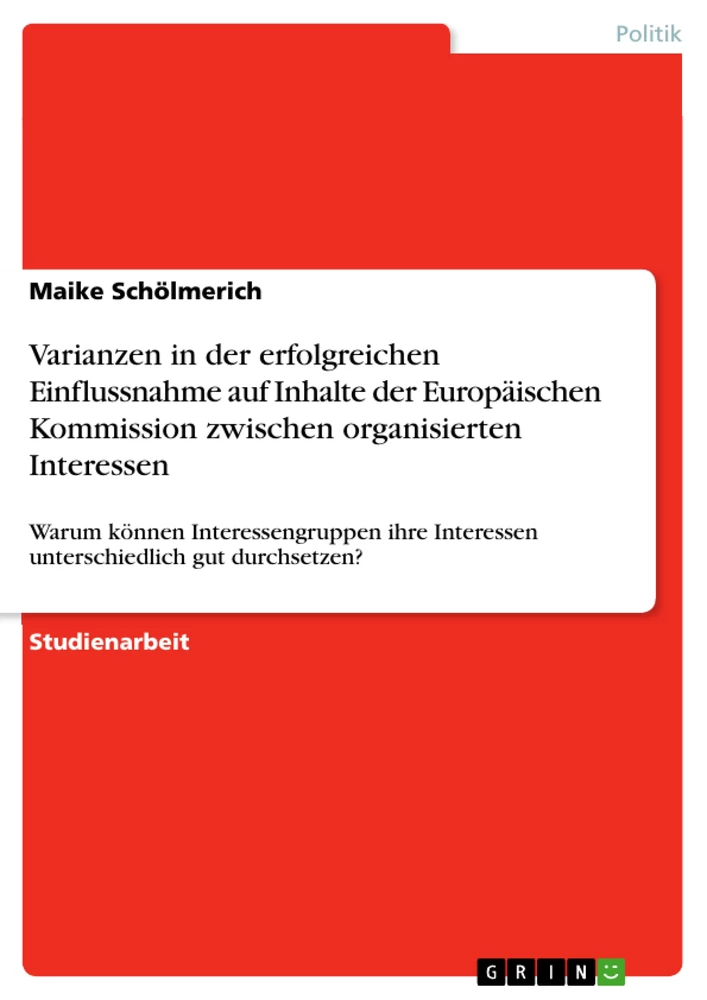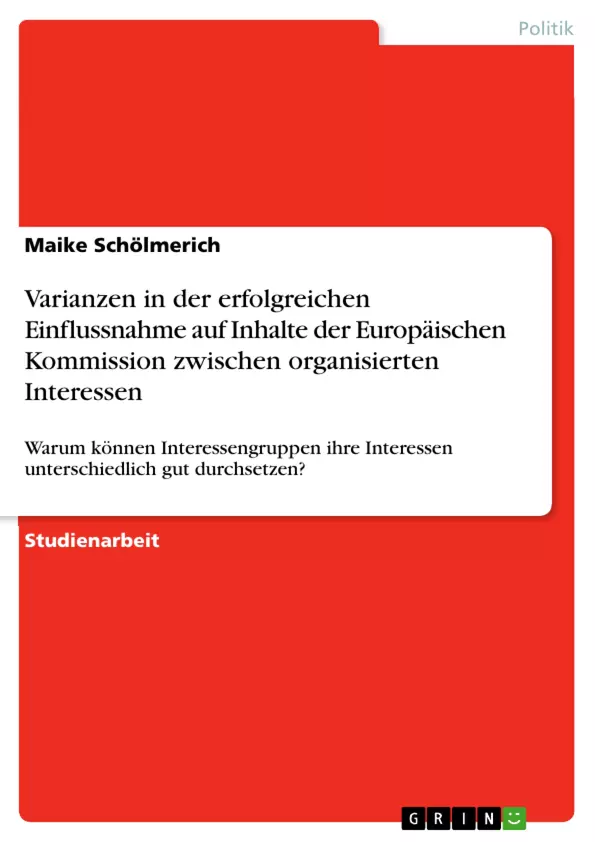[...] Deswegen soll in der folgenden Arbeit ein Raster über die Untersuchung gelegt werden, welches die Analyse über die Systemstrukturen einzelner Länder hinwegsetzt. Das heißt, die Vergleiche müssen zwischen „Transeuropäischen“ Organisationen gezogen werden, um Verzerrungen aufgrund der unterschiedlichen Systeme zu vermeiden. Dies hat zur Folge, dass es nicht die unterschiedlichen Systeme der Länder sind, die die Varianz des Einflusses erklären, sondern es andere Gründe geben muss, die über die Länder hinweg existieren. Denn auffällig ist, dass auch über die einzelnen Länder hinweg eine ausgeprägte Varianz in der Einflussnahme von organisierten Interessen auf die Europäische Kommission herrscht. Die konkrete Fragestellung lautet also: Wie ist der unterschiedliche Einfluss von Interessengruppen auf die Europäische Kommission über die Länder hinweg zu erklären und zu beurtei-len? Hierbei ist die abhängige Variable der Untersuchung der Einfluss der Interessengruppen auf die Europäische Kommission über unterschiedliche Länder hinweg.
Im Folgenden sollen zunächst unabhängige Variablen gefunden werden, die zur Erklärung der Varianz hilfreich sein könnten. Hierbei werde ich mich auf zwei Theorien stützen, aus denen ich im Weiteren zwei Hypothesen ableiten kann. Nachdem die Hypothesen erläutert, der Kausalmechanismus nachvollzogen und die Variablen operationalisiert sind, geht die Arbeit in einen empirischen Teil über. Hier wird überprüft, ob die unabhängigen Variablen sinnvoll gewählt sind, und – wenn ersteres bejaht werden kann – welche Hypothese die Unterschiede in der erfolgreichen Einflussnahme von organisierten Interessen auf die Europäische Kommission besser erklären kann. Dieser empirische Teil wird in die Studie eines Fallbeispiels übergehen, in dem die Hypothesen im Speziellen anhand einer bestimmten Interessengruppe nachgezeichnet und überprüft werden.
Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab, indem die Arbeit noch einmal knapp zusammengefasst wird, und somit der Bogen zur einleitenden Fragestellung geschlossen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zwei Hypothesen zur Erklärung von Varianzen zwischen organisierten Interessen bei der erfolgreichen Einflussnahme auf Inhalte der Europäischen Kommission.
- 2.1 Zwei ausgewählte Theorien zur Untermauerung der Hypothesen
- 2.1.1 Die „Resource Dependence Theory“
- 2.1.2 Die „Interdependenztheorie der Gewalten“
- 2.2 Zwei konkurrierende Hypothesen
- 2.2.1 Die erste Hypothese, ihr Kausalmechanismus und die Operationalisierung der ersten unabhängigen Variable.
- 2.2.1.1 Die erste Hypothese und ihr Kausalmechanismus
- 2.2.1.2 Die Operationalisierung der ersten unabhängigen Variable
- 2.2.2 Die zweite Hypothese, ihr Kausalmechanismus und die Operationalisierung der zweiten unabhängigen Variable.
- 2.2.2.1 Die zweite Hypothese und ihr Kausalmechanismus
- 2.2.2.2 Die Operationalisierung der zweiten unabhängigen Variable
- 2.2.3 Zwischenfazit
- 3. Die empirische Überprüfung der Hypothesen allgemein und anhand eines Fallbeispiels
- 3.1 Allgemeine empirische Untersuchung der Hypothesen zur Erklärung von Varianzen in der erfolgreichen Einflussnahme von Interessengruppen auf die Europäische Kommission.
- 3.2 Empirische Einzelfallstudie anhand der Konsultation zur Zukunft der Verfahrensweise im Verlagswesen: Die European Blind Union.
- 3.2.1 Die „,Consultation on future policy orientations for publishing“ (CPOP)
- 3.2.2 Die Interessengruppe \"European Blind Union\" als mitwirkender Akteur der Konsultation.
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich der unterschiedliche Einfluss von Interessengruppen auf die Europäische Kommission über die Länder hinweg erklären lässt. Im Fokus steht dabei die erfolgreiche Einflussnahme von Interessengruppen auf Inhalte der Europäischen Kommission. Die Arbeit untersucht die Varianzen in der Einflussnahme, indem sie zwei konkurrierende Hypothesen entwickelt und empirisch überprüft.
- Die „Resource Dependence Theory“ und die „Interdependenztheorie der Gewalten“ bilden die Grundlage für die Hypothesen.
- Die Arbeit analysiert den Einfluss von Interessengruppen auf die Europäische Kommission über verschiedene Länder hinweg, um systembedingte Verzerrungen zu vermeiden.
- Es werden zwei konkurrierende Hypothesen entwickelt, die die Unterschiede in der erfolgreichen Einflussnahme von organisierten Interessen erklären sollen.
- Die Hypothesen werden anhand eines Fallbeispiels, der „Consultation on future policy orientations for publishing“ (CPOP), und der Interessengruppe „European Blind Union“ empirisch überprüft.
- Die Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis der komplexen Prozesse der Interessenvertretung in der Europäischen Union leisten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Varianz in der Einflussnahme von Interessengruppen auf die Europäische Kommission dar und definiert die Fragestellung der Arbeit. Kapitel 2 entwickelt zwei konkurrierende Hypothesen zur Erklärung dieser Varianz, die auf den Theorien „Resource Dependence Theory“ und „Interdependenztheorie der Gewalten“ basieren. Es werden die Kausalmechanismen der Hypothesen erläutert und die unabhängigen Variablen operationalisiert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der empirischen Überprüfung der Hypothesen. Zunächst wird eine allgemeine empirische Untersuchung durchgeführt, anschließend wird ein Fallbeispiel, die „Consultation on future policy orientations for publishing“ (CPOP), und die Interessengruppe „European Blind Union“ analysiert. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beantwortet die einleitende Fragestellung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lobbyismus, Interessenvertretung, Europäische Kommission, Einflussnahme, Varianz, „Resource Dependence Theory“, „Interdependenztheorie der Gewalten“, empirische Untersuchung, Fallbeispiel, „Consultation on future policy orientations for publishing“ (CPOP), „European Blind Union“.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Interessengruppen die Europäische Kommission?
Die Arbeit untersucht die Varianz in der Einflussnahme und erklärt diese durch Theorien wie die „Resource Dependence Theory“ und die „Interdependenztheorie der Gewalten“.
Was ist die „Resource Dependence Theory“?
Diese Theorie besagt, dass der Einfluss einer Gruppe davon abhängt, welche Ressourcen (Informationen, Expertise) sie der Kommission im Austausch für politischen Einfluss bieten kann.
Welches Fallbeispiel wird zur Analyse genutzt?
Die Arbeit analysiert die „Consultation on future policy orientations for publishing“ (CPOP) und die Rolle der „European Blind Union“ als Akteur.
Warum werden „Transeuropäische“ Organisationen verglichen?
Um Verzerrungen durch unterschiedliche nationale Systeme zu vermeiden und allgemeingültige Gründe für den Erfolg von Lobbyismus auf EU-Ebene zu finden.
Was ist das Ziel der empirischen Einzelfallstudie?
Sie dient dazu, die entwickelten Hypothesen in der Praxis zu überprüfen und nachzuvollziehen, warum bestimmte Gruppen erfolgreicher sind als andere.
- Quote paper
- Maike Schölmerich (Author), 2006, Varianzen in der erfolgreichen Einflussnahme auf Inhalte der Europäischen Kommission zwischen organisierten Interessen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150196