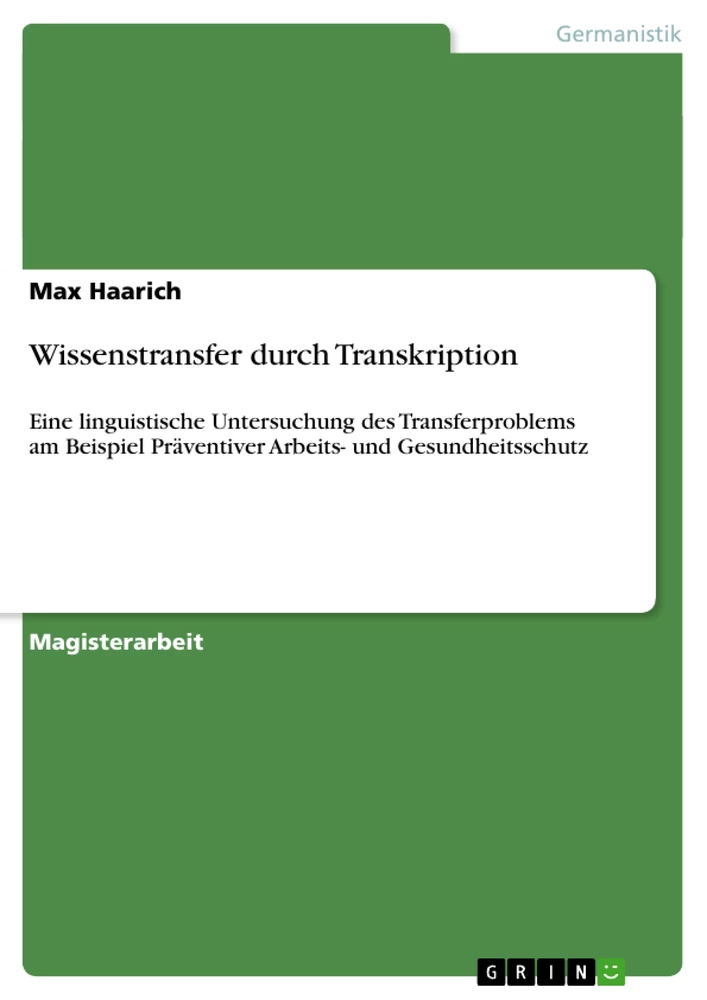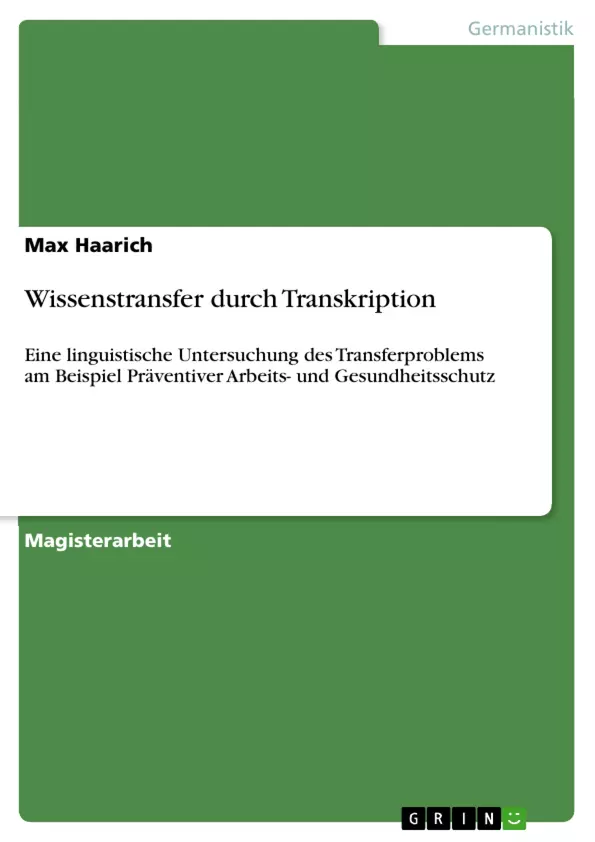In der vorliegenden Arbeit sollen ausgehend von einer konstruktivistischen Modellierung des Wissenstransfers Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Transferarbeit des Präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes formuliert werden. Die Verbesserung des Transfers realisiert sich dabei weniger über die Optimierung transferförderlicher Faktoren, als vielmehr über die Kompensierung transferhemmender Einflüsse, welche in der Linguistik unter dem Begriff des Transferproblems subsummiert werden.
Das Transferproblem erweist sich bei näherer Betrachtung als Komplexitätsproblem des zu transferierenden Wissens selbst. Im Zuge der Ausdifferenzierung des Wissens entwickeln sich modularisierte Wissensgebiete mit je eigenen Sprachspielen. Die mit der Komplexitätszunahme des Wissens sinkende Kompatibilität dieser Sprachspiele wirkt als Transferbarriere, die es zur Verbesserung des Wissenstransfers zu überwinden gilt. Unser Lösungsvorschlag ist die Reduktion der Komplexität, durch die Etablierung von Meta-Sprachspielen, über die jeweils zwischen zwei Wissensgebieten kommunikativ vermittelt und Wissen transferiert werden kann. Daher zielen die abschließenden Handlungsempfehlungen auf die effiziente und effektive
Bildung solcher Meta-Sprachspiele im Präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz ab. Die Strategie zur Erreichung dieses Ziels ist die frühzeitige Integration der Praxis in den Forschungsprozess, um langfristigen, intensiven, partnerschaftlichen und damit erfolgreichen Transfer von Wissen zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- 1. Das Transferproblem
- 1.1 Begründung der Auswahl des Anwendungsbeispiels Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz
- 1.2 Die spezifische Transferproblematik im Präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz
- 1.3 Die universelle Transferproblematik
- 1.4 Zusammenfassung
- 2. Theoretische Modellierung des Wissenstransfers
- 2.1 Die Theorie der Geschichten und Diskurse von Siegfried J. Schmidt
- 2.1.1 Überwindung kognitiver Autonomie in Geschichten und Diskursen
- 2.1.2 Die operative Fiktion
- 2.1.3 Die Rolle des Zeichens beim Aufbau des Wirklichkeitsmodells
- 2.2 Die semiologische Sprachidee
- 2.3 Die Transkriptionstheorie von Ludwig Jäger
- 2.3.1 Skriptur: Präskript vs. Transkript
- 2.3.2 Intramediale und intermediale Bezugnahme
- 2.3.3 Adressierung und Lesbarkeit
- 2.3.4 Attribuierung und Inszenierung von Sinn
- 2.3.5 Störung und Transparenz
- 2.3.6 Transfer vs. Aneignung von Wissen
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Theoretischer Lösungsweg
- 3.1 Sprachspiel – Wissen – Wirklichkeit
- 3.2 Das Erlernen von Sprachspielen
- 3.3 Integration des Rezipienten in die Wissensproduktion
- 3.4 Kompensierung der Dispersion des Wissens
- 3.5 Übersicht der theoretischen Lösungsvorschläge
- 4. Handlungsempfehlungen für den Präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Transferproblem im Kontext des Präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Ausgehend von einer konstruktivistischen Modellierung des Wissenstransfers werden Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Transferarbeit in diesem Bereich formuliert. Der Fokus liegt dabei auf der Kompensierung von transferhemmenden Einflüssen, die als Komplexitätsproblem des zu transferierenden Wissens betrachtet werden.
- Die Bedeutung von Sprachspielen für den Wissenstransfer
- Die Rolle der Transkriptionstheorie für die Modellierung von Wissenstransferprozessen
- Die Überwindung kognitiver Autonomie durch die gemeinsame Verwendung von Sprachzeichen
- Die Kompensierung von Transferbarrieren durch die Bildung von Meta-Sprachspielen
- Die Bedeutung der frühzeitigen Integration der Praxis in den Forschungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des Transferproblems im Kontext des Präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Kapitel 1 beleuchtet die spezifische Transferproblematik in diesem Bereich und stellt die Ursachen des Problems in den Kontext der universellen Transferproblematik dar. Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen des Wissenstransfers vor, die auf der Theorie der Geschichten und Diskurse von Siegfried J. Schmidt und der Transkriptionstheorie von Ludwig Jäger basieren. In Kapitel 3 werden die theoretischen Lösungsvorschläge für die Überwindung des Transferproblems entwickelt, wobei die Bedeutung gemeinsamer Sprachspiele für die Kommunikation zwischen verschiedenen Wissensgebieten im Vordergrund steht. Kapitel 4 bietet Handlungsempfehlungen für die Praxis des Präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die auf der Bildung von Meta-Sprachspielen durch die Integration der Praxis in den Forschungsprozess basieren. Die Zusammenfassung und der Ausblick runden die Arbeit ab.
Schlüsselwörter
Wissenstransfer, Transferproblem, Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz, Sprachspiele, Transkriptionstheorie, Geschichten und Diskurse, semiologischer Konstruktivismus, Komplexität, Literalisierung, Meta-Sprachspiele, Integration von Praxis und Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Transferproblem“ im Wissenstransfer?
Es handelt sich um ein Komplexitätsproblem, bei dem verschiedene Wissensgebiete eigene „Sprachspiele“ entwickeln, die untereinander oft inkompatibel sind und den Wissensaustausch behindern.
Welchen Lösungsansatz bietet die Arbeit für dieses Problem an?
Der Vorschlag ist die Bildung von „Meta-Sprachspielen“, die als kommunikative Vermittler zwischen verschiedenen Wissensgebieten fungieren und Komplexität reduzieren.
Welche Rolle spielt die Transkriptionstheorie von Ludwig Jäger?
Sie dient als theoretische Grundlage zur Modellierung von Transferprozessen, wobei zwischen Präskripten und Transkripten sowie intramedialen Bezügen unterschieden wird.
In welchem Anwendungsbereich wird der Wissenstransfer untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Warum ist die Integration der Praxis in den Forschungsprozess wichtig?
Eine frühzeitige Integration fördert einen intensiven, partnerschaftlichen Austausch und hilft dabei, Transferbarrieren bereits während der Wissensproduktion zu kompensieren.
Was versteht man unter „kognitiver Autonomie“ in diesem Kontext?
Es bezieht sich auf die Theorie von Siegfried J. Schmidt, nach der die Überwindung individueller Wissensgrenzen durch gemeinsame Geschichten und Diskurse ermöglicht wird.
- Quote paper
- Max Haarich (Author), 2010, Wissenstransfer durch Transkription, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150200