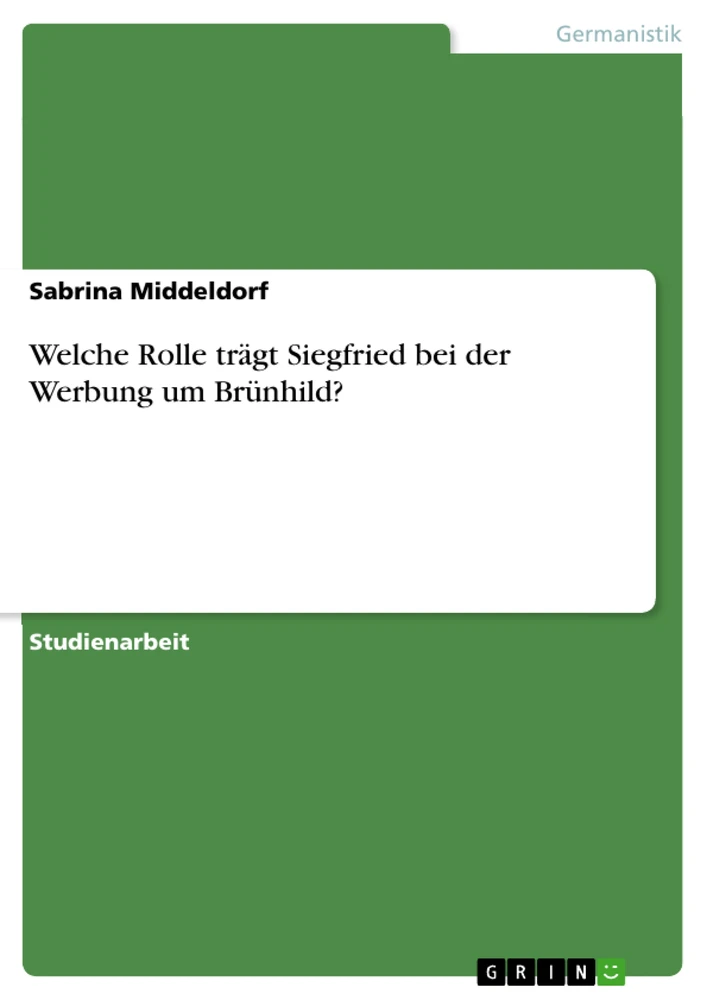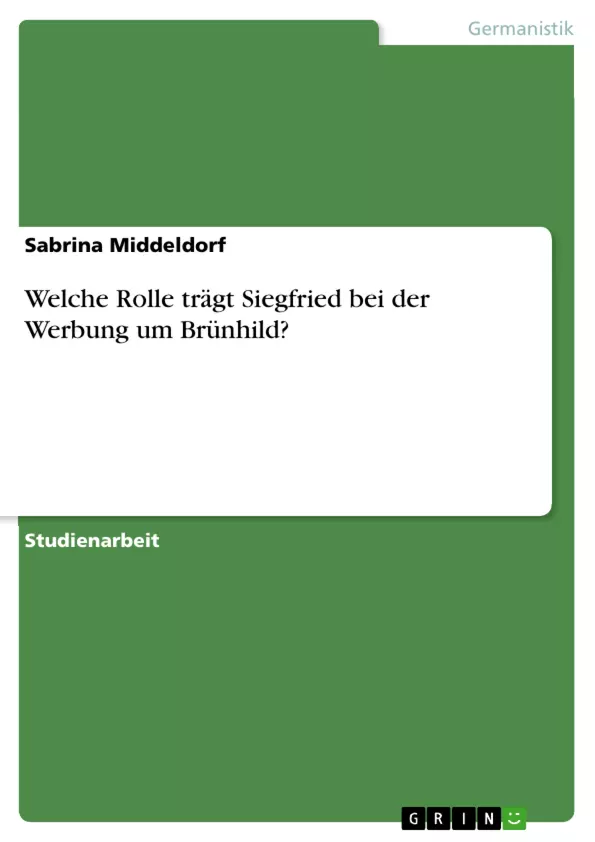Spricht man von dem um 1200 entstandenen Epos ´Das Nibelungenlied`, steht häufig die Frage nach den Gründen für den Untergang im Vordergrund. Daß diese Gründe sich schon im wiederholten Betrug von Siegfried und Gunther an Brünhild manifestieren, ist offensichtlich. Durch den Betrug bei den Wettkämpfen, wie den in der Hochzeitsnacht, bei dem beide Male Siegfried anstelle von Gunther agierte, wurde der Grundstein für eine Realität gelegt, die unwahr ist. Brünhild kennt eine Realität, in der Siegfried der Vasall Gunthers ist. Dies ist für Brünhild unabdingbar, da es durch Wort und Tat Siegfrieds bezeugt wird. In Kriemhilds Wahrheit ist Siegfried Gunther jedoch nicht nur ebenbürtig, sondern noch stärker, noch prächtiger, noch mutiger, da Siegfried es als Einziger vermag, Brünhild zu bezwingen. Auch wenn Siegfried dies Kriemhild gegenüber nicht äußert, so schenkt er ihr doch Brünhilds Ring und Brünhilds Gürtel. Diese Symbole Brünhilds Macht unterstreichen den Wahrheitsgehalt von Kriemhilds Realität. Aus diesen beiden Realitäten wird im weiteren Verlauf also ein Frauenzank ausbrechen, der fatale Folgen hat. Nämlich sowohl die Ermordung Siegfrieds, als auch den finalen Untergang nahezu aller Beteiligten. Es scheint als würde Siegfried dadurch „selbst zum Verursacher seines eigenen Todes“ . Denn sowohl der Stratordienst, als auch der Betrug bei den Wettkämpfen und in der Hochzeitsnacht, bauen unterschiedliche, von der Realität abweichende, Wahrheiten auf. Diese Wahrheiten werden einerseits ausformuliert durch schlichte Lügen, wie Gunther sî mîn herre, / und ich sî sin man (386), andererseits aber auch durch Taten und Symbole, wie den Raub von Brünhilds Ring und Gürtel, untermalt. Beide, Brünhild und Kriemhild, glauben demnach an für sie wahre Realitäten, da ihnen diese vorgespielt werden. Hierauf liegt der erste Schwerpunkt. Während damit zumindest ein Teil der Erklärung für den Untergang geliefert wurde, rückt vielmehr die Frage ins Zentrum, welche Rolle Siegfried bei Gunthers Brautwerbung spielt. Hierbei ist es einerseits interessant, Siegfrieds Gründe genauer zu untersuchen, andererseits aber auch die Brüche in der Erzählstruktur zu erkennen und zu deuten. In Folge dessen drängt sich vor allem die Frage nach der Beziehung zwischen Siegfried und Brünhild auf und der Einfluß anderer Sagenkreise auf eben dieses Verhältnis.
Der zweite Schwerpunkt liegt folglich auf der Beziehung zwischen Brünhild und Siegfried. Geht man von dem Einfluß verschiedener Sagenkreise
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II.1 Siegfrieds Hilfe bei der Werbung um Brünhild
- II.2 Siegfrieds Stratordienst
- II.3 Was wissen Siegfried und Brünhild wirklich voneinander?
- II.3.1 Brüche in der Erzählstruktur
- II.3.2 Erklärung für die Brüche
- III. Siegfried in der Rolle Brünhilds Meisters…
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Rolle Siegfrieds bei der Werbung um Brünhild im Nibelungenlied. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Siegfrieds Handeln zur Konstruktion unterschiedlicher Wahrheiten und zum Untergang der Helden beiträgt.
- Siegfrieds Motivation und Gründe für seine Unterstützung bei Gunthers Brautwerbung
- Die Brüche in der Erzählstruktur des Nibelungenliedes, die auf die Beziehung zwischen Siegfried und Brünhild hinweisen
- Der Einfluss anderer Sagenkreise auf die Darstellung der Beziehung zwischen Siegfried und Brünhild
- Die Rolle des Betrugs und der konstruierten Wahrheiten in der Beziehung zwischen Gunther, Siegfried und Brünhild
- Siegfrieds ambivalente Position als Vasall Gunthers und gleichzeitig als Meister Brünhilds
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung des Betrugs und der konstruierten Wahrheiten für den Untergang der Helden. Sie stellt die zentralen Fragen der Arbeit dar, insbesondere Siegfrieds Rolle bei Gunthers Brautwerbung und die Beziehung zwischen Siegfried und Brünhild.
Kapitel II.1 untersucht Siegfrieds Hilfe bei Gunthers Brautwerbung und beleuchtet die Motivationen hinter seinem Handeln. Die Analyse zeigt, wie Siegfrieds Minnedienst zu Kriemhild ihn in eine verhängnisvolle Rolle beim Betrug Brünhilds verwickelt.
Kapitel II.2 fokussiert sich auf Siegfrieds Stratordienst als Teil seines Minnedienstes. Die Analyse zeigt, wie Siegfried sich durch seine Handlungen in eine untergeordnete Rolle gegenüber Gunther degradiert, um Brünhilds Aufmerksamkeit von seiner eigenen Person abzulenken.
Kapitel II.3 analysiert die Brüche in der Erzählstruktur des Nibelungenliedes, die auf die Beziehung zwischen Siegfried und Brünhild hinweisen. Die Analyse stellt die Frage, ob Brünhild in Siegfried ihren Meister gefunden hat und ob die Brüche in der Erzählstruktur die Beziehung zwischen den beiden Helden deuten.
Kapitel III beleuchtet Siegfrieds Position als Meister Brünhilds. Es wird untersucht, wie Siegfrieds ambivalente Rolle als Vasall Gunthers und gleichzeitig als Meister Brünhilds zu Konflikten und letztendlich zum Untergang führt.
Schlüsselwörter
Das Nibelungenlied, Siegfried, Brünhild, Gunther, Kriemhild, Brautwerbung, Betrug, Minne, Stratordienst, Brüche in der Erzählstruktur, Sagenkreise, Wahrheit, Untergang der Helden, ambivalente Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Siegfried bei der Werbung um Brünhild?
Siegfried agiert als Gunthers Helfer und täuscht Brünhild vor, Gunthers Vasall zu sein, um diesem zu helfen, die sportlichen Wettkämpfe und die Hochzeitsnacht gegen sie zu gewinnen.
Was ist der „Stratordienst“ Siegfrieds?
Siegfried übernimmt symbolische Vasallendienste (wie das Halten des Steigbügels), um Brünhild in dem Glauben zu lassen, er sei Gunther untergeordnet, was Teil des großen Betrugs ist.
Warum führt der Betrug an Brünhild zum Untergang der Helden?
Durch den Betrug entstehen zwei unvereinbare Wahrheiten. Als Kriemhild Brünhild offenbart, dass Siegfried sie bezwungen hat, bricht ein Frauenzank aus, der in Siegfrieds Ermordung und dem Untergang der Burgunden endet.
Welche Bedeutung haben Ring und Gürtel im Nibelungenlied?
Siegfried raubt Brünhild in der Hochzeitsnacht Ring und Gürtel – Symbole ihrer Macht und Jungfräulichkeit – und schenkt sie Kriemhild, was später als Beweis für den Betrug dient.
Wussten Siegfried und Brünhild bereits vor der Brautwerbung voneinander?
Die Arbeit analysiert Brüche in der Erzählstruktur, die darauf hindeuten, dass zwischen Siegfried und Brünhild eine frühere Beziehung bestanden haben könnte, was in anderen Sagenkreisen deutlicher ausgeführt wird.
Ist Siegfried selbst Verursacher seines Todes?
Ja, die Analyse legt nahe, dass Siegfried durch seine Lügen und den Raub der Symbole den Grundstein für die tödlichen Konflikte selbst gelegt hat.
- Quote paper
- Sabrina Middeldorf (Author), 2007, Welche Rolle trägt Siegfried bei der Werbung um Brünhild?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150209