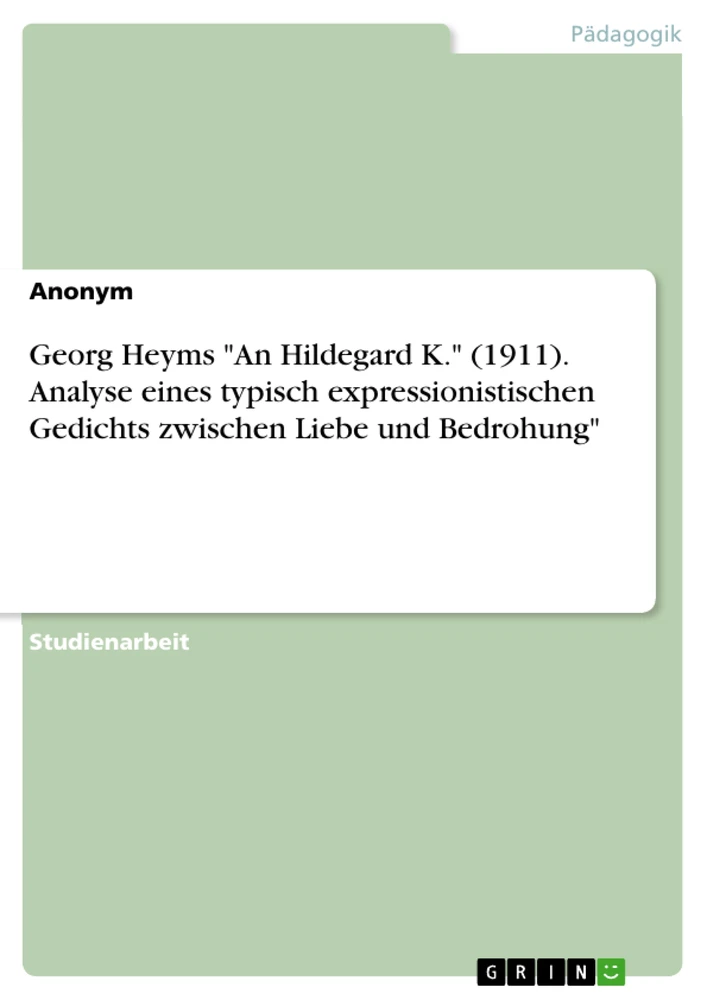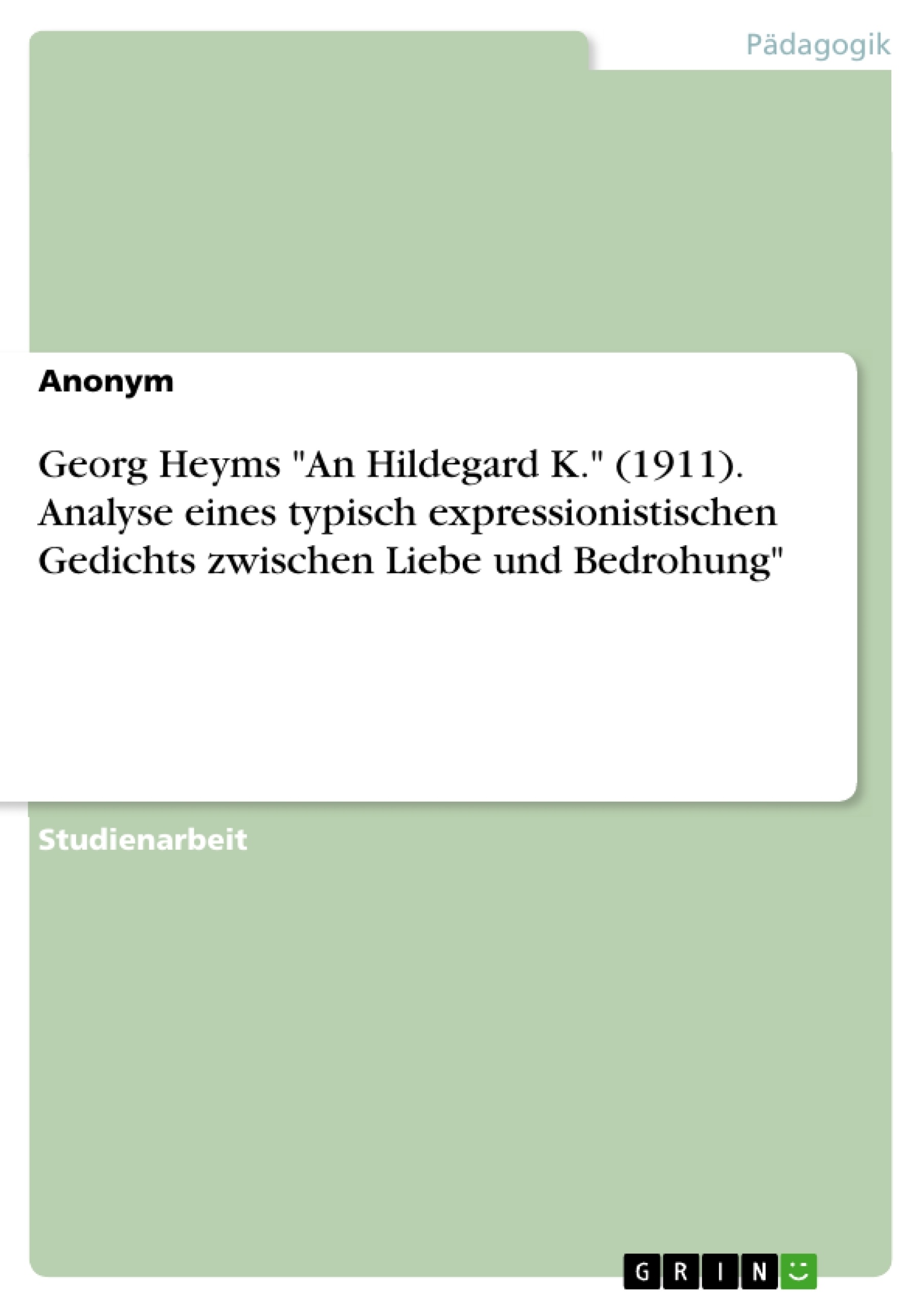Im Vordergrund vieler expressionistischer Gedichte stehen, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, die Auswirkungen der historisch- technischen Entwicklungen Anfang des 20. Jahrhunderts. Eines der Hauptmotive vor dem ersten Weltkrieg ist die Verstädterung mitsamt ihren Auswirkungen auf das Individuum, wie die Anonymisierung und Reizüberflutung. Häufig wird durch die bildhafte Sprache das Abstoßende und Bedrohliche thematisiert.
Trotz dieser nicht genau definierten Bedrohung fällt das Gedicht „An Hildegard K.“ (1911) von Georg Heym durch seine Vielzahl an harmonischen Naturdarstellungen und durch das zentrale Motiv der Liebe auf. Die folgende Sachanalyse soll herausarbeiten,
wie diese unterschiedlichen Thematiken miteinander wechselwirken und schließlich, inwiefern es sich bei dem Gedicht „An Hildegard K.“ um ein typisch expressionistisches Gedicht handelt. Dabei sollen Übereinstimmungen mit den charakteristischen Merkmalen herausgearbeitet werden, aber auch Abweichungen stilistischer oder inhaltlicher Art.
In der folgenden didaktischen Analyse soll erklärt werden, warum die Bearbeitung des Gedichtes wertvoll für den Literaturunterricht ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Schlüsselbegriffe und Ereignisse des Frühexpressionismus
- Textanalyse im Hinblick auf Forschungsfrage
- Fazit
- Lehrplanverortung
- Was wird unterrichtet?
- Warum wird der Gegenstand unterrichtet?
- Welche schülerInnenspezifischen Kontexte sind beim Unterrichten wie zu beachten?
- Exemplarischer Unterrichtsteil
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Georg Heyms Gedicht „An Hildegard K.“ aus dem Jahr 1911 im Kontext des Expressionismus. Das Ziel ist es, herauszufinden, inwiefern sich das Gedicht als typisch expressionistisch charakterisieren lässt. Dazu wird zunächst der Forschungsstand zum Gedicht beleuchtet, bevor wichtige Schlüsselbegriffe und Ereignisse des Frühexpressionismus erörtert werden. Im Anschluss daran wird das Gedicht analysiert, wobei sowohl auf inhaltliche als auch stilistische Merkmale eingegangen wird. Abschließend wird die Forschungsfrage im Fazit beantwortet.
- Charakterisierung des Gedichts „An Hildegard K.“ im Kontext des Expressionismus
- Analyse der Wechselwirkung von Liebe und Naturdarstellung im Gedicht
- Beurteilung von „An Hildegard K.“ als typisches expressionistisches Gedicht
- Einbezug von Heyms Lebensumständen und -gefühlen in die Interpretation
- Überprüfung von Übereinstimmungen und Abweichungen des Gedichts von typischen Merkmalen des Expressionismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der typischen expressionistischen Qualität des Gedichts „An Hildegard K.“ von Georg Heym. Die Arbeit beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen verschiedener Thematiken im Gedicht und der Abgrenzung zu typischen Merkmalen des Expressionismus.
Forschungsstand
Dieses Kapitel erläutert, wie Heyms Lebensumstände und die Beziehung zu Hildegard Krohn seine Gefühlswelt und die Interpretation des Gedichts beeinflussen. Es werden zudem die Grundzüge von Heyms Lyrik im Vergleich zu anderen expressionistischen Autoren beleuchtet.
Schlüsselbegriffe und Ereignisse des Frühexpressionismus
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Frühexpressionismus, seine charakteristischen Merkmale und die Abgrenzung zu den Werten und Ästhetiken des „Alten“. Es werden wichtige Schlüsselbegriffe und Ereignisse beleuchtet, die für die Analyse des Gedichts relevant sind.
Schlüsselwörter
Expressionismus, Georg Heym, „An Hildegard K.“ (1911), Frühexpressionismus, Liebe, Naturdarstellung, Ästhetik des Hässlichen, Subjektivität, Gefühlswelt, Zeitgeist, Stilmerkmale, Textanalyse.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Georg Heyms "An Hildegard K." (1911). Analyse eines typisch expressionistischen Gedichts zwischen Liebe und Bedrohung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1502770