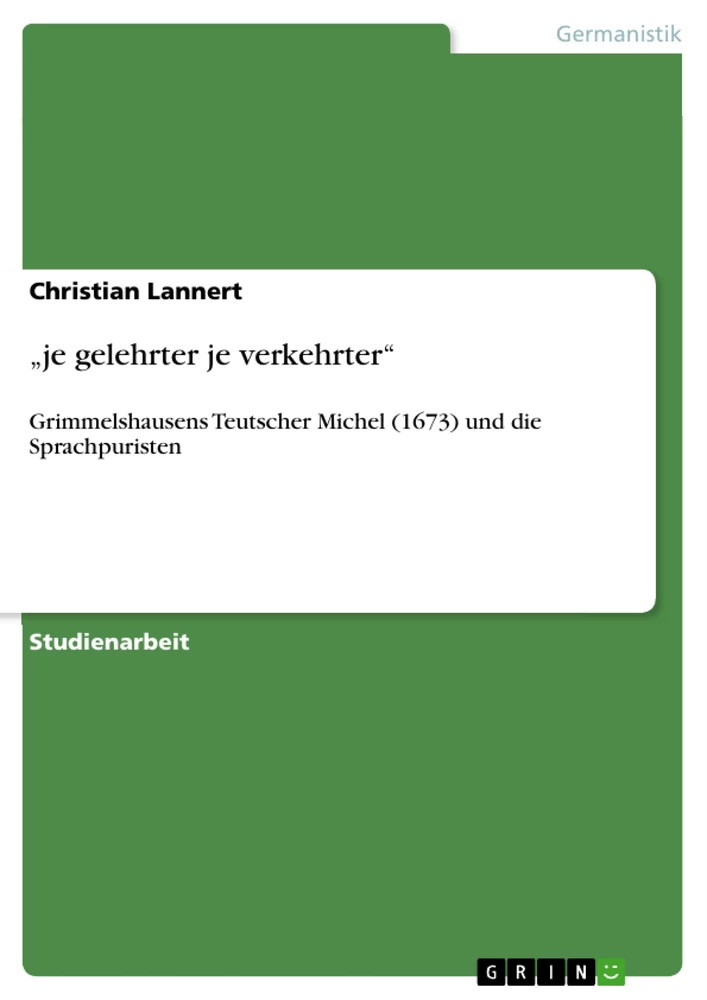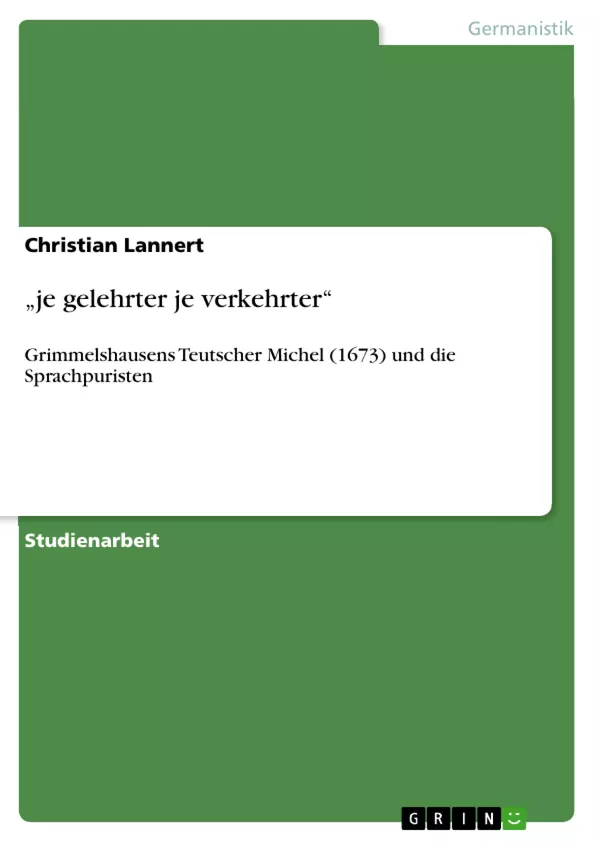Vorliegende Arbeit widmet sich der Kritik Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausens (um 1622-1676) an den Sprachpuristen des 17. Jahrhunderts. Kernaspekte seiner Argumentation sollen anhand seines Traktats vom Teutschen Michel (1673) veranschaulicht und vor dem Hintergrund der sprachpraktischen und sprachphilosophischen Überlegungen der Zeit diskutiert werden. Natürlich kann auf dem hier zur Verfügung stehenden Platz weder Grimmelshausens Werk, noch das Spektrum des Sprachpurismus erschöpfend behandelt werden, weshalb sich die folgende Untersuchung auf die Capites IV. und V. des Traktats konzentriert. Diese Einschränkung ist aus zwei Gründen sinnvoll: Zum einen zeigen sie exemplarisch die sittlich-ethische, gleichzeitig aber pragmatische Sprachkritik, die Grimmelshausen auszeichnet. Zum anderen entwickelt er seine Argumentation hauptsächlich aus der Auseinandersetzung mit einem berühmt-berüchtigten Sprachpuristen, nämlich Philipp von Zesen (1619-1689), der hier somit als „Hauptgegner“ des Autors gelten kann.
Zwar nimmt Zesen wegen seines rigides Purismus eine Sonderstellung unter den Sprachpuristen ein, aber gerade weil deren Ziele bei ihm ins Extreme gesteigert sind, bietet er dem Satiriker Grimmelshausen die größte Angriffsfläche. An ihm kann er sein purismuskritisches Raisonnement in anschaulicher Bearbeitung voll entfalten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Alamode-Sprache und Alamode-Kritik als Probleme der Zeit
- II. 1. Alamode-Sprache
- II. 2. Sprachpuristen und Sprachgesellschaften
- II. 3. Grimmelshausen und die gelehrten Diskurse seiner Zeit
- III. Grimmelshausen Traktat vom Teutschen Michel (1673)
- III. 1. Entstehung und Komposition
- III. 2. „Lustig zu lesen, aber ernst gemeint.“ Gehalt und Anliegen
- III. 3. Quellenbezüge
- IV. Aspekte der Purismuskritik im Teutschen Michel
- IV. 1. Caput IV: „Noch von einer anderen Art Sprach-Verbesserer/oder wahrhaffter zu reden/ Teutsch-Verderber“
- IV. 2. Interpretation: Sprache als Instrument des Heils
- IV. 3. Caput V: „Daß es (...) sehr unbequem und beschwerlich; ja gleichsamb unmüglich sey/allen frembden Dingen teutsche Namen zu geben.“
- IV. 4. Interpretation: Neue Dinge, neue Wörter
- V. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausens Kritik an den Sprachpuristen des 17. Jahrhunderts, insbesondere anhand seines Traktats „Der Teutsche Michel“ (1673). Sie untersucht Grimmelshausens Argumentation im Kontext der sprachpraktischen und sprachphilosophischen Debatten seiner Zeit. Der Fokus liegt auf den Kapiteln IV und V, die exemplarisch Grimmelshausens sittlich-ethische und pragmatische Sprachkritik veranschaulichen und seine Auseinandersetzung mit Philipp von Zesen als Hauptgegner zeigen.
- Grimmelshausens Kritik am Sprachpurismus des 17. Jahrhunderts
- Die Rolle von „Alamode-Sprache“ und deren Kritik im Kontext des Dreißigjährigen Krieges und der Herausbildung eines deutschen Nationalgefühls
- Grimmelshausens pragmatische und sittlich-ethische Argumentation gegen Sprachmischer und übertriebene Sprachpuristen
- Die Bedeutung von Fremdwörtern und die Notwendigkeit eines Kompromisses zwischen Sprachreinheit und sprachlicher Flexibilität
- Grimmelshausens Positionierung innerhalb der zeitgenössischen sprachlichen und kulturellen Debatten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: die Kritik Grimmelshausens an den Sprachpuristen des 17. Jahrhunderts anhand seines Traktats „Der Teutsche Michel“. Sie erklärt die Begrenzung der Untersuchung auf die Kapitel IV und V, welche Grimmelshausens pragmatische und sittlich-ethische Sprachkritik exemplarisch zeigen und seine Auseinandersetzung mit dem Sprachpuristen Philipp von Zesen beleuchten. Die Einleitung betont den Kontext der Arbeit innerhalb der sprachlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen des 17. Jahrhunderts, insbesondere im Hinblick auf den Dreißigjährigen Krieg und die Herausbildung eines deutschen Nationalbewusstseins. Der einleitende Zitat "je gelehrter je verkehrter" wird als Leitmotiv eingeführt, welches Grimmelshausens Kritik an sowohl Sprachmischern als auch Sprachpuristen zusammenfasst.
II. Alamode-Sprache und Alamode-Kritik als Probleme der Zeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Alamode-Sprache“ als ein Phänomen der Sprachmischung, das durch den Einfluss des Französischen im 17. Jahrhundert geprägt war. Es analysiert die gesellschaftlichen und kulturellen Gründe für die Sprachmischung und beschreibt die Reaktion darauf in Form von Sprachpurismus und Sprachpatriotismus. Das Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen der deutschen Sprache, ihren Sprechern und den ethischen Werten, die damit verbunden wurden. Es zeigt wie die „Alamode-Kritik“ als Reaktion auf vermeintliche Bedrohungen der nationalen Eigenart verstanden werden kann.
III. Grimmelshausen Traktat vom Teutschen Michel (1673): Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Grimmelshausens „Teutschen Michel“ (1673), einschließlich seiner Entstehung, Komposition und der Intentionen des Autors. Es beleuchtet die Absicht des Werkes, seine Quellen und die Bedeutung des Traktats im Kontext des Sprachpurismus der Zeit. Der Abschnitt erläutert das Anliegen des Traktates als kritische Auseinandersetzung mit den sprachlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen der Zeit. Die Untersuchung der Quellen und des Kontextes schafft die Grundlage für eine tiefere Analyse der Purismuskritik im nächsten Kapitel.
IV. Aspekte der Purismuskritik im Teutschen Michel: Dieses Kapitel analysiert die Purismuskritik im „Teutschen Michel“, insbesondere in den Kapiteln IV und V. Es untersucht Grimmelshausens Argumentation gegen verschiedene Arten von „Sprachverderbern“, von denen einige, wie Philipp von Zesen, eine extreme Position des Sprachpurismus vertreten. Grimmelshausen argumentiert, sowohl gegen die willkürliche Mischung von Fremdwörtern als auch gegen übertriebene Sprachreinigungsbemühungen die den natürlichen Sprachwandel ignorieren. Der Abschnitt stellt Grimmelshausens pragmatischen und ethischen Ansatz gegenüber, der einen Kompromiss zwischen Sprachreinheit und sprachlicher Flexibilität befürwortet.
Schlüsselwörter
Grimmelshausen, Teutscher Michel, Sprachpurismus, Alamode-Sprache, Sprachkritik, Sprachtheorie, 17. Jahrhundert, Philipp von Zesen, Nationalsprache, Fremdwörter, Sprachmischung, ethische Sprachkritik, pragmatische Sprachkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Grimmelshausens "Teutscher Michel"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausens Kritik am Sprachpurismus des 17. Jahrhunderts, insbesondere anhand seines Traktats "Der Teutsche Michel" (1673). Der Fokus liegt auf Grimmelshausens Argumentation im Kontext der zeitgenössischen sprachpraktischen und sprachphilosophischen Debatten, speziell in den Kapiteln IV und V. Die Arbeit untersucht Grimmelshausens pragmatische und sittlich-ethische Sprachkritik und seine Auseinandersetzung mit Sprachpuristen wie Philipp von Zesen.
Welche Themen werden im "Teutschen Michel" behandelt?
Grimmelshausens "Teutscher Michel" befasst sich kritisch mit der "Alamode-Sprache", einer Form der Sprachmischung durch französischen Einfluss im 17. Jahrhundert. Der Traktat analysiert die gesellschaftlichen und kulturellen Gründe für Sprachmischung und die Reaktionen darauf, wie Sprachpurismus und Sprachpatriotismus. Ein zentrales Thema ist die Frage nach der angemessenen Verwendung von Fremdwörtern und dem Spannungsfeld zwischen Sprachreinheit und sprachlicher Flexibilität.
Welche Kapitel werden besonders untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Kapitel IV und V des "Teutschen Michel". Diese Kapitel veranschaulichen exemplarisch Grimmelshausens pragmatische und sittlich-ethische Sprachkritik und seine Auseinandersetzung mit Philipp von Zesen als Hauptgegner. Diese Kapitel untersuchen Grimmelshausens Argumentation gegen verschiedene Arten von "Sprachverderbern", sowohl gegen Sprachmischer als auch übertriebene Sprachpuristen.
Welche Rolle spielt Philipp von Zesen?
Philipp von Zesen wird als Hauptgegner Grimmelshausens in der Debatte um den Sprachpurismus dargestellt. Grimmelshausen kritisiert Zesens extreme Position des Sprachpurismus und dessen Auswirkungen auf die deutsche Sprache. Die Auseinandersetzung mit Zesen verdeutlicht Grimmelshausens pragmatischen und ethischen Ansatz, der einen Kompromiss zwischen Sprachreinheit und sprachlicher Flexibilität befürwortet.
Was ist "Alamode-Sprache"?
"Alamode-Sprache" bezeichnet in diesem Kontext die Sprachmischung im 17. Jahrhundert, insbesondere den Einfluss des Französischen auf die deutsche Sprache. Die Arbeit untersucht die gesellschaftlichen und kulturellen Ursachen für diese Sprachmischung und die Reaktionen darauf, einschließlich der Entstehung von Sprachpurismus und Sprachpatriotismus. Die "Alamode-Kritik" wird als Reaktion auf die vermeintliche Bedrohung der nationalen Eigenart verstanden.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Grimmelshausens Kritik am Sprachpurismus des 17. Jahrhunderts zu analysieren und im Kontext der zeitgenössischen sprachlichen und gesellschaftlichen Debatten zu verorten. Sie beleuchtet Grimmelshausens pragmatische und sittlich-ethische Argumentation gegen Sprachmischer und übertriebene Sprachpuristen und untersucht seine Positionierung innerhalb der zeitgenössischen sprachlichen und kulturellen Debatten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grimmelshausen, Teutscher Michel, Sprachpurismus, Alamode-Sprache, Sprachkritik, Sprachtheorie, 17. Jahrhundert, Philipp von Zesen, Nationalsprache, Fremdwörter, Sprachmischung, ethische Sprachkritik, pragmatische Sprachkritik.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Alamode-Sprache und Alamode-Kritik, ein Kapitel zum "Teutschen Michel", ein Kapitel zur Purismuskritik im "Teutschen Michel" und eine Schlussbetrachtung. Der Fokus liegt auf der Analyse der Kapitel IV und V des "Teutschen Michel".
- Arbeit zitieren
- Christian Lannert (Autor:in), 2009, „je gelehrter je verkehrter“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150284