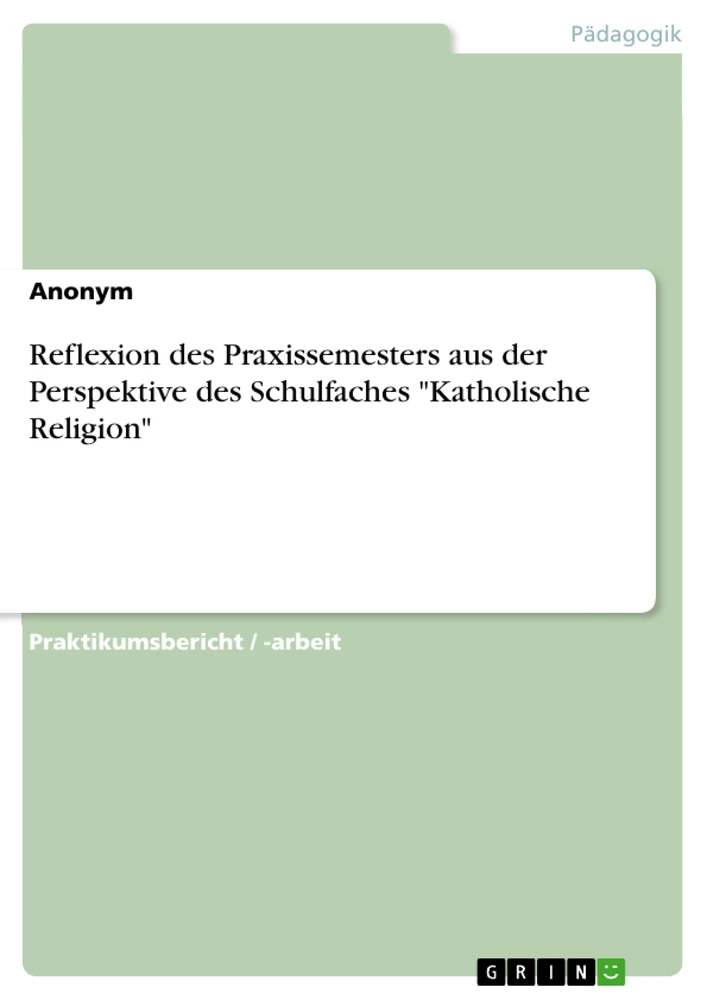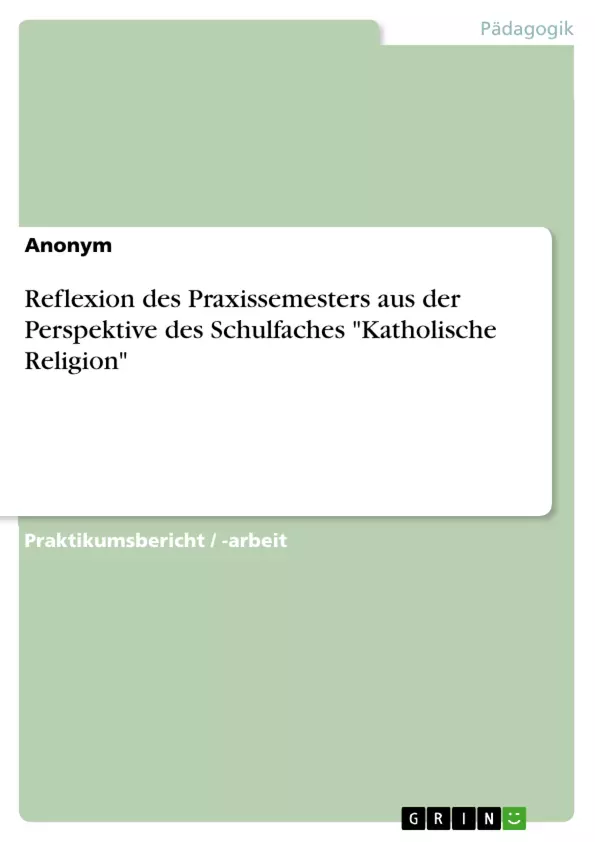Diese Arbeit reflektiert die Unterrichtsbeobachtungen, die im Rahmen des Praxissemesters als schulpraktischer Teil der universitären Lehrer:innenausbildung durchgeführt wurden. Der Fokus liegt auf der fachlichen und didaktischen Perspektive der katholischen Religionslehre. Unter Berücksichtigung eines durchgeführten Studienprojekts werden konkrete Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Beobachtungen analysiert. Ziel der Arbeit ist es, die gewonnenen Einsichten zu dokumentieren und deren Relevanz für die zukünftige Lehrtätigkeit im Fach katholische Religionslehre zu verdeutlichen. Die Reflexion umfasst sowohl die Herausforderungen als auch die Möglichkeiten, die sich im Unterricht ergeben haben, und bietet Anregungen für eine weiterführende Entwicklung der didaktischen Fähigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
1. Erwartungen an das Praxissemester
2. Unterrichtsbeobachtungen
3. Organisation des Praxissemesters
4. Kompetenzzuwachs
5. Literaturverzeichnis
1. Erwartungen an das Praxissemester
In diesem Portfolio werden die Unterrichtsbeobachtungen im Praxissemester aus fachlicher Perspektive der katholischen Religionslehre reflektiert und unter Berücksichtigung des durchgeführten Studienprojekts konkretisiert.
Das Praxissemester wurde an einem Gymnasium in NRW absolviert und ich bin mit der Erwartung gestartet, dass ich meine bereits im universitären Studium erworbenen Kompetenzen in der Praxisphase erweitern und vertiefen kann, und die Möglichkeit habe, mein theoretisches Wissen in der Praxis in ersten eigenen Unterrichtsversuchen anzuwenden und zu überprüfen. Darüber hinaus habe ich mir besonders aus Perspektive meiner Unterrichtsfächer gewünscht, dass eine gewinnbringende Vernetzung der Lernprozesse an Schule, ZfsL und Universität stattfinden wird und ich mir regelmäßig Feedback zu meinem Entwicklungsstand einholen kann. Des Weiteren habe ich mir vom Ausbildungsort Schule erhofft, dass ich durch die Unterrichtshospitationen viele Anregungen sammeln und neben den unterschiedlichen Lehrerpersönlichkeiten auch verschiedene fachdidaktische Ansätze und gelungene Dramaturgien bei den Unterrichtsreihen beobachten kann.
Bereits zu Beginn des Praxissemesters habe ich am ersten Blocktag Merkmale des Unterrichts ausgewählt, die ich bei meiner Hospitation besonders berücksichtigen wollte. Durch diese Fokussierung auf ausgewählte Qualitätsmerkmale des Unterrichts hatte ich die Erwartung, eine tiefgreifende Auseinandersetzung und eine Weiterentwicklung meiner kompetenzorientierten Professionalisierung als angehende Religionslehrkraft besser realisieren zu können.
Aus fachdidaktischer Perspektive habe ich mich für das MerkmalRelevanz1entschieden, da mir schon in den ersten beiden Wochen des Praktikums aufgefallen ist, dass die Relevanz der Inhalte des Religionsunterrichts zumeist nicht transparent geworden ist und die Frage nach der Relevanz der religiösen Themen der Lehrkraft sogar gezielt von SchülerInnen gestellt wurde. Im Rahmen meines Forschungsprojekts habe ich zudem dieSubjektorientierungim Religionsunterricht kritisch untersucht, da dieses Prinzip in der Literatur häufig als „zeitangemessenes“2und „zentrales Prinzip religiöser Bildung“3bezeichnet wird. In diesem Zusammenhang habe ich auch dieVernetzungim Religionsunterricht genauer betrachtet, da die MerkmalsausprägungSinngenerierungden SchülerInnen ohne erkennbare Sinnzusammenhänge nur schwer ermöglicht werden kann und ein aufbauendes Lernen erschwert.4Auch in Bezug auf die Subjektorientierung schätze ich das Merkmal Relevanz als zentral ein, da ein „Empfinden von Relevanz“5, beispielsweise durch den Lebensweltbezug des Unterrichtsgegenstandes, als Ausgangspunkt religiösen Lernens für die Subjekte in einem subjektorientierten Religionsunterricht unabdingbar ist. Aus pädagogisch psychologischer Perspektive erschien das MerkmalKlare Strukturierung des Unterrichts6als sinnvolle Ergänzung, um den beobachteten Unterricht noch einmal auf der Metaebene zu reflektieren.
Unter besonderer Berücksichtigung dieser Aspekte erhoffte ich mir vor allem einen Kompetenzzuwachs in der Planung von einem Religionsunterricht, der heterogenen Lerngruppen mit diverser Verbindung zur Religion einen Zugang und eine Auseinandersetzung ermöglicht, die von den SchülerInnen als relevant für die eigene Biographie erlebt wird und in seiner Reihengestaltung gut vernetzt ist, um eine Lernprogression zu fördern.7Dieser Kompetenzzuwachs bei der eigenen Professionalisierung wird von mir als besonders wichtig erachtet, um guten, sinnstiftenden Religionsunterricht durchführen zu können und so auch kritische Anfragen an den Religionsunterricht auszuräumen.
Meine Erwartungen an das Praxissemester wurden im Schulfach Katholische Religion teilweise erfüllt. Ich habe beobachtet, dass fachdidaktische Ansätze nur als Versatzstücke zum Einsatz kamen und Unterrichtsreihen zumeist additiv aufgebaut und die einzelnen Stunden daher wenig bis gar nicht vernetzt waren. Diese Beobachtung impliziert zugleich, dass eine klare Strukturierung des Unterrichts nicht verwirklicht wurde. Generell fiel mir unter besonderer Berücksichtigung meines Forschungsprojekts auf, dass der Religionsunterricht eher sachkundlich ausgerichtet ist. Demnach konnte wenig Subjektorientierung beobachtet werden und auch die Frage nach der Relevanz des Gelernten blieb unbeantwortet, auch, weil ein Lebensweltbezug zumeist nicht hergestellt wurde. Doch gerade die Reflexion dieser Negativbeispiele hat bei mir die Suche nach Alternativen angeregt, die ich bei eigenen Unterrichtsvorhaben bestmöglich umsetzen möchte.
Übertroffen wurden meine Erwartungen hingegen bei der Beobachtung und Reflexion verschiedener Lehrerpersönlichkeiten. Besonders im Religionsunterricht wurde transparent, dass eine gute Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden einen positiven Einfluss auf die Unterrichtsatmosphäre, insbesondere auf die Offenheit und Beteiligung der SchülerInnen hatte.8Durch eine gute Beziehungsgestaltung konnten so auch aus didaktischer Perspektive verbesserungswürdige Stunden gelingen. Für mich bedeutet diese Erkenntnis, dass ich fachliche und fachdidaktische Kompetenzen gleichermaßen wie pädagogische Kompetenzen in den Fokus meines weiteren Ausbildungswegs stellen werde. Für ergänzende Impulse werde ich Fortbildungsangebote der Bistümer nutzen, da ich während des Praxissemesters bereits gewinnbringende Einblicke in die Gestaltung der Seminare erlangen konnte.
2. Unterrichtsbeobachtungen
Meine Unterrichtsbeobachtungen möchte ich vor allem im Rahmen meines durchgeführten Studienprojekts reflektieren, in dessen Rahmen ich mich mit der FoschungsfrageInwieweit steigert eine religionsdidaktische Subjektorientierung die Motivation der SchülerInnen im konfessionell gebundenen Religionsunterricht einer Sek I?beschäftigt habe.
Bei der Beobachtung des Religionsunterrichts wurde schnell deutlich, dass die Ausrichtung des Religionsunterrichts an dieser Schule unabhängig von der Lehrkraft stark sachkundlich orientiert ist und die Relevanzfrage vernachlässigt. In den beobachteten Unterrichtsreihen, die zudem eher additiv konzipiert waren, wurden fachdidaktische Prinzipien und Ansätze eher selten und wenn eher als Bruchstück innerhalb einer Unterrichtsstunde angewandt. Dementsprechend konnten Defizite bei der Vernetzung, der Dramaturgie und insgesamt bei der Strukturierung der Reihen beobachtet werden. Bei der Umsetzung des Studienprojekts war es jedoch möglich, eine selbst geplante Stunde von der Lehrkraft durchführen zu lassen, bei der das Prinzip der Subjektorientierung stringent eingesetzt wurde. Weiterhin erschien problematisch, dass das Prinzip der Subjektorientierung offenbar häufig als „inhaltslose[s] Selbstentfaltungsprogramm“9missverstanden wurde.
Diese Ausrichtung des Religionsunterrichts hat die Folge, dass das kognitive Anspruchsniveau gering ist, was sich darin zeigte, dass alle Aussagen der SchülerInnen gleichwertig, nicht begründungspflichtig und zumeist unkommentiert von der Lehrkraft gesammelt wurden. Die Tendenz zur Beliebigkeit bei den Äußerungen der SchülerInnen kann insofern als problematisch gelten, als dass „kognitive Aktivierung schwierig [wird], wo religiöse Fragen als unentscheidbar gelten“10. Darüber hinaus scheint es im beobachteten Religionsunterricht schwierig kognitive Aktivierung zu initiieren, weil es keinen verbindlichen Referenzrahmen für eine gemeinsame Gesprächsgrundlage gibt und die Ausrichtung des Religionsunterrichts allgemein eher problemvermeidend, wenig korrelativ, sachkundlich und subjektivistisch ist, wodurch das Empfinden von Relevanz ausbleibt.11Eine kognitiv aktivierende Lernumgebung wäre jedoch eine wichtige Voraussetzung, um das kritische Denken als ein „reflexiver, konstruktiver, kreativer, explorativer und kollaborativer Lernprozess“12überhaupt anregen zu können.13Dabei kann es auch gerade als eine Aufgabe des Religionsunterrichts gesehen werden, das kritische Denken zu fördern, um letztendlich zu einer religiösen Urteilsbildung und theologischen Argumentationsfähigkeit gelangen zu können.14
Damit eine Subjektorientierung unter besonderer Berücksichtigung der im Projekt gewählten Merkmalsausprägungen besser gelingen kann, müssten zunächst die Merkmale guten Religionsunterrichts besser in den beobachteten Unterricht integriert werden. Dies ist vor allem unter der Prämisse bedeutsam, dass das Empfinden der SchülerInnen, dass eine Thematik für sie relevant ist, „für eine motivierte Beteiligung von elementarem Interesse“15ist. Das eigene Projekt bringt das gleiche Ergebnis hervor, da die Merkmalsausprägungen von Motivation deutlich häufiger das höchste Level erreichten, wenn Relevanz durch einen Lebensweltbezug gegeben war. Insgesamt konnte jedoch festgestellt werden, dass auch eine gelingende Subjektorientierung allein kein Garant für Motivation aufseiten der SchülerInnen ist, sondern weitere Einflussfaktoren, wie die Voraussetzungen der Lerngruppe und der Unterrichtsgegenstand selbst von Bedeutung waren.
Nicht zu verkennen war bei allen Hospitationen der merkliche Einfluss der Beziehung zwischen Lehrkraft und SchülerInnen auf die motivierte Beteiligung und das Engagement der Lernenden. Bereits Hattie konnte in einer Meta-Analyse eine hohe Effektstärke für den Einfluss der Lehrenden-Lernenden-Beziehung auf den Lernprozess und die Lernleistungen nachweisen.16Aus fachspezifischer Perspektive konnte Dietzsch ebenfalls für den Religionsunterricht feststellen, dass „eine gelungene Lehrenden-Lernenden-Beziehung [...] eine große Bedeutung für das Lernen im Religionsunterricht [hat]“17.
Die Nichtbeachtung der ausgewählten Merkmale im beobachteten Religionsunterricht kann auf mehrere Umstände an der Schule zurückgeführt werden. Die Stellung des Religionsunterrichts an der Schule wird durch mehrere Faktoren herabgesetzt. Zum einen besteht derzeit nicht die Möglichkeit, den SchülerInnen durchgängig Religionsunterricht anzubieten, wodurch der Lehrplan nicht realisiert werden kann und ein spiralcurricularer Kompetenzerwerb nicht möglich wird. Zum anderen ging aus Gesprächen mit Lehrkräften hervor, dass der persönliche Schwerpunkt eher auf ihrem Zweitfach (Hauptfach) liegt und ihnen vor allem die fachdidaktische Expertise fehlt, während sie die fachliche Expertise häufig bewusst nicht einbringen, da sie von einem Desinteresse der SchülerInnen ausgehen. Die geringe Bedeutung von Religiösität in der Lebenswelt der meisten SchülerInnen betrachte ich als weiteres aber geringeres Problem, da das Angebot der religiösen Weltsicht- und deutung von der Lehrkraft durch den Einsatz entsprechender religionspädagogischer Prinzipien und fachdidaktischer Ansätze zumindest eröffnet werden könnte.
Insgesamt lässt sich der beobachtete Unterricht nach umfassender Reflexion kurzgefasst als das charakterisieren, was in der Unterrichtsforschung von Eck und Englert als „RADEV- Symptomatik“18bezeichnet wird.
3. Organisation des Praxissemesters
Das Praxissemester wird von verschiedenen Akteuren organisiert und begleitet. Die quantitativ größte Bedeutung kommt dem Lernort Schule zu, während das Zentrum für schulische Lehrerbildung (ZfsL) und die Universität an Blocktagen die Möglichkeit bieten, Praxiserfahrungen zu reflektieren und diese forschend mittels Studienprojekten für die eigene Professionalisierung und den Kompetenzzuwachs fruchtbar zu machen.
Ich habe die Organisation des Praxissemesters insgesamt als gut strukturiert und gerahmt empfunden, da die Veranstaltungen des ZfsL und der Universität jeweils zu Beginn, Mitte und Ende des Praxissemesters stattgefunden haben. Die regelmäßige und begleitende Betreuung hat die Möglichkeit eröffnet, jeweils aktuelle Situationen zu reflektieren und Fragen zu klären, die sich während des Lernprozesses am Ausbildungsort Schule ergeben haben. Die Angebote der einzelnen Institutionen haben sich demnach ingesamt gut ergänzt.
Hinderlich war in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Reflexionen mit den personellen Vertretern der unterschiedlichen Institutionen häufig heterogene Ergebnisse hervorbrachten. So gab es nicht allein verschiedene Positionen innerhalb des fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskurses, sondern auch stark subjektive Einschätzungen zur Planung und Durchführung guten Religionsunterrichts. Diese Schwierigkeit mündete zugleich auch in der Chance, das Selbstkonzept als künftige Religionslehrkraft zu reflektieren und Theorie und Praxis in einen produktiven Dialog zu bringen.
Zudem hätte ich mir eine fachliche und fachdidaktische Reflexion des hospitierten und selbst durchgeführten Unterrichts im Fachseminar des ZfsL gewünscht, sowie eine Besprechung der sich daraus ergebenden Perspektiven und möglichen Alternativen. Als gewinnbringend habe ich die Reflexion der eigenen Lehrerpersönlichkeit aus fachspezifischer Perspektive und die Betrachtung eines gelungenen UPP-Entwurfs im Fach Katholische Religion empfunden. Diesen Einblick in die Erwartungen im Referendariat bereits während des Praxissemesters habe ich als sinnvolle Brücke zwischen Masterstudium und Referendariat erlebt. Zudem konnte ich Parallelen zwischen den Anforderungen für die Reihenplanung im Studium und für die Unterrichtsentwürfe im Referendariat erkennen, sodass ich mich hinsichtlich der Planung von Religionsunterricht gut vorbereitet fühle.
4. Kompetenzzuwachs
Insgesamt fühle ich mich durch meine Erfahrungen im Praxissemester darin bestärkt, den LehrerInnenberuf zu ergreifen. Trotz einiger Negativbeobachtungen kann ich sowohl in fachdidaktischer als auch in pädagogischer Hinsicht einen Kompetenzzuwachs feststellen. Die forschend-reflexive Herangehensweise hat mir dazu verholfen, theoretische Konstrukte in der Praxis zu überprüfen und in diesem Fall vor allem Schwachstellen des Religionsunterrichts zu identifizieren. Im Referendariat möchte ich meine forschendreflexive Haltung bei Unterrichtshospitationen und auch bei eigenen Unterrichtsversuchen weiterentwickeln. Für mich macht eine gute (Religions-)Lehrkraft aus, dass sie sich ihr gesamtes Berufsleben lang fortlaufend reflektiert und sich weiterbilden möchte. Unter Bezugnahme meines Forschungsprojekts im Praxissemester bedeutet das für mich, dass ich mich neben dem Berufsalltag weiterhin mit fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Literatur auseinandersetze und neue Erkenntnisse produktiv für meine Unterrichtsvorhaben nutzbar mache. Aus meinem Forschungsprojekt gehen zwei exemplarische und äußerst relevante Variablen bei der Unterrichtsplanung hervor. Zum einen die Voraussetzungen der Lerngruppe und zum anderen die fachdidaktische Aufbereitung des Lerngegenstands.
Ich habe gelernt, dass die Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppe bei der Planung von gutem Religionsunterricht von besonderer Bedeutung ist. Neben der Leistungsheterogenität möchte ich die heterogenen Lebenswelten und die damit zugleich verbundene heterogene, zumeist nicht mehr religiöse, Sozialisation der SchülerInnen berücksichtigen. So werde ich einer Schülerschaft mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen gegenüberstehen, die ich mit meinem Unterricht motivieren möchte. Durch mein Forschungsprojekt habe ich einen Lernzuwachs darin erlebt, wie ich Motivation im didaktischen Sinne als „Beweggründe lernzielorientierten Verhaltens“19durch das Schaffen von Motivationsanreizen fördern kann.20
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Bereitschaft der SchülerInnen am Unterricht zu partizipieren und letztendlich auch nachweislich für die Lernleistung war eine positive Beziehungsgestaltung zwischen der Lehrkraft und den Lernenden. Daher möchte ich selbst mein pädagogisches Selbstkonzept weiterentwickeln und mich um eine gute Beziehung zu den SchülerInnen bemühen, was mir bereits im Praxissemester gut gelungen ist.
Nicht zuletzt lässt sich Motivation auch über Merkmale guten Religionsunterrichtes, wie Relevanz, die in der eigenen Beobachtung besonders durch einen Lebensweltbezug erreicht werden konnte, und kognitiv anspruchsvolle Lernumgebungen beeinflussen. Um dies zu gewährleisten, erscheint auch das QualitätsmerkmerkmalKlare Strukturierung des Unterrichtsals wichtige Ausgangslage.
Durch die eigene Planung einer Religionsstunde unter Beachtung der selbst konnte eine Unterrichtseinheit mit gelingender Subjektorientierung statt einer reinen Subjektivierung simuliert werden. Auch vonseiten der Forschung wird diese „Lücke zwischen [der] normativen Ausrichtung [der Subjektorientierung] und den didaktischen Konkretionen, die nur unzureichend ausgearbeitet und empirisch noch kaum überprüft sind“21bemängelt. Mit Rückbezug auf die in der Theorie durchaus positivistische Einschätzung, dass Subjektorientierung ein „zentrales Prinzip religiöser Bildung“22sei, ist es an der Zeit, an offenen Fragen weiterzuarbeiten, damit der „normativ so gut begründete Anspruch auch tatsächlich praktisch gefüllt werden kann“23.
Zudem ging aus dem Studienprojekt hervor, dass die motivationssteigernde Wirkung des Prinzips der Subjektorientierung eine Abhängigkeit von der Lerngruppe und dem Gegenstand aufwies. Aus dem Projekt ergibt sich für mich demnach insgesamt die Handlungsperspektive, dass fachdidaktische Prinzipien und Ansätze immer korrekt und stringent eingesetzt werden sollten und gegenüber der Lerngruppe, dem Lerngegenstand und den Lernzielen begründungspflichtig sind. Die Merkmale guten Religionsunterrichts werde ich zudem zur Grundlage meiner Unterrichtsplanung machen.
Für die Weiterentwicklung meiner forschend-reflexiven Haltung habe ich während des Praxissemesters gelernt, dass ich mich am besten aspektorientiert und intensiv mit einzelnen fachdidaktischen Prinzipien und Ansätzen und Qualitätsmerkmalen des Unterrichts auseinandersetze, indem ich sie mit einer bestimmten Fragestellung und Zielsetzung erforsche und reflektiere, bevor ich mich einem neuen Aspekt des Religionsunterrichts widme. Ich halte es auch für sinnvoll, bereits selbst erforschte Phänomene in regelmäßigen Zyklen erneut am eigenen unterrichtlichen Handeln zu überprüfen. Dementsprechend halte ich das forschend-reflexive Vorgehen im Praxissemester für äußerst lehrreich und hilfreich für den eigenen Lernprozess und die eigene Kompetenzentwicklung, aber auch generell für die Qualitätsentwicklung des Religionsunterrichts.
6. Literaturverzeichnis
Literatur:
Boschki, R./Gronover, M./Hiller, S., Bedeutung interreligiösen Lernens in Gesellschaft, Arbeit und im Religionsunterricht an beruflichen Schulen, in: Friedrich Schweitzer/ Magda Bräuer/ Reinhold Boschki (Hg.), Interreligiöses Lernen durch Perspektivenübernahme. Eine empirische Untersuchung religionsdidaktischer Ansätze, Münster 2017, 33-42.
Cursio, M./Jahn, D., Kritisches Denken. Eine Einführung in die Didaktik der Denkschulung (Diversität und Bildungsforschung im digitalen Zeitalter), Wiesbaden 2021.
Dietzsch, A., Die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden im Religionsunterricht - Bedeutung für das Lernen und Impulse für den digitalen Religionsunterricht, in: Theo- Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 9. Jg., H. 2 (2020), S. 34-49.
Englert, R./Eck, S., R-A-D-E-V. Religionsunterrichtliche Lehrstücke im Praxistest (Religionspädagogische Bildungsforschung 7), Bad Heilbrunn 2021.
Mendl, H., Religionsdidaktik kompakt. Für Studium, Prüfung und Beruf, München 620 1 8.
Meyer, H., Was ist guter Unterricht? Berlin 920 1 3.
THEIßEN, G., Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidaktik, Gütersloh 2003.
Schweitzer, F., Subjektorientierung in der Religionspädagogik: Grundprinzip, Alleinstellungsmerkmal oder Desiderat? Ein Klärungsversuch, in: Stefan Altmeyer/ Bernhard Grümme/ Helga Kohler-Spiegel u.a. (Hg.), Religion subjektorientiert erschließen (Jahrbuch der Religionspädagogik 38), Göttingen 2022, S. 19-32.
[...]
1Vgl. Englert/ Eck 2021, 14.
2MENDL 2018, 182.
3Boschki/ Gronover/ Hiller 2017, 37.
4Vgl. ENGLERT/ ECK 2021, 21.
5Englert/ Eck 2021, 229.
6Vgl. Meyer 920 1 3, 25.
7Vgl. Englert/ Eck 2021, 17.
8Ähnliches konstatiert Dietzsch 2020 für den positiven Einfluss der Lehrenden-Lernenden-Beziehung für die Qualität und die Lernprogression im Religionsunterricht.
9MENDL 2018, S. 183.
10ENGLERT/ ECK 2021, 203.
11Vgl. ENGLERT/ ECK 2021, 214-215.
12Jahn/ Cursio 2021, 166.
13Vgl. JAHN/ CURSIO 2021, 105.
14Vgl. ENGLERT/ ECK 2021, 224.
15Englert/ Eck 2021, 200.
16Vgl. HATTIE 2013, 142.
17Dietzsch 2020, 46.
18Englert/ Eck 2021, 14.
19THEIßEN 2003, 267.
20Vgl. THEIßEN 2003, 265.
21Schweitzer 2022, 32.
22Boschki/ Gronover/ Hiller 2017, 37.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Praxissemester-Portfolios?
Dieses Portfolio reflektiert die Unterrichtsbeobachtungen im Praxissemester aus fachlicher Perspektive der katholischen Religionslehre, unter Berücksichtigung eines durchgeführten Studienprojekts.
Welche Erwartungen hatte der Autor/die Autorin an das Praxissemester?
Der Autor/die Autorin erwartete, die im Studium erworbenen Kompetenzen in der Praxis zu erweitern, theoretisches Wissen in Unterrichtsversuchen anzuwenden und zu überprüfen, eine Vernetzung der Lernprozesse zwischen Schule, ZfsL und Universität zu erleben, Feedback zum Entwicklungsstand zu erhalten und Anregungen durch Unterrichtshospitationen zu sammeln.
Welche Merkmale des Unterrichts wurden besonders berücksichtigt?
Die Merkmale Relevanz, Subjektorientierung und Vernetzung aus fachdidaktischer Perspektive sowie Klare Strukturierung des Unterrichts aus pädagogisch-psychologischer Perspektive wurden besonders berücksichtigt.
Welche Kompetenzzuwächse wurden erwartet?
Es wurde ein Kompetenzzuwachs in der Planung von Religionsunterricht erwartet, der heterogenen Lerngruppen mit diverser Verbindung zur Religion einen relevanten Zugang und eine Auseinandersetzung ermöglicht und in seiner Reihengestaltung gut vernetzt ist.
Wie wurden die Erwartungen an das Praxissemester erfüllt?
Die Erwartungen wurden teilweise erfüllt. Fachdidaktische Ansätze wurden oft nur als Versatzstücke eingesetzt, Unterrichtsreihen waren additiv aufgebaut und wenig vernetzt. Der Religionsunterricht war eher sachkundlich ausgerichtet, mit wenig Subjektorientierung und unbeantworteter Relevanzfrage. Die Beobachtung verschiedener Lehrerpersönlichkeiten und der positive Einfluss einer guten Lehrenden-Lernenden-Beziehung übertrafen die Erwartungen.
Was war das Forschungsprojekt im Praxissemester?
Das Forschungsprojekt beschäftigte sich mit der Frage, inwieweit eine religionsdidaktische Subjektorientierung die Motivation der SchülerInnen im konfessionell gebundenen Religionsunterricht einer Sekundarstufe I steigert.
Welche Beobachtungen wurden im Religionsunterricht gemacht?
Der Religionsunterricht war stark sachkundlich orientiert, die Relevanzfrage wurde vernachlässigt, fachdidaktische Prinzipien wurden selten angewandt und Defizite bei Vernetzung, Dramaturgie und Strukturierung wurden beobachtet. Das Prinzip der Subjektorientierung wurde offenbar häufig als inhaltsloses Selbstentfaltungsprogramm missverstanden.
Welche Auswirkungen hatte die Ausrichtung des Religionsunterrichts?
Das kognitive Anspruchsniveau war gering, Aussagen der SchülerInnen wurden gleichwertig behandelt, es gab keinen verbindlichen Referenzrahmen für Gespräche und die Ausrichtung war eher problemvermeidend, wenig korrelativ, sachkundlich und subjektivistisch, wodurch das Empfinden von Relevanz ausblieb.
Welchen Einfluss hatte die Beziehung zwischen Lehrkraft und SchülerInnen?
Die Beziehung zwischen Lehrkraft und SchülerInnen hatte einen merklichen Einfluss auf die motivierte Beteiligung und das Engagement der Lernenden.
Wie wurde das Praxissemester organisiert?
Das Praxissemester wurde von Schule, ZfsL und Universität organisiert. Die Veranstaltungen des ZfsL und der Universität fanden zu Beginn, Mitte und Ende des Praxissemesters statt.
Wie wurde die Organisation des Praxissemesters empfunden?
Die Organisation wurde insgesamt als gut strukturiert und gerahmt empfunden. Die regelmäßige Betreuung ermöglichte Reflexionen und Klärungen. Hinderlich waren jedoch heterogene Ergebnisse der Reflexionen mit Vertretern der verschiedenen Institutionen.
Welchen Kompetenzzuwachs konnte der Autor/die Autorin feststellen?
Der Autor/die Autorin konnte sowohl in fachdidaktischer als auch in pädagogischer Hinsicht einen Kompetenzzuwachs feststellen. Die forschend-reflexive Herangehensweise half, theoretische Konstrukte in der Praxis zu überprüfen und Schwachstellen des Religionsunterrichts zu identifizieren.
Was wurde über Motivation im Religionsunterricht gelernt?
Die Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppe, die Schaffung von Motivationsanreizen und eine positive Beziehungsgestaltung zwischen Lehrkraft und Lernenden sind wichtige Faktoren für die Motivation der SchülerInnen.
Welche Handlungsperspektiven ergeben sich aus dem Studienprojekt?
Fachdidaktische Prinzipien und Ansätze sollten immer korrekt und stringent eingesetzt werden und gegenüber der Lerngruppe, dem Lerngegenstand und den Lernzielen begründungspflichtig sein. Die Merkmale guten Religionsunterrichts sollten zur Grundlage der Unterrichtsplanung gemacht werden.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2024, Reflexion des Praxissemesters aus der Perspektive des Schulfaches "Katholische Religion", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1503369