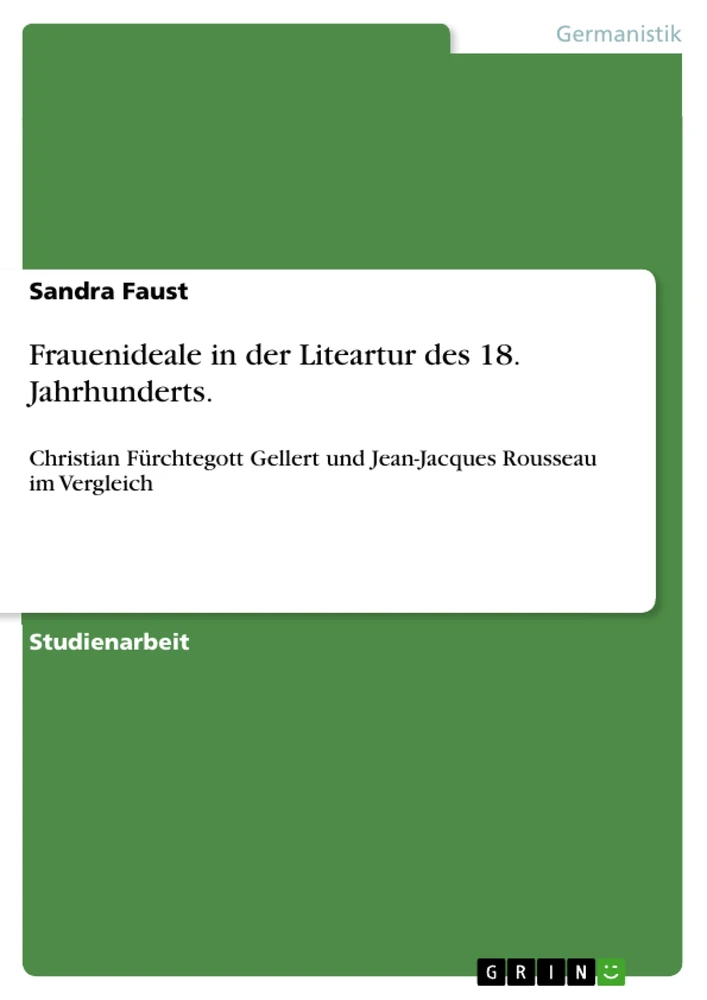„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ (Kant, Immanuel 1784).
So beschreibt Immanuel Kant 1784 die geistesgeschichtliche Strömung die die Zeit des 18. Jahrhunderts prägte.
Man könnte nun zu der Annahme kommen, dass durch das Ideal des emanzipierten Menschen auch die Gleichberechtigung der Frau während des Zeitalters der Aufklärung voranschritt. Es wurde schließlich Toleranz, die Loslösung von der Theologie und die innere Unabhängigkeit propagiert und der Mensch zu selbstständigem Denken und Handeln aufgefordert. (Zirbs, Wieland (Hrsg.) (1998): Literaturlexikon: Daten, Fakten und Zusammenhänge. Berlin.: 33f.) Jedoch konnte sich eine Emanzipation der Frau mit der Aufklärung nicht durchsetzen. Obwohl besonders in der Frühaufklärung der Entwurf eines egalitären Geschlechterverhältnisses aufkam, wurde die Idee des aufgeklärten Menschen bald nur auf den männlichen Teil der Menschheit bezogen. Diese Entwicklungen von Gesellschaft und Menschenbild des 18. Jahrhunderts spiegeln sich in der Literatur der Zeit wieder.
Christian Fürchtegott Gellert war der meistgelesene Autor der Epoche und hatte mit seiner Literatur großen Einfluss auf die lesende Bevölkerung. Er schrieb Schäferspiele, Komödien, Lustspiele und einen Roman und am erfolgreichsten seine Fabeln und Erzählungen, mit denen er seinem Werk einen erzieherischen Charakter verlieh. Häufig wird Gellert sogar als Volkserzieher bezeichnet.
Ein weiterer sehr einflussreicher Autor im 18. Jahrhundert war der Philosoph und Pädagoge Jean-Jacques Rousseau, der in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit seinem Erziehungsroman Emile oder über die Erziehung auf das Menschenbild der Leser einwirkte.
Ziel der vorliegenden Arbeit soll es nun sein, die Weiblichkeitsbilder, die den Texten der beiden Autoren zugrundeliegen, herauszuarbeiten und zu vergleichen. Dabei soll versucht werden Gellert und Rousseau innerhalb der Entwicklung des Frauenideals im 18. Jahrhundert einzuordnen. Hierzu werden zunächst die reale Rolle der Frau des Jahrhunderts und die verschiedenen Ideale des Weiblichen, wie sie besonders deutlich in der Literatur entstanden aufgezeigt. Im weiteren Text soll das Frauenbild, das in verschiedenen Werken Gellerts und Rousseaus (Gellerts Fabeln und Lustspiele und Rousseaus Erziehungsroman) zum Vorschein kommt anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frauen im 18. Jahrhundert
- Frauenleben und Frauenbildung
- Frauenideale
- Weiblichkeitsbild in Gellerts Werk
- Vater-Tochter-Beziehungen
- Ehe
- Weibliche Gelehrsamkeit
- Weiblichkeit in Rousseaus Werk
- Eigenschaften der beiden Geschlechter
- Das Machtverhältnis
- Die Gebildete Frau
- Gellert und Rousseau: Zusammenfassung und Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Weiblichkeitsbildern, die in den Werken von Christian Fürchtegott Gellert und Jean-Jacques Rousseau zum Ausdruck kommen. Ziel ist es, die jeweiligen Frauenbilder im Kontext der Entwicklung des Frauenideals im 18. Jahrhundert zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden die reale Rolle der Frau im 18. Jahrhundert sowie verschiedene Ideale des Weiblichen, die in der Literatur entstanden, beleuchtet.
- Das Frauenbild in der Literatur des 18. Jahrhunderts
- Die Rolle der Frau im privaten und öffentlichen Leben
- Das Ideal der gelehrten Frau und die Entstehung des Ideals der Empfindsamen
- Die Darstellung von Vater-Tochter-Beziehungen in Gellerts Werk
- Der Vergleich der Weiblichkeitsbilder in den Werken von Gellert und Rousseau
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Aufklärung und ihre Auswirkungen auf das Frauenbild. Das zweite Kapitel befasst sich mit der realen Rolle der Frau im 18. Jahrhundert und den verschiedenen Frauenidealen, die in dieser Zeit entstanden. Das dritte Kapitel analysiert das Weiblichkeitsbild in Gellerts Werk, insbesondere in seinen Fabeln und Lustspielen. Das vierte Kapitel behandelt die Darstellung des Weiblichen in Rousseaus Erziehungsroman "Emile oder über die Erziehung".
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Weiblichkeit, Frauenbild, Aufklärung, Literatur, Gellert, Rousseau, Frauenideale, gelehrte Frau, Empfindsamkeit, Vater-Tochter-Beziehungen und Erziehungsroman.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte die Aufklärung das Frauenbild im 18. Jahrhundert?
Obwohl die Aufklärung Ideale wie Mündigkeit und Vernunft propagierte, blieb die reale Emanzipation der Frau aus. Das Ideal des aufgeklärten Menschen wurde oft nur auf Männer bezogen.
Was kennzeichnete das Frauenbild von Jean-Jacques Rousseau?
In seinem Werk "Emile" definierte Rousseau spezifische Eigenschaften für die Geschlechter, die oft ein Machtverhältnis zementierten, wobei die Frau primär auf ihre Rolle im privaten Bereich vorbereitet wurde.
Wie stellte Christian Fürchtegott Gellert Frauen in seinen Werken dar?
Gellert, oft als "Volkserzieher" bezeichnet, thematisierte in seinen Fabeln und Lustspielen besonders Vater-Tochter-Beziehungen, die Ehe und die Frage der weiblichen Gelehrsamkeit.
Was war das Ideal der "gelehrten Frau"?
Es war ein kontroverses Ideal der Zeit, das Bildung für Frauen forderte, jedoch oft im Konflikt mit den traditionellen Rollenbildern und dem aufkommenden Ideal der "Empfindsamen" stand.
Wie unterschieden sich Gellert und Rousseau in ihren Ansätzen?
Die Arbeit vergleicht beide Autoren hinsichtlich ihrer Weiblichkeitsbilder und ordnet sie in die literarische und gesellschaftliche Entwicklung des 18. Jahrhunderts ein.
- Citar trabajo
- Sandra Faust (Autor), 2007, Frauenideale in der Liteartur des 18. Jahrhunderts., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150383