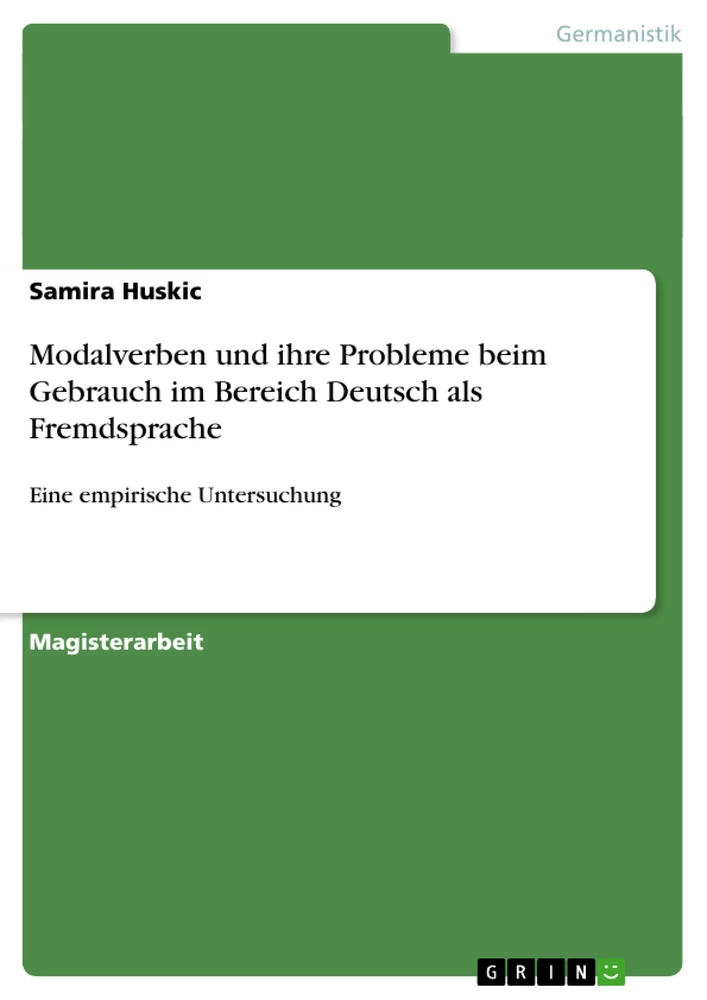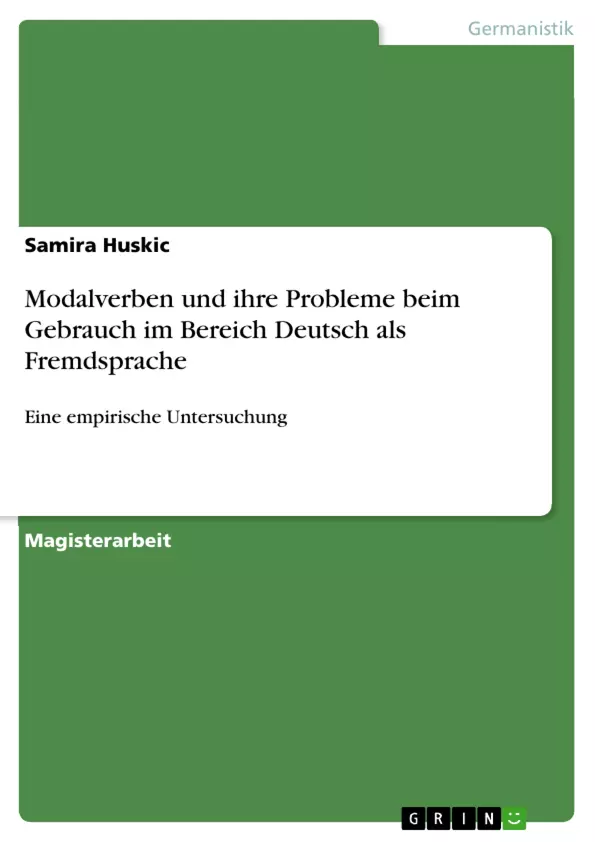Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Theoretischer Teil der Arbeit 3
2.1 Modalität 3
2.1.1 Indikativ 4
2.1.2 Konjunktiv 4
2.1.2.1 Konjunktiv I 5
2.1.2.2 Konjunktiv II 5
2.1.2.3 würde-Form 6
2.1.3 Imperativ 7
2.2 Abgrenzung der Modalverben von Vollverben und ihre morphologischen Kriterien 8
2.2.1 Gegenstandsbereich 8
2.2.2 Besonderheiten zur Abgrenzung der Modalverben 9
2.2.3 Morphologische Kriterien und Konjugation der Modalverben 14
2.3 Syntaktische Aspekte 19
2.3.1 Vorkommen mit dem Infinitiv 23
2.3.1.1 Stellung des Infinitivs 24
2.3.1.2 Ellipsen 25
2.3.2 Subjektrestriktion 29
2.3.3 Hebungs- und Kontrollverben 33
2.4 Semantische Aspekte 35
2.4.1 Nicht-epistemische Verwendung der Modalverben 38
2.4.1.1 können 39
2.4.1.2 müssen 41
2.4.1.3 dürfen 44
2.4.1.4 sollen 46
2.4.1.5 wollen 51
2.4.1.6 mögen 54
2.4.1.7 möchten 56
2.4.1.8 Beziehung zwischen müssen und können 57
2.4.1.9 Beziehung zwischen dürfen und können 58
2.4.2 Epistemische Verwendung der Modalverben 60
2.4.2.1 Tempora der epistemischen Modalverben 62
2.4.2.2 Bedeutung der epistemischen Modalverben 63
2.4.2.3 Modalverben als Ausdruck einer Vermutung 64
2.4.2.3.1 müssen 64
2.4.2.3.2 können 65
2.4.2.3.3 dürfen 66
2.4.2.3.4 mögen 66
2.4.2.4 Epistemische Modalverben als Ausdruck einer fremden Aussage 68
2.4.2.4.1 sollen 68
2.4.2.4.2 wollen 69
2.5 Höflichkeitsform der Modalverben 70
2.6 Modalitätsverben 70
3 Empirischer Teil der Arbeit 73
3.1 Aufbau der empirischen Untersuchungen 73
3.2 Untersuchungsverlauf 74
3.2.1 Gruppe 1 – chinesische Sprachschüler 76
3.2.1.1 Auswertung 77
3.2.1.2 Fehleranalyse 78
3.2.1.2.1 Allgemeine Kenntnisse über Modalverben 78
3.2.1.2.2 Einsetzen von Modalverben 80
3.2.1.2.3 Transformation von Sätzen 86
3.2.2 Gruppe 2: Sprachschüler verschiedener Nationalitäten 93
3.2.2.1 Auswertung 94
3.2.2.2 Fehleranalyse 96
3.2.2.2.1 Allgemeine Kenntnisse über Modalverben 96
3.2.2.2.2 Einsetzen von Modalverben 98
3.2.2.2.3 Transformation von Sätzen 101
3.2.3 Gruppe 3: deutsche Studierende 108
3.2.3.1 Auswertung 109
3.2.3.2 Fehleranalyse 109
3.2.3.2.1 Allgemeine Kenntnisse über Modalverben 109
3.2.3.2.2 Einsetzen von Modalverben 112
3.2.3.2.3 Transformation von Sätzen 115
3.3 Ergebnissicherung und Vergleich 122
3.3.1 Gruppe 1 122
3.3.2 Gruppe 2 123
3.3.3 Gruppe 3 124
4 Schlusswort 127
5 Literaturverzeichnis 129
1 Einleitung
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, einen theoretischen und einen empirischen Teil.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Teil der Arbeit
- 2.1 Modalität
- 2.1.1 Indikativ
- 2.1.2 Konjunktiv
- 2.1.2.1 Konjunktiv I
- 2.1.2.2 Konjunktiv II
- 2.1.2.3 würde-Form
- 2.1.3 Imperativ
- 2.2 Abgrenzung der Modalverben von Vollverben und ihre morphologischen Kriterien
- 2.2.1 Gegenstandsbereich
- 2.2.2 Besonderheiten zur Abgrenzung der Modalverben
- 2.2.3 Morphologische Kriterien und Konjugation der Modalverben
- 2.3 Syntaktische Aspekte
- 2.3.1 Vorkommen mit dem Infinitiv
- 2.3.1.1 Stellung des Infinitivs
- 2.3.1.2 Ellipsen
- 2.3.2 Subjektrestriktion
- 2.3.3 Hebungs- und Kontrollverben
- 2.3.1 Vorkommen mit dem Infinitiv
- 2.4 Semantische Aspekte
- 2.4.1 Nicht-epistemische Verwendung der Modalverben
- 2.4.1.1 können
- 2.4.1.2 müssen
- 2.4.1.3 dürfen
- 2.4.1.4 sollen
- 2.4.1.5 wollen
- 2.4.1.6 mögen
- 2.4.1.7 möchten
- 2.4.1.8 Beziehung zwischen müssen und können
- 2.4.1.9 Beziehung zwischen dürfen und können
- 2.4.2 Epistemische Verwendung der Modalverben
- 2.4.2.1 Tempora der epistemischen Modalverben
- 2.4.2.2 Bedeutung der epistemischen Modalverben
- 2.4.2.3 Modalverben als Ausdruck einer Vermutung
- 2.4.2.3.1 müssen
- 2.4.2.3.2 können
- 2.4.2.3.3 dürfen
- 2.4.2.3.4 mögen
- 2.4.2.4 Epistemische Modalverben als Ausdruck einer fremden Aussage
- 2.4.2.4.1 sollen
- 2.4.2.4.2 wollen
- 2.4.1 Nicht-epistemische Verwendung der Modalverben
- 2.5 Höflichkeitsform der Modalverben
- 2.6 Modalitätsverben
- 2.1 Modalität
- 3 Empirischer Teil der Arbeit
- 3.1 Aufbau der empirischen Untersuchungen
- 3.2 Untersuchungsverlauf
- 3.2.1 Gruppe 1 – chinesische Sprachschüler
- 3.2.1.1 Auswertung
- 3.2.1.2 Fehleranalyse
- 3.2.1.2.1 Allgemeine Kenntnisse über Modalverben
- 3.2.1.2.2 Einsetzen von Modalverben
- 3.2.1.2.3 Transformation von Sätzen
- 3.2.2 Gruppe 2: Sprachschüler verschiedener Nationalitäten
- 3.2.2.1 Auswertung
- 3.2.2.2 Fehleranalyse
- 3.2.2.2.1 Allgemeine Kenntnisse über Modalverben
- 3.2.2.2.2 Einsetzen von Modalverben
- 3.2.2.2.3 Transformation von Sätzen
- 3.2.3 Gruppe 3: deutsche Studierende
- 3.2.3.1 Auswertung
- 3.2.3.2 Fehleranalyse
- 3.2.3.2.1 Allgemeine Kenntnisse über Modalverben
- 3.2.3.2.2 Einsetzen von Modalverben
- 3.2.3.2.3 Transformation von Sätzen
- 3.2.1 Gruppe 1 – chinesische Sprachschüler
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Schwierigkeiten, die Lernende des Deutschen als Fremdsprache (DaF) mit dem Gebrauch von Modalverben haben. Die Arbeit verfolgt das Ziel, diese Schwierigkeiten zu identifizieren und zu analysieren, um mögliche Ansatzpunkte für einen verbesserten Unterricht zu finden.
- Analyse der morphologischen und syntaktischen Eigenschaften von Modalverben
- Untersuchung der semantischen Besonderheiten von Modalverben (epistemisch und nicht-epistemisch)
- Empirische Untersuchung der Fehlerhäufigkeit beim Gebrauch von Modalverben bei DaF-Lernenden verschiedener Muttersprachen
- Entwicklung von didaktischen Implikationen für den DaF-Unterricht
- Vergleich der Modalverben im Deutschen mit anderen Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Modalverben im DaF-Unterricht ein und begründet die Wahl dieses Forschungsgegenstandes anhand der persönlichen Erfahrungen der Autorin. Sie skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
2 Theoretischer Teil der Arbeit: Dieser Teil bietet eine umfassende theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung. Er behandelt die Modalität im Deutschen, differenziert zwischen Indikativ, Konjunktiv und Imperativ und analysiert die morphologischen, syntaktischen und semantischen Aspekte der Modalverben. Die Abgrenzung zu Vollverben wird detailliert beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit wird der epistemischen und nicht-epistemischen Verwendung der einzelnen Modalverben (können, müssen, dürfen, sollen, wollen, mögen, möchten) gewidmet, inklusive der Beziehungen zwischen ihnen. Die Analyse umfasst auch die Höflichkeitsformen und Modalitätsverben.
3 Empirischer Teil der Arbeit: Der empirische Teil beschreibt den Aufbau und den Ablauf der Untersuchung. Drei Gruppen von Sprachlernenden wurden untersucht: chinesische Sprachschüler, Sprachschüler verschiedener Nationalitäten und deutsche Muttersprachler als Kontrollgruppe. Für jede Gruppe werden die Auswertung der Ergebnisse und die Fehleranalyse im Detail dargestellt, wobei die Fokuspunkte auf dem allgemeinen Wissen über Modalverben, deren korrektem Einsatz und der Transformation von Sätzen liegen.
Schlüsselwörter
Modalverben, Deutsch als Fremdsprache (DaF), Grammatik, Morphologie, Syntax, Semantik, Epistemische Modalität, Nicht-epistemische Modalität, Fehleranalyse, DaF-Didaktik, Empirische Untersuchung, Konjugation, Infinitiv, Subjektrestriktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Schwierigkeiten mit Modalverben im DaF-Unterricht
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Schwierigkeiten, die Lernende des Deutschen als Fremdsprache (DaF) mit dem Gebrauch von Modalverben haben. Sie analysiert diese Schwierigkeiten und sucht nach Ansatzpunkten für einen verbesserten Unterricht.
Welche Aspekte der Modalverben werden behandelt?
Die Arbeit behandelt morphologische, syntaktische und semantische Aspekte der Modalverben. Es werden die verschiedenen Modalitäten (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ) untersucht, die Abgrenzung zu Vollverben erläutert und die epistemische sowie nicht-epistemische Verwendung der einzelnen Modalverben detailliert analysiert. Die Analyse umfasst auch die Höflichkeitsformen und Modalitätsverben.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert einen theoretischen Teil mit einer empirischen Untersuchung. Der theoretische Teil bietet eine umfassende Darstellung der Modalverben im Deutschen. Der empirische Teil beinhaltet eine Analyse von Fehlerdaten dreier Gruppen von Sprachlernenden: chinesische Sprachschüler, Sprachschüler verschiedener Nationalitäten und deutsche Muttersprachler als Kontrollgruppe. Die Fehleranalyse konzentriert sich auf das allgemeine Wissen über Modalverben, deren korrekten Einsatz und die Transformation von Sätzen.
Welche Gruppen wurden in der empirischen Untersuchung berücksichtigt?
Drei Gruppen von Sprachlernenden wurden untersucht: chinesische Sprachschüler, Sprachschüler verschiedener Nationalitäten und deutsche Muttersprachler als Kontrollgruppe. Die Ergebnisse jeder Gruppe werden separat ausgewertet und hinsichtlich der Fehlerhäufigkeit und -typen analysiert.
Welche konkreten Fragestellungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Fehlerhäufigkeit beim Gebrauch von Modalverben bei DaF-Lernenden verschiedener Muttersprachen, analysiert die morphologischen und syntaktischen Eigenschaften von Modalverben und untersucht die semantischen Besonderheiten (epistemisch und nicht-epistemisch). Weiterhin werden didaktische Implikationen für den DaF-Unterricht entwickelt und ein Vergleich der Modalverben im Deutschen mit anderen Sprachen angestrebt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden detailliert dargestellt, inklusive einer Fehleranalyse für jede der drei Gruppen. Die Analyse konzentriert sich auf das allgemeine Wissen über Modalverben, den korrekten Einsatz und die Transformation von Sätzen. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse über die typischen Schwierigkeiten von DaF-Lernenden im Umgang mit Modalverben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den empirischen Befunden und entwickelt didaktische Implikationen für den DaF-Unterricht. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, den DaF-Unterricht im Bereich der Modalverben zu verbessern und Lernenden mehr Unterstützung bei der Bewältigung der damit verbundenen Schwierigkeiten zu bieten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Modalverben, Deutsch als Fremdsprache (DaF), Grammatik, Morphologie, Syntax, Semantik, Epistemische Modalität, Nicht-epistemische Modalität, Fehleranalyse, DaF-Didaktik, Empirische Untersuchung, Konjugation, Infinitiv, Subjektrestriktion.
- Quote paper
- Samira Huskic (Author), 2010, Modalverben und ihre Probleme beim Gebrauch im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150459