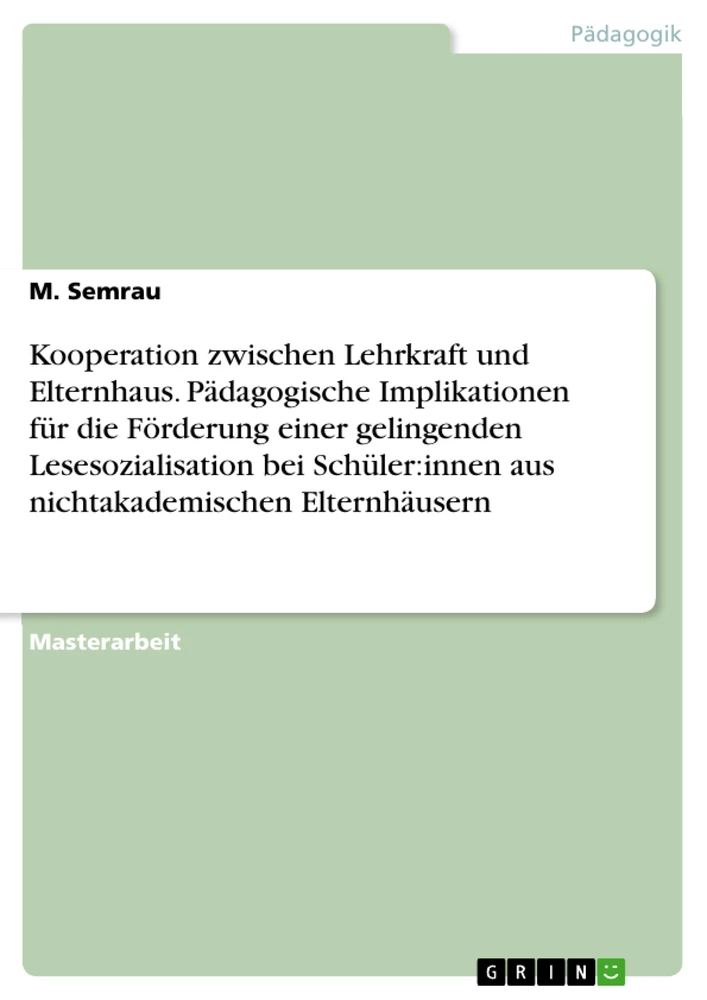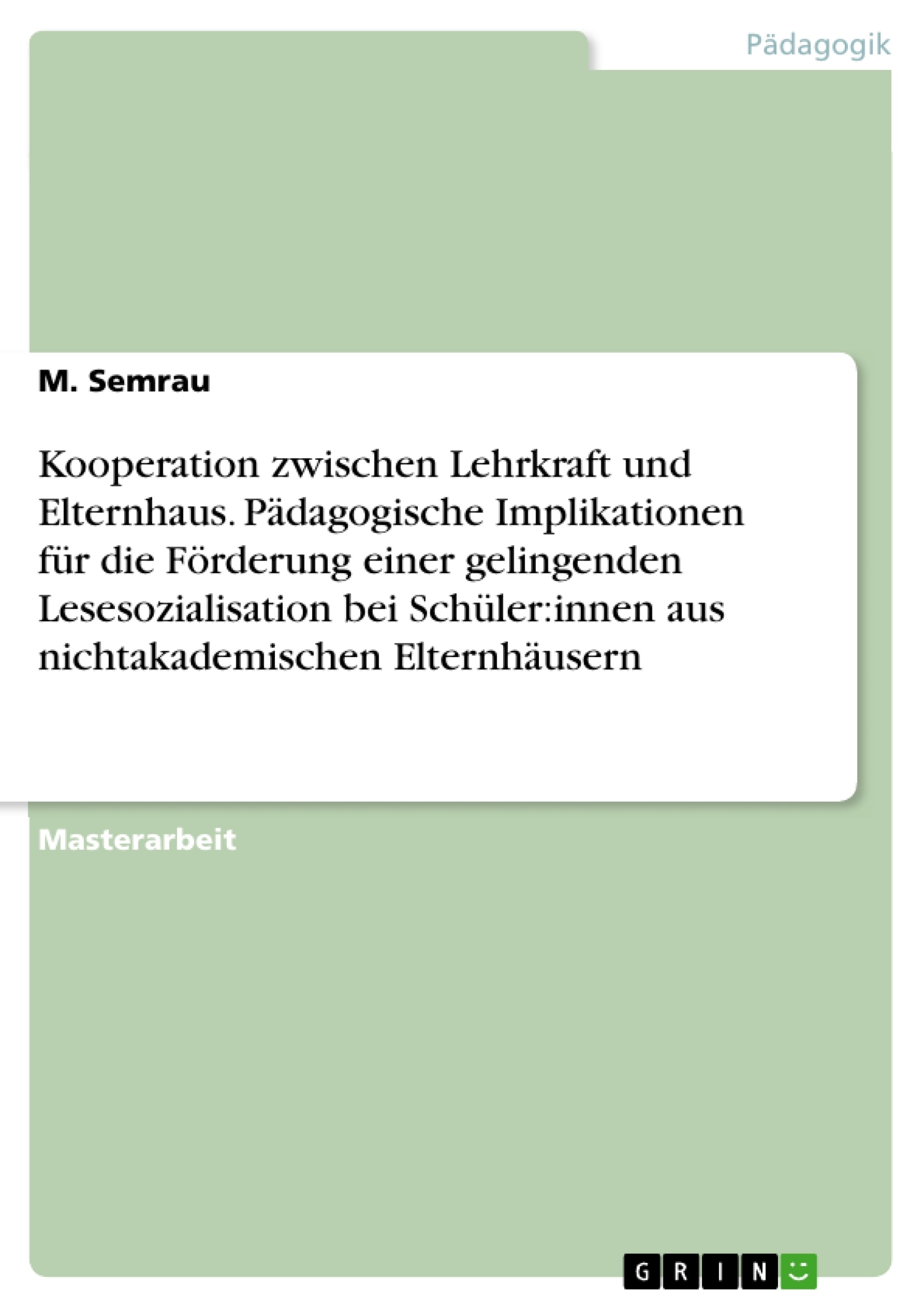Welche Gelingensbedingungen braucht es, um die Lesekompetenz von Schüler:innen aus nicht-akademischem Elternhäusern im Rahmen einer Eltern-Lehrkraft Kooperation über den Unterricht hinaus gezielt und optimal zu fördern, um so zu einer gelingenden Lesesozialisation beizutragen?
Eine gute Lesekompetenz kann spätestens seit dem PISA-Schock im Jahre 2000 als Schlüssel zur Chancengleichheit gelten und dennoch gibt die Forschung für den Sekundarbereich bislang wenig Orientierung darüber, wie dies konkret gelingen kann. Insbesondere Schüler:innen aus nicht-akademischen Elternhäusern stehen besonderen Herausforderungen gegenüber und haben ein erhöhtes Risiko, beim Lesen und Verstehen von Texten Hindernisse zu erleben (vgl. Isler et al. 2010). Mangelnde Lesefähigkeiten können sich dann bereits im Vor- und Grundschulalter auf spätere schulische Leistungen und damit auf die Zukunftschancen in der Berufswelt auswirken. Das kann an unterschiedlichen Ausgangsbedingungen wie z.B. einem fehlenden oder geringen Zugang zu Büchern, einer wenig leseförderlichen Umgebung oder mangelnder Beteiligung des erwachsenen Umfeldes an der eigenen Lesesozialisation liegen. Die Pressemitteilung der Technischen Universität Dortmund vom Mai 2023 wertet die Ergebnisse der vergangenen 20 Jahre der Vergleichsstudie IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) wie folgt: Deutschland kämpft mit schwächer werdenden Lesekompetenzen der Schüler:innen und einer konstant bleibenden Bildungsungleichheit im Bildungssystem. Andere europäische Länder mit geringeren sozialen Disparitäten und migrationsbezogenen Unterschieden zeigen jedoch deutlich, dass „eine starke Verknüpfung von familiärer Herkunft und schulischem Erfolg, [...], keinen unausweichlichen Automatismus darstellen müssen“ (TU 2023, S. 2).
Eine gezielte Förderung der Lesekompetenz im schulischen und außerschulischen Kontext ist daher ein maßgeblicher Grundstein, um Kindern und Jugendlichen aus nicht-akademischen Elternhäusern bessere Chancen auf Selbstentfaltung, Bildung und Karriere zu geben. Lehrkräfte können dabei als wichtige Brücke zwischen Schule und Elternhaus fungieren und tragen somit eine nicht zu unterschätzende Verantwortung für eine gelingende Lesesozialisation bei Kindern und Jugendlichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Kooperation zwischen Elternhaus und Lehrkraft
- 2.2. Lesekompetenz und Lesesozialisation
- 2.3. Förderung der Lesekompetenz im Sekundarbereich
- 3. Aktueller Forschungsstand
- 3.1. Effekte der Kooperation zwischen Lehrkräften und Elternhaus auf den Schulerfolg der Schüler:innen
- 3.2. Lesesozialisation auf Mesoebene
- 3.3. Soziale Disparitäten in der Lesekompetenz
- 3.4. Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Bildungserfolg
- 3.5. Der Einfluss digitaler Medien auf die Lesekompetenz
- 4. Methodik
- 4.1. Ausgewählte Forschungsmethode
- 4.2. Einschlusskriterien
- 4.3. Durchführung
- 5. Ergebnisse
- 5.1. Synthese der Analyse
- 5.1.1. Bedürfnisse und Herausforderungen
- 5.1.2. Bestehende Fördermaßnahmen und Programme
- 5.1.3. Handlungsimplikationen und Strategien
- 6. Fazit und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss positiver Kooperation zwischen Lehrkräften und Elternhäusern auf die Lesekompetenz von Schüler:innen aus nicht-akademischen Kontexten. Ziel ist die Ableitung von Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte im Sekundarbereich zur Verbesserung der Leseförderung. Die Arbeit stützt sich auf eine systematische Literaturanalyse aktueller Forschungsergebnisse.
- Kooperation zwischen Lehrkräften und Elternhaus
- Lesekompetenz und Lesesozialisation
- Förderung der Lesekompetenz im Sekundarbereich
- Soziale Disparitäten in der Lesekompetenz
- Handlungsempfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt das Problem schwacher Lesekompetenzen in Deutschland und die anhaltende Bildungsungleichheit dar, insbesondere für Schüler:innen aus nicht-akademischen Elternhäusern. Sie begründet die Notwendigkeit einer verstärkten Kooperation zwischen Schule und Elternhaus.
Kapitel 2 (Theoretischer Rahmen): Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Eltern-Lehrkraft-Kooperation, der Lesekompetenz und der Lesesozialisation dar. Es beleuchtet die Bedeutung der Leseförderung im Sekundarbereich.
Kapitel 3 (Aktueller Forschungsstand): Dieses Kapitel präsentiert einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu den Auswirkungen der Eltern-Lehrkraft-Kooperation auf den Schulerfolg, die Lesesozialisation, soziale Disparitäten in der Lesekompetenz, den Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Bildungserfolg sowie den Einfluss digitaler Medien.
Kapitel 4 (Methodik): Dieses Kapitel beschreibt die angewandte Forschungsmethode, die Einschlusskriterien und die Durchführung der Studie.
Kapitel 5 (Ergebnisse): Hier werden die Ergebnisse der Literaturanalyse präsentiert, unterteilt in die Bereiche Bedürfnisse und Herausforderungen, bestehende Fördermaßnahmen und Programme sowie Handlungsimplikationen und Strategien.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, Lesesozialisation, Eltern-Lehrkraft-Kooperation, Bildungsungleichheit, nicht-akademische Elternhäuser, Sekundarbereich, Förderung, Handlungsempfehlungen, IGLU-Studie, PISA-Schock.
- Citar trabajo
- M. Semrau (Autor), 2023, Kooperation zwischen Lehrkraft und Elternhaus. Pädagogische Implikationen für die Förderung einer gelingenden Lesesozialisation bei Schüler:innen aus nichtakademischen Elternhäusern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1504757