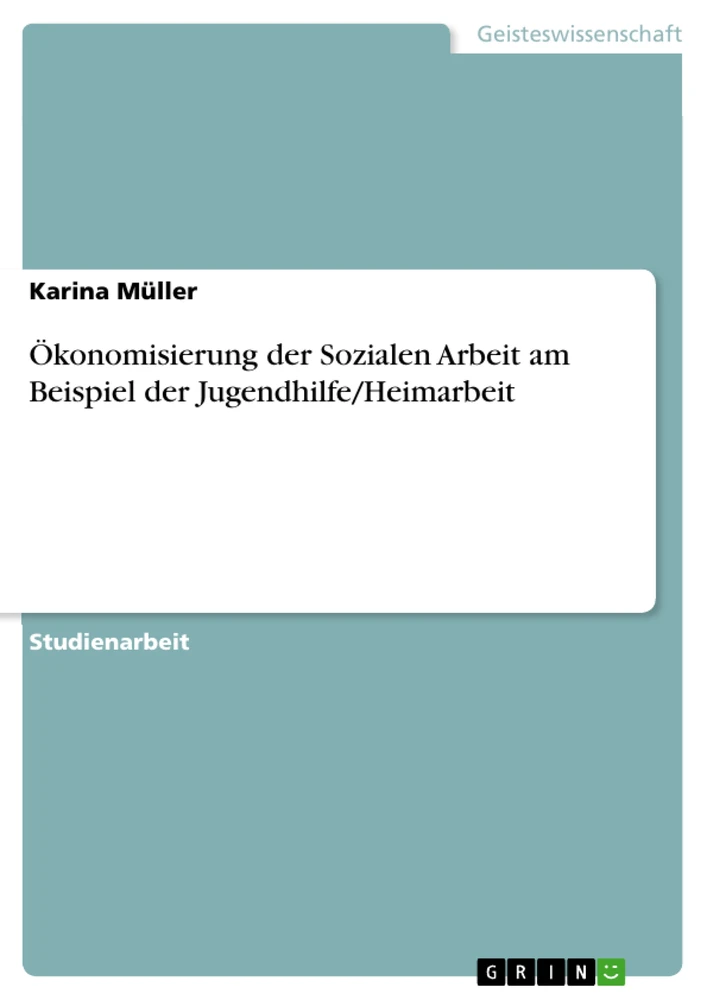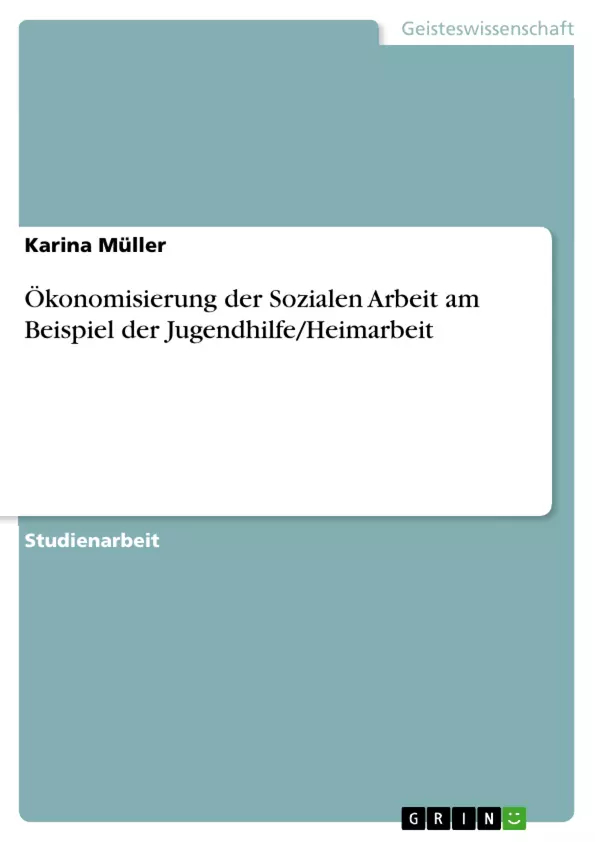Diese Seminararbeit berichtet über die Ökonomisierung, welche auch in der Sozialen Arbeit stattfindet.
Als erstes wird die Ausgangssituation geklärt und auf die Entwicklung Deutschlands zu einem Sozialstaat eingegangen.
Daraufhin folgt eine Veranschaulichung der Thematik anhand eines Beispiels in der Jugendhilfe, der Heimarbeit.
Zum Schluss folgt das Fazit, in dem die Folgen der Ökonomisierung und der Problematik der Ökonomisierung bezüglich der Ethik hingewiesen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zitat
- Definition
- Hauptteil
- Gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen
- Soziale Marktwirtschaft in Deutschland - die Entwicklung des Sozialstaats
- Ökonomisierung der Sozialen Arbeit
- Beispiel Heimarbeit – Vorstellung der Einrichtung
- Indizien für die Ökonomisierung
- Fazit
- Folgen der Ökonomisierung im Sozialen Bereich
- Ökonomisierung und Ethik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit in Deutschland. Er beleuchtet die Auswirkungen des Wachstums der Wirtschaftlichkeit und Effizienz auf die Sozialpolitik und die Auswirkungen auf den Bereich der sozialen Arbeit. Der Text befasst sich mit den Folgen der Ökonomisierung für den Menschen und die Gesellschaft und fragt nach den ethischen Implikationen.
- Entwicklung der Sozialen Arbeit im Kontext gesellschaftlicher und politischer Veränderungen
- Einfluss der Ökonomisierung auf die Sozialpolitik und die Soziale Arbeit
- Folgen der Ökonomisierung für die Effizienz und Effektivität sozialer Leistungen
- Ethische Implikationen der Ökonomisierung
- Herausforderungen für die Soziale Arbeit im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff der Ökonomisierung in den Kontext der Wirtschaft und der Knappheit von Ressourcen. Es werden die wichtigsten Definitionen und die Folgen von Knappheit für das Wirtschaften erläutert. Der Hauptteil untersucht die Gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen die Soziale Arbeit in Deutschland agiert. Er beleuchtet die Entwicklung des Sozialstaates in Deutschland und die Auswirkungen der Ökonomisierung auf die Soziale Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Ökonomisierung, Soziale Arbeit, Sozialpolitik, Sozialstaat, Effizienz, Effektivität, Ethik, Knappheit, Ressourcen, Gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen, Entwicklung, Nachhaltigkeit. Der Text befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Zwängen und sozialen Bedürfnissen und hinterfragt den Einfluss ökonomischer Prinzipien auf die Gestaltung der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Ökonomisierung der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt den zunehmenden Einfluss wirtschaftlicher Prinzipien wie Effizienz, Effektivität und Wettbewerb auf soziale Dienstleistungen und die Sozialpolitik.
Wie zeigt sich die Ökonomisierung am Beispiel der Heimarbeit in der Jugendhilfe?
Indizien sind unter anderem ein erhöhter Kostendruck, die Standardisierung von Leistungen und die Notwendigkeit, soziale Arbeit messbar und rentabel zu gestalten.
Welche ethischen Probleme entstehen durch die Ökonomisierung?
Es besteht die Gefahr, dass die Bedürfnisse der Klienten hinter wirtschaftlichen Zielen zurückstehen und die soziale Gerechtigkeit durch Rentabilitätsdenken gefährdet wird.
Wie hat sich der Sozialstaat in Deutschland entwickelt?
Die Arbeit skizziert den Wandel von der sozialen Marktwirtschaft hin zu einem System, das stärker durch Ressourcenknappheit und ökonomische Steuerung geprägt ist.
Welche Folgen hat die Ökonomisierung für die Gesellschaft?
Die Folgen können eine Effizienzsteigerung sein, aber auch eine Entmenschlichung sozialer Prozesse und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im sozialen Sektor.
- Quote paper
- Karina Müller (Author), 2010, Ökonomisierung der Sozialen Arbeit am Beispiel der Jugendhilfe/Heimarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150505