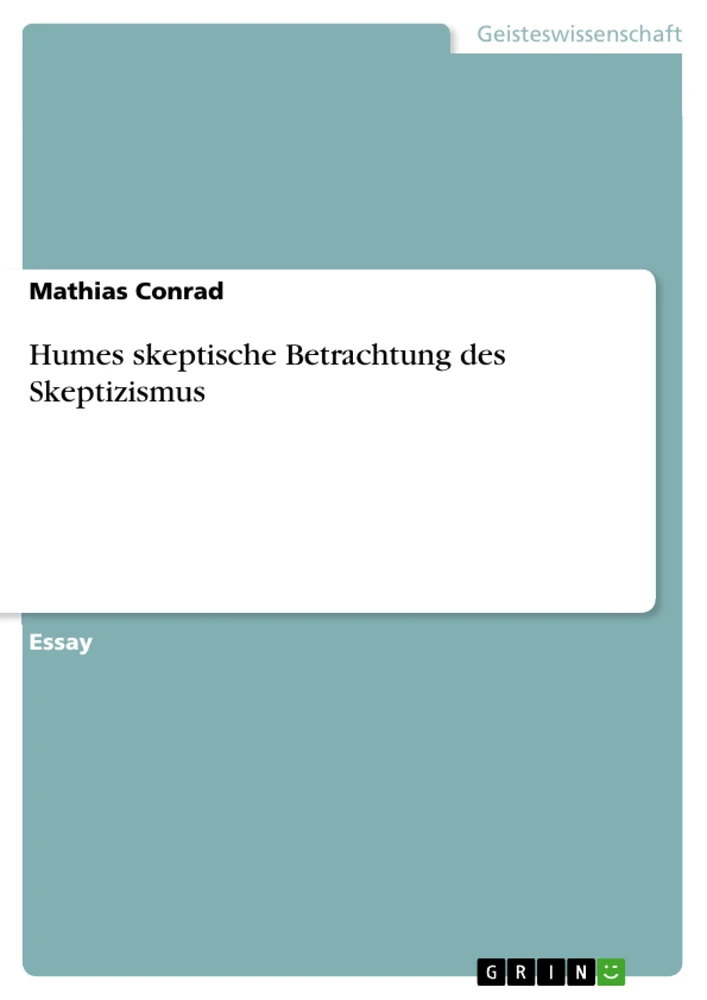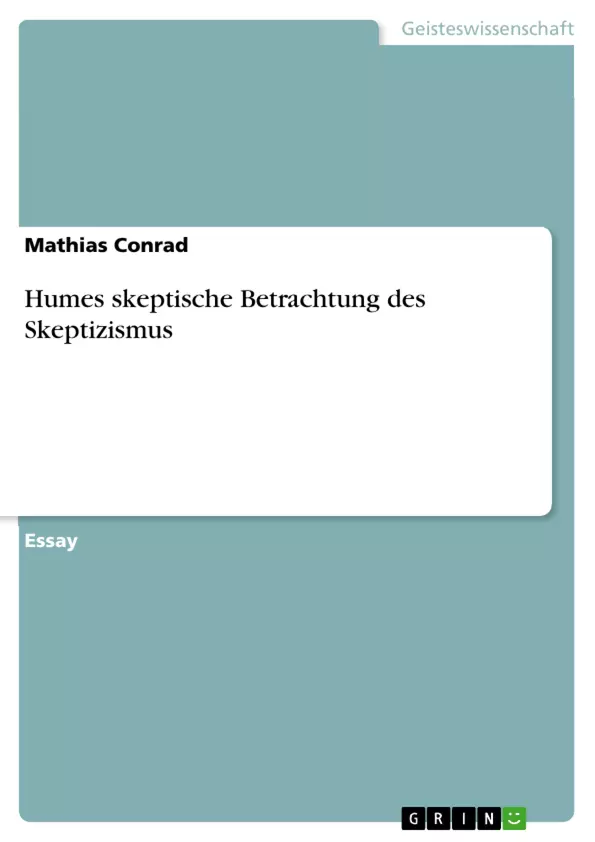Die Enquiry concerning Human Understanding kann zu den bedeutendsten und einflussreichsten Werken der Philosophiegeschichte gezählt werden. So exponiert Kant, dem David Humes Erkenntniskritik den "dogmatischen Schlummer unterbrach" , in der Einleitung zu den Prolegomena anerkennend Humes Einfluss auf die eigene spekulative Philosophie, bewertet jedoch im gleichen Zuge dessen Folgerungen als „übereilt und unrichtig“. Hegel, der „in der Tat eine sehr subtile und tiefgreifende Kritik an Hume geübt hat“ schreibt: „Hume sieht die Notwendigkeit … ganz subjektiv in der Gewohnheit; tiefer kann man im Denken nicht herunterkommen.“ Schopenhauer hingegen lässt Hume durch folgende Bemerkung in einem ehrenwerten Licht erscheinen: „Aus jeder Seite von David Hume ist mehr zu lernen als aus Hegels, Herbarts und Schleiermachers sämtlichen philosophischen Werken zusammengenommen.“
Noch heute kann man der EHU aufgrund der Thematisierung bedeutender theoretischer und praktischer Probleme der Philosophie Aktualität und Relevanz bescheini-gen. Das Werk befasst sich mit erkenntnistheoretischen Gedanken, der Analyse der Willensfreiheit, dem Thema des Gottesbeweises und der Analyse der Vertrauenswürdigkeit von Wunderberichten.
Im Folgenden wird ein Teil des Klassikers aus Humes Oeuvre skizziert und reflektiert. Dabei wende ich mich hauptsächlich dem dreigliedrigen zwölften Abschnitt der EHU zu, in dem vor allem die Problematik des Skeptizismus behandelt wird. Das diesem Werk entnehmbare Skeptizismus-Verständnis Humes wird im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung nachgezeichnet und kommentiert. Außerdem wird der Frage nachgegangen, ob Hume das, was er dem extremen Skeptiker vorwirft, nicht selber praktiziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Humes skeptische Betrachtung des Skeptizismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht David Humes skeptische Betrachtung des Skeptizismus in seiner „Enquiry concerning Human Understanding“ (EHU). Sie analysiert Humes Argumentation und seine Kritik an verschiedenen Formen des Skeptizismus, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob Hume selbst in seinen eigenen Schlussfolgerungen in den Bereich des extremen Skeptizismus vordringt.
- Humes Kritik am kartesianischen Skeptizismus
- Die Unterscheidung zwischen „antezedentem“ und „konsequentem“ Skeptizismus
- Die Grenzen des menschlichen Verstehens und der Gültigkeit von Schlussfolgerungen
- Die Rolle der Gewohnheit und Erfahrung in Humes Philosophie
- Die Bedeutung des „natürlichen“ menschlichen Denkens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Humes EHU als ein einflussreiches Werk der Philosophiegeschichte vor und beleuchtet die unterschiedlichen Positionen von Kant, Hegel und Schopenhauer gegenüber Humes Philosophie. Sie hebt die Aktualität und Relevanz des Werks für die heutige Zeit hervor und skizziert den Fokus der Arbeit auf den zwölften Abschnitt der EHU, der sich mit dem Skeptizismus befasst.
- Humes skeptische Betrachtung des Skeptizismus: Dieser Abschnitt analysiert Humes Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus, beginnend mit der Unterscheidung zwischen dem „anderen Feind der Religion“, dem Atheisten, und dem Skeptiker, der an der Existenz Gottes zweifelt. Hume definiert den Skeptizismus anhand zweier Arten: dem „antezedenten“ Skeptizismus, der allen philosophischen Untersuchungen vorausgeht, und dem „konsequenten“ Skeptizismus, der sich auf wissenschaftliche Forschung und Erkenntnisgewinnung bezieht. Hume analysiert den cartesianischen Zweifel als Beispiel für den „antezedenten“ Skeptizismus, kritisiert dessen unheilbare Zweifel und identifiziert gleichzeitig den Wert einer angebrachten Unvoreingenommenheit im philosophischen Denken.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Skeptizismus, Erkenntnistheorie, David Hume, Enquiry concerning Human Understanding, Descartes, Zweifel, Atheismus, Gewohnheit, Erfahrung, natürliches Denken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von David Humes Skeptizismus?
Hume hinterfragt die Grundlagen menschlicher Erkenntnis und betont, dass viele unserer Überzeugungen auf Gewohnheit und Erfahrung statt auf rein rationaler Notwendigkeit beruhen.
Was unterscheidet "antezedenten" von "konsequentem" Skeptizismus?
Antezedenter Skeptizismus (wie bei Descartes) geht jeder Untersuchung voraus, während konsequenter Skeptizismus das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung und Erkenntniskritik ist.
Warum kritisierte Kant Humes Philosophie?
Obwohl Hume Kant aus dem "dogmatischen Schlummer" weckte, hielt Kant Humes Folgerungen für "übereilt", da sie die objektive Notwendigkeit von Kausalität untergruben.
Welche Rolle spielt die Gewohnheit in Humes Erkenntnistheorie?
Für Hume ist die Gewohnheit das leitende Prinzip, das uns dazu bringt, aus vergangenen Erfahrungen Erwartungen für die Zukunft abzuleiten.
Praktiziert Hume selbst den extremen Skeptizismus, den er kritisiert?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob Humes radikale Zweifel an der Vernunft ihn letztlich in die Nähe des extremen Skeptizismus rücken, den er eigentlich ablehnt.
- Quote paper
- M.A. Mathias Conrad (Author), 2008, Humes skeptische Betrachtung des Skeptizismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150511