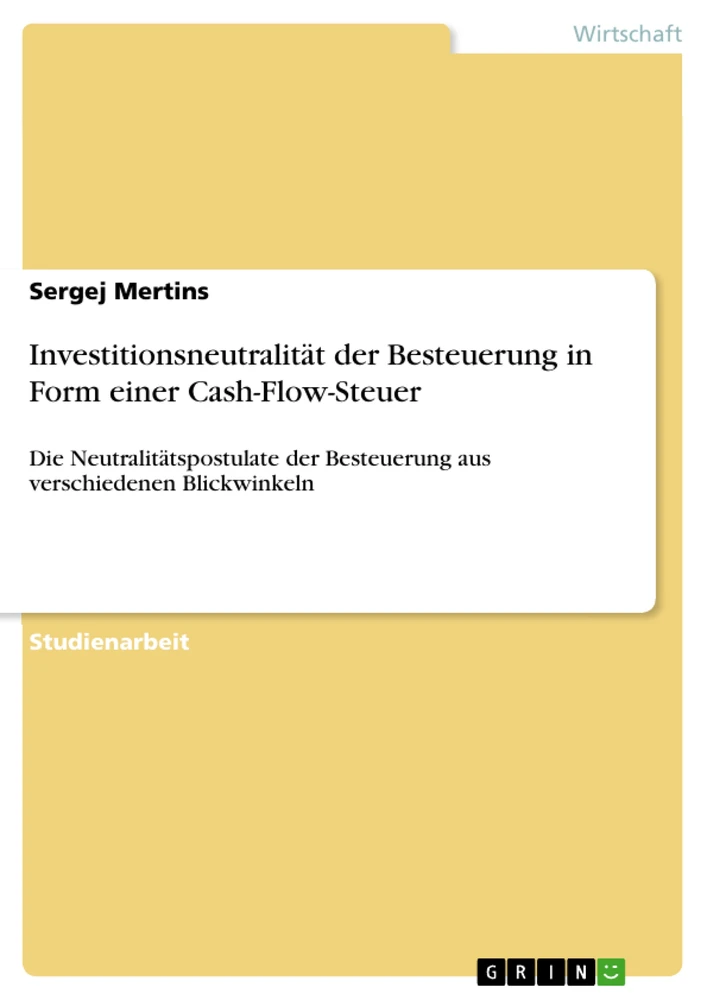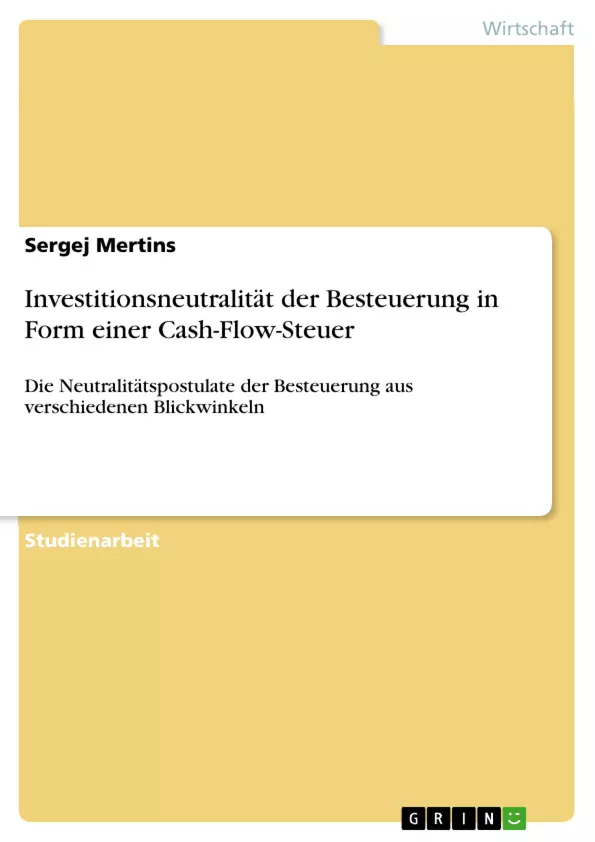Seit langer Zeit beschäftigen sich die betriebswirtschaftliche und die finanzwirtschaftliche Steuerlehre mit der Investitionsneutralität der Besteuerung und der Ausgestaltung investitionsneutraler Steuersysteme.
Definitionsgemäß liegt die Investitionsneutralität dann vor, wenn die Einführung eines Steuersystems keine Auswirkung auf die Entscheidungen der Unternehmen zwischen den ihnen zur Auswahl stehenden Investitionsalternativen hat, sodass die Unternehmen auch nach der Besteuerung denselben Investitionsprojekt wählen. Denn betriebswirtschaftlich gesehen sind für die Unternehmen nicht nur die Konsequenzen der Besteuerung für das realisierte Investitionsvolumen bedeutend. Vielmehr ist die durch die Einführung der Steuer verursachte Verzerrung der Wahl zwischen den unterschiedlichen Investitionsalternativen für die Unternehmen interessant. Wenn die Vorteilhaftigkeit der Investitionen durch die Besteuerung beeinflusst wird oder sich die Rangfolge alternativer Investitionsprojekte aufgrund der Besteuerung verändert, dann ist eine Verzerrung gegeben. Bei den Unternehmen würde die Verzerrung zu zusätzliche Kosten führen, sozusagen eine Zusatzlast („excess burden“) verursachen. Damit wird diejenige Einbuße an Wohlfahrt gemeint, die über die reine Zahllast hinausgeht und die durch die Änderung unternehmerischer Entscheidungen veranlasst wird. Demzufolge sollte ein investitionsneutrales Steuersystem die Erreichung wirtschaftlicher Effizienz der Besteuerung unterstützen, um das Auftreten von Zusatzlasten zu vermeiden.
Ein Steuersystem kann die Investitionsneutralität nur dann garantieren, wenn es bestimmten Anforderungen genügt bzw. einige Voraussetzungen erfüllt. Bei der Untersuchung theoretischer Steuersysteme auf die Investitionsneutralität sind in der Literatur insbesondere folgende Besteuerungssysteme in den Vordergrund gerückt: Besteuerung des ökonomischen Gewinns und die Cash-flow-Besteuerung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Gang der Untersuchung
- 2. Cash-flow-Steuer
- 3. Investitionsneutralität
- 3.1. Definition
- 3.2. Kapitalwert einer Investition als Entscheidungsparameter
- 3.3. Bedingungen an ein investitionsneutrales Steuersystem
- 4. Kritische Würdigung der Investitionsneutralität im Cash-flow-Modell
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept der Investitionsneutralität der Besteuerung in Form einer Cash-flow-Steuer. Sie analysiert die Bedingungen, die für die Erreichung von Investitionsneutralität notwendig sind, und untersucht, inwieweit die Cash-flow-Steuer diese Bedingungen erfüllt.
- Definition und Bedeutung der Investitionsneutralität
- Analyse der Cash-flow-Besteuerung
- Bedingungen für ein investitionsneutrales Steuersystem
- Kritische Bewertung der Cash-flow-Steuer im Hinblick auf Investitionsneutralität
- Fazit und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Investitionsneutralität und den Gang der Untersuchung vor. Kapitel 2 behandelt die Cash-flow-Steuer als ein mögliches Instrument für die Realisierung von Investitionsneutralität. Kapitel 3 definiert den Begriff der Investitionsneutralität, untersucht den Kapitalwert einer Investition als Entscheidungsparameter und analysiert die Bedingungen, die für ein investitionsneutrales Steuersystem erfüllt sein müssen. Kapitel 4 widmet sich der kritischen Würdigung der Investitionsneutralität im Cash-flow-Modell.
Schlüsselwörter
Investitionsneutralität, Cash-flow-Steuer, Kapitalwert, Steuersystem, Steuerbelastung, Investitionsentscheidungen, Zusatzlast, wirtschaftliche Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Investitionsneutralität der Besteuerung?
Ein Steuersystem ist investitionsneutral, wenn es die Entscheidung eines Unternehmens zwischen verschiedenen Investitionsalternativen nicht beeinflusst.
Was ist eine Cash-Flow-Steuer?
Bei dieser Steuerform werden Einzahlungen besteuert und Auszahlungen (Investitionen) sofort abgezogen, anstatt über Jahre abgeschrieben zu werden.
Warum ist Investitionsneutralität für die Wirtschaft wichtig?
Sie vermeidet eine "Zusatzlast" (excess burden), also Wohlfahrtseinbußen, die entstehen, wenn Steuern zu ineffizienten unternehmerischen Entscheidungen führen.
Welche Rolle spielt der Kapitalwert bei der Investitionsneutralität?
Der Kapitalwert dient als Entscheidungsparameter; ein neutrales Steuersystem muss sicherstellen, dass die Rangfolge der Kapitalwerte verschiedener Projekte vor und nach Steuern gleich bleibt.
Garantiert das Cash-Flow-Modell immer Neutralität?
Theoretisch ja, unter der Voraussetzung eines konstanten Steuersatzes und der vollen Verrechenbarkeit von Verlusten.
- Quote paper
- Sergej Mertins (Author), 2008, Investitionsneutralität der Besteuerung in Form einer Cash-Flow-Steuer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150599